ISTANBUL: 10. Leyla Gencer-Gesangswettbewerb – Finale am 27. September 2024
ISTANBUL: 10. Leyla Gencer-Gesangswettbewerb – Finale am 27. September 2024


Das war Leyla Gencer (1929 – 2008)
Sehr gute Nachwuchs-Qualität
Der 10. Leyla Gencer-Gesangswettbewerb, organisiert von der Istanbuler Stiftung für Kultur und Kunst (İKSV), Borusan Sanat und der Accademia Teatro alla Scala, endete am Freitag, den 27. September 2024, mit der Abschlussgala und Preisverleihung in der Cemal Reşit Rey-Konzerthalle in Istanbul. HuanHong Li (Bass, China) gewann den 1. Preis, Nazlıcan Karakaş (Sopran, Türkei) wurde Zweite und Maria Knihnytska (Sopran, Ukraine) gewann den 3. Preis.

Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, Pietro Mianiti. Foto: Klaus Billand
Die Abschlussgala des 10. Leyla Gencer-Gesangswettbewerbs, präsentiert von Yetkin Dikinciler, stand unter der Leitung des italienischen Dirigenten Pietro Mianiti, der das Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra dirigierte. Von den 42 Teilnehmern aus 17 verschiedenen Ländern, die an der Finalserie in Istanbul teilgenommen hatten, schafften es acht Teilnehmer ins Finale. Die Wettbewerbe zur Vorauswahl fanden in Istanbul, Tiflis, Mailand, London und Berlin von Mai bis Juni statt, auch durch das Internet.

Stephane Lissner bei der Preisverleihung. Foto: Klaus Billand
Stéphane Lissner verkündete als Vorsitzender der Jury am Ende des Abends die Gewinner. HuanHong Li (Bass, China) gewann den ersten Preis (7.500€), Nazlıcan Karakaş (Sopran, Türkei) wurde Zweite (4.000€) und Maria Knihnytska (Sopran, Ukraine) gewann den dritten Preis (2.500€).

Die Gewinner der ersten drei Preise- Foto: Klaus Billand
Fernanda Allande (Sopran, Mexiko) gewann den Sonderpreis des Jette Parker Young Artists Programme des Royal Opera House, der eine einwöchige Coaching-Sitzung im Covent Garden beinhaltet. HuanHong Li (Bass, China) gewann den Sonderpreis der Deutschen Oper Berlin, der die Teilnahme an einer der Produktionen der Oper ermöglicht, sowie den Sonderpreis des Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, der ein Auftreten mit dem Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra ermöglicht. Der Gewinner des Sonderpreises der Accademia Teatro alla Scala, Nazlıcan Karakaş, erhielt ein dreimonatiges Stipendium an der Accademia Teatro alla Scala. Karakaş wurde außerdem mit dem Leyla Gencer-Publikumspreis ausgezeichnet. Anna Imedashvili (Sopran, Georgien) gewann den Sonderpreis des Staatstheaters für Oper und Ballett in Tiflis, der der Gewinnerin die Teilnahme an einer der Opernproduktionen ermöglicht. Jennifer Mariel Velasco (Sopran, Mexiko) wurde der Sonderpreis (Überraschungspreis) des Teatro di San Carlo di Napoli verliehen.
Die Jury, mit Stéphane Lissner als Vorsitzendem, bestand aus İlker Arcayürek (Tenor), Viviana Barrios (Stellvertretende künstlerische Leiterin der Deutschen Oper Berlin), Alessandro Galoppini (Casting Manager des Teatro alla Scala), David Gowland (Künstlerischer Leiter des Jette Parker Young Artists Programme des Royal Opera House Covent Garden), Badri Maisuradze (Tenor, Künstlerischer Leiter des Staatstheaters für Oper und Ballett Tbilisi), und Carlo Tenan (Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra).
Der 10. Leyla Gencer Gesangswettbewerb wurde von der Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV), Borusan Sanat und der Accademia Teatro alla Scala organisiert. Das Orchestra in Residence des Wettbewerbs ist das Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra.

Die weiteren Finalteilnehmer. Foto: Klaus Billand
Insgesamt ist zu sagen, dass alle acht Finalteilnehmer sehr gute Leistungen darboten. Folgende Sänger gingen – leider – leer aus: Leander Carlier, (Bariton, Belgien) und Anna Erokhina, (Mezzo-Sopran, Ukraine). Die türkische Sängerin Nazlıcan Karakaş konnte mit einer äußerst engagierten Interpretation der Arie „Je veuy vivre“ aus „Roméo et Juliette“ von Charles Gounod natürlich das lebhaft teilnehmende türkische Publikum sofort für sich gewinnen, sodass der Publikumspreis – aber auch verdientermaßen – fast zur Selbstverständlichkeit wurde. Der Chinese HuanHong Li bestach mit seiner Arie „La calunia“ aus dem „Barbier von Sevilla“ von G. Rossini nicht nur durch einen in allen Lagen flexibel und warm ansprechenden Bass mit beeindruckender Höhe, sondern auch durch eine sehr natürlich-emotionale Mimik, die das Publikum mitriss. Ein hoffnungsvoller Abend für den Opern-Nachwuchs in der Cemal Resit Rey Concert Hall!

Die Türkin Nazlıcan Karakaş mit ihren zwei Preisen

Der Chinese HuanHong Li. Foto: Klaus Billand
Klaus Billand aus Istanbul
15. APRIL 2025 – Dienstag
Peter Seiffert gestorben
Leading German tenor dies after a stroke, at 71. The family and friends have reported the death of Peter Seiffert, one of the most popular singers within his profession and one of the finest Heldentenor performers of recent years. Born in Düsseldorf, Seiffert made his debut locally at 24 at Deutsche Oper am Rhein. He became a summer fixture at Bayreuth, its regular Lohengrin, and sang all of his major roles at Bavarian State Opera, which included much Italian repertoire. He made at late Met debut in 2004 as Tannhäuser. In 1986 he married the glorious Slovak soprano Lucia Popp, fifteen years his senior. After her death from cancer seven years later, he was eventually married a second time to Petra-Maria Schnitzer (pictured), a soprano who sang opposite him at Bayreuth.
Leading German tenor dies after a stroke, at 71 – Slippedisc
Wien/heute. Saioa Hernandez singt die Maddalena
I’m happy to announce that today I’ll be singing at the Wiener Staatsoper, replacing my dear and great colleague Sonya Yoncheva in the role of Maddalena in Andrea Chenier’s final performance. I’m looking forward to be in this stage again and seeing you there in the audience!
Von Klassik-Birnen und Sport-Äpfeln
Willkommen in der neuen Klassik-Woche, heute mit allerhand schiefen Vergleichen: Musik vs. Sport, Streams vs. CDs, Digital Concert Hall vs. YouTube und Karfreitag in Dortmund vs. Karfreitag in Düsseldorf.
Von Klassik-Birnen und Sport-Äpfel
..I.ch erinnere mich, wie ich Anfang der 2000er Jahre für die Welt am Sonntag alle Kartenverkäufe der Klassik gegen jene in den Stadien der Fußballbundesliga aufgerechnet habe – und ja: die Klassik verkaufte schon damals mehr Tickets! Inzwischen ist dieses Gegeneinander zu einem Leitmotiv der Klassik-Legitimation geworden. Zeit, die Dinge noch einmal zurechtzurücken: Natürlich verkaufen Hunderte von Opernhäusern und Orchestern, die fast jeden Tag in jeder Stadt spielen, mehr Tickets pro Jahr als die Fußball-Bundesliga, die nur neun (!) Spiele pro Woche hat. Würde man die Zuschauerzahlen im Fernsehen addieren, sähe die Kultur dagegen alt aus! Nachdem das Deutsche Musikinformationszentrum diese Woche jubelte, dass 21 Prozent aller Deutschen ein Musikinstrument spielen, holte die FAZ den alten Fußball-Vergleich wieder aus der Mottenkiste und erklärte: »Die Zahl der Freizeitsänger und Instrumentalisten ist so groß wie die der Hobby Fußballer«. Ja! Ja! Ja! Aber die Fußballer in Deutschland sind quasi nur »die Geiger des Sportes«: Es gibt auch Handballer, Turner, Läufer und und und … Liebe Klassik-Leute es mag ja sein, dass Ihr nicht gerne Sport treibt, aber hört auf, die Klassik-Äpfel mit den Sport-Birnen zu vergleichen! Beides ist wichtig für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen – und einer ganzen Gesellschaft! Und beides wird an unseren Schulen viel zu sehr vernachlässigt!
Kommt die Zeit der großen Rehabilitation?
Klar, man kann Valery Gergievs politische Solidarität mit Vladimir Putin nicht mit dem übergriffigen Verhalten von François Xavier Roths vergleichen. Was man aber durchaus vergleichen kann, ist, dass Orchesterleitungen, Veranstalter und ein Teil des Publikums offensichtlich keine Lust mehr auf moralische Kämpfe haben. Ein spanischer Veranstalter hat für die kommende Saison Gergiev-Gastspiele in Westeuropa angekündigt (ob sie je stattfinden, ist unklar), und der SWR wird am 31. Mai – trotz aller Protest-Ankündigungen – gemeinsam mit seinem designierten Chefdirigenten im Festspielhaus Baden-Baden auftreten. Dass Anna Netrebko wieder an so ziemlich allen europäischen Opernhäusern zu Hause ist, steht dabei auf einem ganz anderen Blatt (tatsächlich ist sie ihrer Linie treu geblieben und steht derzeit nicht in Verdacht der Kreml-Propaganda oder der Kreml-Unterstützung). Ich habe mich gefragt: Sind wir einfach nur zu müde, um zu protestieren, oder ist die Zeit für Rehabilitation gekommen?
https://backstageclassical.com/von-klassik-birnen-und-sport-aepfeln/
BADEN-BADEN: MADAMA BUTTERFLY (Trailer)
Baden-Baden
„Butterfly“ in Baden-Baden: Ein Ostergeschenk zum Abschied (Bezahlartikel)
Letztmals spielt dieses Orchester bei den Osterfestspielen Baden-Baden, und die Aufführung gerät zum Triumph: Puccinis Oper „Madama Butterfly“ mit den Berliner Philharmonikern.
FrankfurterAllgemeine.net
Vergangenheitsbewältigung deluxe
Giacomo Puccini: Madama Butterfly. Der Eröffnungsabend der Osterfestspiele Baden-Baden ist mit Puccinis „Madama Butterfly“ theatralisch und musikalisch meisterhaft. Davide Livermores Inszenierung ist klug und hat Platz für große Emotionen.
https://www.die-deutsche-buehne.de/kritiken/vergangenheitsbewaeltigung-deluxe/
Puccinis „Madama Butterfly“ bei den Osterfestspielen in Baden-Baden: „Augen zu und Ohren auf“
Die Hauptrolle in Vincenzo Bellinis Oper „Norma“ gilt als eine der schwierigsten Opernpartien überhaupt. In der Berliner Staatsoper gab Sopranistin Rachel Willis-Sørensen ein perfektes Debut in der Rolle. Von Barbara Wiegand
swr.de.Kultur
„Madama Butterfly“
Die Kirschblüte – Ein Abschiedstopos?
https://www.concerti.de/oper/opern-kritiken/baden-baden-madama-butterfly-12-4-2025/
Baden-Baden / Festspielhaus: „LEIF OVE ANDSNES – BERLINER PHILHARMONIKER-KLAUS MÄKELÄ“
Osterfestspiele 2025 – 13.04.2025
Mit einer Träne im Knopfloch wurde man gewahr, dass die langjährige und erfolgreiche Liasion und Verpflichtung der Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kirill Petrenko sowie weiterer prominenten Gastdirigenten sich nun zu den „Osterfestspielen 2025“ im Festspielhaus zu Ende ging. Wiederum standen eine Opernproduktion sowie zahlreiche Symphonie- und Kammerkonzerte auf dem vielfältigen Spielplan. Jedoch die Hoffnung stirbt zuletzt und man dürfte diesem Weltklasse-Orchester in Zukunft während seiner künftigen Gastspiele erneut im Festspielhaus an der Oos wiederbegegnen…
Zum Bericht von Gerhard Hoffmann
WIENER STAATSOPER: ZYKLEN IN DER SPIELZEIT 2025/26
Liebes Publikum, wir hoffen, Sie hatten bereits Gelegenheit, sich → online oder in unserem → Saisonbuch Eindrücke zur neuen Spielzeit zu verschaffen. Gerne möchten wir Sie auch noch auf die Möglichkeit hinweisen, die vorgestrige von Direktor Bogdan Roščić moderierte Matinee zur kommenden Saison online über unseren → YouTube Kanal nachzusehen. Hier erhalten Sie einen sehr kompakten Überblick über alles, was die Wiener Staatsoper im nächsten Jahr künstlerisch plant, dazu gab es Auftritte namhafter Künstlerinnen und Künstler wie Camilla Nylund, Benjamin Bernheim, Aigul Akhmetshina oder Günther Groissböck sowie Gespräche mit der designierten Ballettdirektorin Alessandra Ferri und den Regisseuren der Premieren der nächsten Saison über ihre künstlerischen Arbeiten.
Auch für 2025/26 bieten wir → Zyklen – also einzelne Vorstellungen, zu einem Paket geschnürt an. Diese Zyklen sind bereits ab heute buchbar. Der offizielle Ticketverkauf für die kommende Saison startet erst am 28. April. So profitieren Sie von unseren Zyklen:
Mehr darüber in den „Infos des Tages“
Wien/Staatsoper
Das wird wunderbar: Die Wiener Staatsoper präsentiert die Spielzeit 2025/2026
Die Spielzeit 2025/2026 bringt uns Klassikbegeisterten fünf Opernpremieren, zwei Balletpremieren und eine Ballettgala. Gemeinsam mit den acht Wiederaufnahmen werden insgesamt mehr als fünfzig Opern auf die Bühne kommen. Es dürfte nicht viele Opernhäuser geben, die ihr Publikum mit einer so gewaltigen Auswahl verwöhnen.
Von Dr. Rudi Frühwirth
Klassik-begeistert.de
Wien/Staatsoper: Wenig Schmalz, viel Kapellmeisterei: Christian Thielemann führt „Arabella“ mit chirurgischer Präzision
Für die erste Vorstellung: technisch top! Dirigent Christian Thielemann beweist: 100 Prozent Kapellmeisterei. In puncto Energie bleibt viel Luft nach oben – auch wenn „Arabella“ von Richard Strauss dem Staatsopernorchester nur Smalltalk anbietet. Ein Konversationsstück mit seidenweichem Orchester-Geplätscher. Camilla Nylund und Michael Volle punkten mit enormer Präsenz, lassen aber eines vermissen: Emotion!
Von Jürgen Pathy
Klassik-begeistert.de
Christian Thielemann feiert Arabella an die Strauss-Spitze
Ein umjubeltes Gesangsensemble um Camilla Nylund und Michael Volle sowie ein umschlingender Orchesterklang bringt das Haus am Ring in schwungvolle Walzer-Stimmung. Thielemanns umjubelter Strauss-Zauber wirkt auch mit Arabella, zurecht war selbst die Wiener Staatsoper völlig aus dem Häuschen!
Von Johannes Fischer
Klassik-begeistert.de
Richard Strauss‘ „Arabella“ mit grandiosem Thielemann
Bei der Wiederaufnahme an der Wiener Staatsoper fesselten speziell Michael Volle und Christian Thielemann mit herausragenden kunsthandwerklichen Leistungen
DerStandard.at.story
Das Wiener Opernhighlight: „Arabella“ unter Thielemann (Bezahlartikel)
Selbst die charmefreie Bechtolf-Inszenierung kann die musikalische Atmosphäre nicht zerstören: In der „Arabella“-Wiederaufnahme mit Camilla Nylund herrscht Hofmannsthals Geist dank der Klänge von Richard Strauss.
DiePresse.com
Wiener Staatsoper: Keine Zweifel und keine Fragen bei „Arabella“ (Bezahlartikel)
Glanzbesetzung bei der Wiederaufnahme u. a. mit Camilla Nylund und Michael Volle – und mit Christian Thielemann am Pult.
Kurier.at
Wiener Staatsoper: Umbesetzung „LOHENGRIN“ am 27.4. (Klaus Florian Vogt anstelle von David Butt-Philip)
Weitere Termine am 1. und 4.Mai
Unser langjähriger Rezensent Dr. Manfred Schmid, auch Präsident der „Gottfried von Einem und Lotte Ingrisch-Gesellschaft“, der stets für sehr faire Berichte aus der Wiener Staatsoper gesorgt hat, wird heute um 11 h in Krematorium der Stadt Wien eingeäschert. Wir wissen, was wir an ihm verloren haben und werden ihm stets ein ehrendes Angedenken bewahren!
Berlin/ Deutsche Oper
Gesangswettbewerb auf der Wartburg: 10 Punkte gehen an Klaus Florian Vogt als Tannhäuser
“Zu viel, zu viel” sind die ersten Worte, die Tannhäuser singt. Am Schluss der Oper möchte man als Zuschauer antworten: “Noch mehr, noch mehr”! Von solch einer großartigen musikalischen Aufführung kann man eigentlich nicht genug bekommen. An der Deutschen Oper Berlin triumphiert Klaus Florian Vogt im Sängerwettstreit als Tannhäuser in einer musikalisch hochklassigen Aufführung, zu deren Erfolg auch Elisabeth Teige und Samuel Hasselhorn sowie der Dirigent John Fiore beitragen.
Von Jean-Nico Schambourg
Klassik-begeistert.de
Salzburg/Osterfestspiele
Salzburger Osterfestspiele mit „Chowanschtschina“ als Politthriller
Mussorgskis unvollendete Oper wird in Salzburg im Großen Festspielhaus zum etwas trägen und rätselhaften Musiktheater geformt. Dennoch Applaus Es kommt nicht von ungefähr, dass im Menschengewusel auf der Bühne ein Mann krumme Hörner auf dem Kopf trägt. Mit seinem archaischen Kopfschmuck erinnert er frappant an den sogenannten QAnon-Schamanen – jene skurrile Figur, die nach Donald Trumps Wahlschlappe im Jahr 2021 am Sturm auf das Kapitol beteiligt war. Dieser Schamane macht sich hier nicht schlecht, steht er doch in den Diensten eines gewissen Fürsten Iwan Chowanski: Der greift mit grober Hand und populistischen Worten in Moskau anno 1682 nach der Macht, will Russland „wieder groß“ machen, wie es auf der Übertitel-Anzeige beziehungsreich heißt, und schmiedet zu diesem Zweck ein Bündnis mit der wertkonservativen Gruppe der „Altgläubigen“.
DerStandard.at.
„Chowanschtschina“ – Mussorgskis Volksoper bei den Osterfestspielen Salzburg
Podcast von Jörn Florian Fuchs (6,30 Minuten)
deutschlandfunk.de.podcast
Salzburg
Das Oster-Duell: Salzburg oder Baden-Baden?
Die Berliner Philharmoniker sind zu Ostern zum letzten Mal in Baden-Baden, wo sie Puccinis Madame Butterfly aufführen. Nächstes Jahr ziehen sie weiter nach Salzburg, wo sie bei Nikolaus Bachler Wagners Ring beginnen werden – dieses Jahr setzten hier noch Esa-Pekka Salonen und das Finnische Radioorchester die Oper Chowanschtschina in Szene. Eine Feuilletonrundschau. Salzburg darf sich auf die Berliner Philharmoniker freuen, die auch eine szenisch schlüssige Butterfly in Baden-Baden ablieferten, findet Judith von Sternburg in der FR:: »Regisseur David Livermore baut eine zusätzliche Ebene ein, nicht neu, aber plausibel.
https://backstageclassical.com/das-oster-duell-salzburg-oder-baden-baden/
Ein wahres Belcanto-Fest – „Norma“ an der Berliner Staatsoper (Bezahlartikel)
Die Cavatine „Casta Diva“ ist die Vorzeigearie aus der Oper Norma, eine Visitenkarte sängerischer Kunst. Jedes Mal, wenn eine Sängerin es wagt, sich Bellinis „Norma“ und damit der Herausforderung des „Casta Diva“ zu stellen, muss sie gegen die Schatten aller Norma-Interpretinnen vor ihr ansingen: von Giuditta Pasta über Joan Sutherland, Leyla Gencer und Renata Scotto, Anita Cerquetti, Montserrat Caballé und eben La Divina, Maria Callas. In den ca. sieben Minuten, die die Paradearie – längst eine Ikone des italienischen Belcanto – dauert, entscheidet sich das Schicksal der Partie (bzw. ihrer Sängerin) und damit des ganzen Abends.
NeueMusikzeitung/nmz.de
Liebe in Zeiten des Hasses: So lief die „Norma“-Premiere an der Staatsoper (Bezahlartikel)
Zu den Festtagen präsentiert die Staatsoper Unter den Linden Vincenzo Bellinis „Norma“. Regisseur Vasily Barkhatov verlegt die Handlung aus der Antike in eine moderne Diktatur.
Tagesspiegel.de
Richard Wagners „Parsifal“ am 13. 4. 2025 in der Staatsoper/STUTTGART
Berührende Klangmomente
Klingsor. Foto: „Martin Sigmund“
In der zerklüfteten Inszenierung von Calixto Bieito (Bühne: Susanne Geschwender; Kostüme: Merce Paloma) liegt die Apokalypse schon hinter uns, die Brücken sind eingestürzt, die Menschen kämpfen verzweifelt ums Überleben. Eine Gemeinschaft keusch lebender Ritter zieht aus der Anbetung des Heiligen Grals Lebenskraft. König Amfortas verweigert standhaft das Ritual der Gralsenthüllung, weil sein Vollzug die Wunde aufbrechen lässt, die er erhalten hat, als er der Verführung einer Frau erlag. Alle warten nun auf die Ankunft eines Erlösers. Den stärksten Eindruck hinterlässt dabei der packend gestaltete zweite Akt, wo die Auseinandersetzung zwischen Parsifal und Kundry im Mittelpunkt steht…
Zum Bericht von Alexander Walther
BRÜNN – 13.04. 2025 – Narodni divadlo Brno: „JAKOBIN“
Copyright: Narodni divadlo Brno
Wer hinter dem grimmigen Titel „Der Jakobiner“ eine blutige Revolutionsgeschichte erwartet, der irrt! Der titelgebende „Jakobiner“ – Bohus von Harasov – war zwar in Paris gewesen und brachte von dort seine Frau Julie mit, wäre aber selbst von den Revolutionären hingerichtet worden, wie im dritten Akt enthüllt wird! Alles war nur eine Intrige von Adolf, dem Neffen des alten Grafen, der selbst statt des Grafen Sohn die Nachfolge als Schloßherr antreten wollte. Die wird aber aufgedeckt, und auch der einzige Unterstützer des bösen Adolf, der Burgvogt Philipp, zieht den Kürzeren im Werben um Terinka, die Tochter des Lehrers Benda, die mit dem von ihr verehrten Jäger Jiri vereint wird. „Stimungsvolle Dorfszenen zur Zeit der Aufklärung in Böhmen“ könnte man das Stück auch überschreiben, das von herrlichen Melodien aus der Feder von Antonin Dvorak – mein tschechischer Lieblingskomponist, nicht nur, weil er einer der ersten fanatischen Eisenbahnfans in Kontinentaleuropa gewesen ist – quasi überquillt…
Zum Bericht von Michael Tanzler
Kulturinstitutionen in Wien: Ausländische Führungskräfte sind die Chefs
„Ist Wien überflüssig?“ betitelte Georg Kreisler 1987 einen Satireband über Wiener Mentalität und so manch eigenartige hiesige Umgangsformen. Und aus dem Jahr 1964 klingt sein „Wie schön wäre Wien ohne Wiener!“ nach. Also, mit Führungskräften in Sache Kultur sind wir in solch einer Entwicklung bereits angelangt. Denn wo wir hinschauen: Gäste aus den Nachbarländern prägen die heimische Kultur und auch die Universitäten. Nun, Gäste? Die österreichische Staatsbürgerschaft wird den Chefs, Universitätsprofessoren, etc. zum führenden Posten dazu verliehen. ..
Weiterlesen unter https://onlinemerker.com/kulturinstitutionen-in-wien-auslaendische-fuehrungskraefte-sind-die-chefs/
Sprechtheater
Ödön von Horváths „Figaro lässt sich scheiden“ am Tiroler Landestheater
DerStandard.at.story
Aktuelles aus „Neue Zürcher Zeitung“
Der Irak will zur Touristendestination werden: eine Reise von Bagdad nach Basra: Bis vor kurzem galt das Land als Hölle auf Erden. Jetzt soll man dort Ferien machen können.
Jetzt lesen
Die Russen fühlen sich wie im April 1945: Sie glauben, den Sieg in Griffnähe zu haben»: Der Militärexperte Markus Reisner sagt, dass der Westen entweder die Ukraine stärker unterstützen oder den Krieg so rasch als möglich beenden sollte. Er hält wenig von den jetzigen Verhandlungen und ist überzeugt, dass die Zeit für Putin arbeitet.
Jetzt lesen
Russland richtet im Zentrum der ukrainischen Stadt Sumi ein Blutbad an – mehr als 30 Einwohner werden getötet: Der Palmsonntag hat der Ukraine eine neue Hiobsbotschaft gebracht: die opferreichste Attacke auf Zivilisten seit 2023. Russland terrorisiert mit seinem Raketenangriff die Bevölkerung und übt Druck auf die Waffenstillstandsverhandlungen aus.
Jetzt lesen
Unter grossem Druck: warum Teheran jetzt mit Trump verhandelt: Am Samstag trafen sich Vertreter Irans und Amerikas in Oman zu ersten indirekten Gesprächen. Konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht. Für Iran steht jedoch viel auf dem Spiel. Jetzt lesen
Präsident Noboa gewinnt die Wahl in Ecuador überraschend deutlich: Der 37-jährige Amtsinhaber distanziert seine linke Gegenkandidatin klar. Doch diese will das Ergebnis nicht anerkennen und fordert eine Neuauszählung der Stimmen.
Jetzt lesen
Mit einer künstlichen «Volksbewegung» versucht Vucic den Studentenprotest zu ersticken: An einer Grosskundgebung hat der serbische Präsident das Ende der «farbigen Revolution» verkündet. Die Studenten kümmert das nicht.
Jetzt lesen
Der Täter warf mit Molotowcocktails am jüdischen Pessachfest: Brandanschlag auf Gouverneur Josh Shapiro: Der Täter drang mitten in der Nacht in die Residenz des Gouverneurs von Pennsylvania ein und stiftete einen grösseren Brand, während die Familie schlief. Die Strafanzeige lautet auf versuchten Mord und Terrorismus.
Jetzt lesen
«Man spricht gern über eine Brandmauer. Aber das Entscheidende ist, den Brand zu löschen», sagt Österreichs neuer Bundeskanzler Christian Stocker: Der ÖVP-Chef Stocker führt Österreichs erste Dreierkoalition an. Er erklärt, warum er davor mit Herbert Kickl verhandelt hat, obwohl er dessen Politik ablehnt. Er ist überzeugt, dass seine Koalition erfolgreicher sein wird als die «Ampel» in Deutschland.
Jetzt lesen
Feuilleton
Rund zwanzigtausend Menschen kamen bei der Varusschlacht ums Leben: In den germanischen Wäldern erlebte das Römische Reich eine seiner schlimmsten Niederlagen Im Herbst 9 n. Chr. schlugen germanische Stämme unter Arminius drei römische Legionen vernichtend. Was genau geschah, ist bis heute unklar. Umso grösser der Mythos, der um die Schlacht entstanden ist.
Jetzt lesen
Der wahre Architekt des Kaiserreichs: Wilhelm I. war nicht der Herrscher, als der er in die Geschichte eingegangen ist: Ein schwacher König und ein Kanzler, der regiert: Das ist bis heute das Bild von Wilhelm I. und Otto von Bismarck. Der Historiker Jan Markert revidiert es grundlegend.
Jetzt lesen
Drachen, Sex und Magie: Die «Empyrean»-Reihe der US-Autorin Rebecca Yarros bricht gerade Rekorde – und verrät damit etwas Bedenkliches: Es geht um eine Kämpferin, die wegen einer chronischen Krankheit eher fürs Lazarett als fürs Schlachtfeld gemacht scheint. Ein Bucherfolg, der viel sagt über die Unterhaltungspräferenzen unserer Zeit.
Jetzt lesen
Als Jeff Bezos der «Washington Post» einen freiheitlicheren Kurs verordnete, witterten Journalisten schon das Ende der Demokratie. Sie lagen komplett daneben:Der Milliardär Jeff Bezos mischt sich bei der «Washington Post» in redaktionelle Belange ein. Die Folgen sind bis anhin positiv.
Jetzt lesen
Aufstand gegen die Wirklichkeit: Der Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist tot
Als einer der grossen Romanciers und Essayisten Lateinamerikas schrieb er gegen Gewalt und Ungerechtigkeit an. Im Jahr 1990 bewarb er sich erfolglos um das Präsidentenamt in seiner Heimat Peru. Nun ist der Jahrhundertschriftsteller im Alter von 89 Jahren gestorben.
Jetzt lesen
Zitat Ende „Neue Zürcher Zeitung“
Politik
Österreich
Kasperl der Woche: Was kümmert mich meine Meinung von gestern?
Wöchentlich küren wir an dieser Stelle den „Kasperl der Woche“. Diesmal hat sich Neo-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) dafür qualifiziert. Sie hat nämlich ihre Meinung zum Thema Postenschacher (Karl Nehammer) „vergessen“. In der „ZIB 2“ wurde Meinl-Reisinger nun nach ihrer Meinung dazu gefragt. Ihre überraschende Antwort: „Ich erlaube mir das Recht, meine Meinung in diesem Fall für mich zu behalten.“ Und hat damit doch alles gesagt. Und noch etwas: Meinl-Reisinger nennt die Arbeit der Koalition übrigens einen „guten und neuen Weg“. Oder frei interpretiert: Was kümmert mich meine Meinung von gestern?
https://www.krone.at/3755037
„Es ist, wie’s ist“: Alle sollen länger arbeiten: Neue Ansage von Ministerin
Das faktische Pensionsalter soll an das gesetzliche angehoben werden. Gelingt das nicht, könnten weitere Maßnahmen kommen, so Beate Meinl-Reisinger.
Heute.at
Wien
Die sieben spannendsten Bezirke: Wo sich die Wien-Wahl entscheidet
Neben dem Gemeinderat wird am 27. April auch in den 23 Wiener Bezirken gewählt. Dabei stechen sieben Bezirke besonders ins Auge, in denen sich die Machtverhältnisse ändern könnten – oder die politische Auffälligkeiten aufweisen.
DiePresse.com
Meidling ist ganz fest in roter Hand, da gibt es kein Fragezeichen. Die „Grünen“ müssen um ihre zwei Bezirksvorsteher bangen, Die SPÖ muss Simmering, Floridsdorf und Donaustadt gegen die Blauen verteidigen!
Haben Sie einen schönen Tag!
A.C
DIE DIENSTAG-PRESSE (15. APRIL 2025)
Für Sie in den Zeitungen gefunden: DIE DIENSTAG-PRESSE (15. APRIL 2025)
Von Klassik-Birnen und Sport-Äpfeln
Willkommen in der neuen Klassik-Woche, heute mit allerhand schiefen Vergleichen: Musik vs. Sport, Streams vs. CDs, Digital Concert Hall vs. YouTube und Karfreitag in Dortmund vs. Karfreitag in Düsseldorf.
https://backstageclassical.com/von-klassik-birnen-und-sport-aepfeln/
Peter Seiffert gestorben
Leading German tenor dies after a stroke, at 71. The family and friends have reported the death of Peter Seiffert, one of the most popular singers within his profession and one of the finest Heldentenor performers of recent years. Born in Düsseldorf, Seiffert made his debut locally at 24 at Deutsche Oper am Rhein. He became a summer fixture at Bayreuth, its regular Lohengrin, and sang all of his major roles at Bavarian State Opera, which included much Italian repertoire. He made at late Met debut in 2004 as Tannhäuser. In 1986 he married the glorious Slovak soprano Lucia Popp, fifteen years his senior. After her death from cancer seven years later, he was eventually married a second time to Petra-Maria Schnitzer (pictured), a soprano who sang opposite him at Bayreuth.
Leading German tenor dies after a stroke, at 71 – Slippedisc
Wien/Staatsoper
Das wird wunderbar: Die Wiener Staatsoper präsentiert die Spielzeit 2025/2026
Die Spielzeit 2025/2026 bringt uns Klassikbegeisterten fünf Opernpremieren, zwei Balletpremieren und eine Ballettgala. Gemeinsam mit den acht Wiederaufnahmen werden insgesamt mehr als fünfzig Opern auf die Bühne kommen. Es dürfte nicht viele Opernhäuser geben, die ihr Publikum mit einer so gewaltigen Auswahl verwöhnen.
Von Dr. Rudi Frühwirth
Klassik-begeistert.de
Wien/Staatsoper
Wenig Schmalz, viel Kapellmeisterei: Christian Thielemann führt „Arabella“ mit chirurgischer Präzision
Für die erste Vorstellung: technisch top! Dirigent Christian Thielemann beweist: 100 Prozent Kapellmeisterei. In puncto Energie bleibt viel Luft nach oben – auch wenn „Arabella“ von Richard Strauss dem Staatsopernorchester nur Smalltalk anbietet. Ein Konversationsstück mit seidenweichem Orchester-Geplätscher. Camilla Nylund und Michael Volle punkten mit enormer Präsenz, lassen aber eines vermissen: Emotion!
Von Jürgen Pathy
Klassik-begeistert.de
Christian Thielemann feiert Arabella an die Strauss-Spitze
Ein umjubeltes Gesangsensemble um Camilla Nylund und Michael Volle sowie ein umschlingender Orchesterklang bringt das Haus am Ring in schwungvolle Walzer-Stimmung. Thielemanns umjubelter Strauss-Zauber wirkt auch mit Arabella, zurecht war selbst die Wiener Staatsoper völlig aus dem Häuschen!
Von Johannes Fischer
Klassik-begeistert.de
Wien
Richard Strauss‘ „Arabella“ mit grandiosem Thielemann
Bei der Wiederaufnahme an der Wiener Staatsoper fesselten speziell Michael Volle und Christian Thielemann mit herausragenden kunsthandwerklichen Leistungen
DerStandard.at.story
Das Wiener Opernhighlight: „Arabella“ unter Thielemann (Bezahlartikel)
Selbst die charmefreie Bechtolf-Inszenierung kann die musikalische Atmosphäre nicht zerstören: In der „Arabella“-Wiederaufnahme mit Camilla Nylund herrscht Hofmannsthals Geist dank der Klänge von Richard Strauss.
DiePresse.com
Wiener Staatsoper: Keine Zweifel und keine Fragen bei „Arabella“ (Bezahlartikel)
Glanzbesetzung bei der Wiederaufnahme u. a. mit Camilla Nylund und Michael Volle – und mit Christian Thielemann am Pult.
Kurier.at
Berlin/ Deutsche Oper
Gesangswettbewerb auf der Wartburg: 10 Punkte gehen an Klaus Florian Vogt als Tannhäuser
“Zu viel, zu viel” sind die ersten Worte, die Tannhäuser singt. Am Schluss der Oper möchte man als Zuschauer antworten: “Noch mehr, noch mehr”! Von solch einer großartigen musikalischen Aufführung kann man eigentlich nicht genug bekommen. An der Deutschen Oper Berlin triumphiert Klaus Florian Vogt im Sängerwettstreit als Tannhäuser in einer musikalisch hochklassigen Aufführung, zu deren Erfolg auch Elisabeth Teige und Samuel Hasselhorn sowie der Dirigent John Fiore beitragen.
Von Jean-Nico Schambourg
Klassik-begeistert.de
Salzburg/Osterfestspiele
Salzburger Osterfestspiele mit „Chowanschtschina“ als Politthriller
Mussorgskis unvollendete Oper wird in Salzburg im Großen Festspielhaus zum etwas trägen und rätselhaften Musiktheater geformt. Dennoch Applaus Es kommt nicht von ungefähr, dass im Menschengewusel auf der Bühne ein Mann krumme Hörner auf dem Kopf trägt. Mit seinem archaischen Kopfschmuck erinnert er frappant an den sogenannten QAnon-Schamanen – jene skurrile Figur, die nach Donald Trumps Wahlschlappe im Jahr 2021 am Sturm auf das Kapitol beteiligt war. Dieser Schamane macht sich hier nicht schlecht, steht er doch in den Diensten eines gewissen Fürsten Iwan Chowanski: Der greift mit grober Hand und populistischen Worten in Moskau anno 1682 nach der Macht, will Russland „wieder groß“ machen, wie es auf der Übertitel-Anzeige beziehungsreich heißt, und schmiedet zu diesem Zweck ein Bündnis mit der wertkonservativen Gruppe der „Altgläubigen“.
DerStandard.at.
„Chowanschtschina“ – Mussorgskis Volksoper bei den Osterfestspielen Salzburg
Podcast von Jörn Florian Fuchs (6,30 Minuten)
deutschlandfunk.de.podcast
Wien/Volksoper
„Follies“ in der Volksoper: Wenn Musical, dann so!
Die österreichische Erstaufführung von Stephen Sondheims „Follies“ gelingt furios dank des starken Ensembles und fetziger Tanznummern.
DiePresse.com
CD-Besprechung
Mixturtrautonium und Stimme: Zwischen Geräusch und Sphäre liegt Genuss
Die Gelegenheit ist günstig: die Musik der CD „Ins Nichts mit ihm“ erklingt live am 25. April 2025 in den Kammerspielen in München. Das Mixturtrautonium ist ein elektronisches Instrument, das in Deutschland ab den späten 1920ern entwickelt wurde. Der CD Begleittext zeigt, wie physikalisch Tonerzeugung ist. Es heißt darin: „Das Trautonium war ursprünglich ein monophones Instrument und das erste, welches in der Lage war, Klänge zu erzeugen, indem es die hochfrequenten Kipp-Schwingungen zur Frequenzmodulation nutzt (die Basis des Synthesizers, welcher dann von La Cain, Buchla, Moog u.a. entwickelt wurde). […]. Eine Besonderheit des Mixturtrautoniums sind die Frequenzteiler, die es ermöglichen, mit Hilfe der subharmonischen Frequenzreihe aus einem Grundton Akkorde zu erzeugen, die der Naturtonreihe und nicht dem wohltemperierten Spektrum angehören. Diese können in einer Matrix abgespeichert und den einzelnen angespielten Tönen zugeordnet werden.“
Von Frank Heublein
Klassik.begeistert.de
Wien/Musikverein
Mozart Hauptgang, Kurtág Nachspeise (Bezahlartikel)
Große Messe und Nach(t)klänge im Musikverein: Mozart bekam Exzellenz, braucht aber noch mehr. Kurtág brauchte Stille – und bekam sie.
https://www.diepresse.com/19528851/mozart-hauptgang-kurtag-nachspeise
Salzburg
Das Oster-Duell: Salzburg oder Baden-Baden?
Die Berliner Philharmoniker sind zu Ostern zum letzten Mal in Baden-Baden, wo sie Puccinis Madame Butterfly aufführen. Nächstes Jahr ziehen sie weiter nach Salzburg, wo sie bei Nikolaus Bachler Wagners Ring beginnen werden – dieses Jahr setzten hier noch Esa-Pekka Salonen und das Finnische Radioorchester die Oper Chowanschtschina in Szene. Eine Feuilletonrundschau. Salzburg darf sich auf die Berliner Philharmoniker freuen, die auch eine szenisch schlüssige Butterfly in Baden-Baden ablieferten, findet Judith von Sternburg in der FR:: »Regisseur David Livermore baut eine zusätzliche Ebene ein, nicht neu, aber plausibel.
https://backstageclassical.com/das-oster-duell-salzburg-oder-baden-baden/
Mahler unter Salonen: Auferstehung mit dem himmlischen BR-Chor (Bezahlartikel)
Zuerst drängend, dann in hymnischer Breite: Jubel für Esa-Pekka Salonen, das Finnische Radio-Symphonieorchester und den famosen Chor des Bayerischen Rundfunks bei den Osterfestspielen Salzburg.
DiePresse.com
Osterfestspiele Salzburg: Sachlichkeit zügelt die Leidenschaft (Bezahlartikel)
Esa-Pekka Salonen und das Finnish Radio Symphony Orchestra präsentierten in Salzburg Mahlers Zweite.
SalzburgerNachrichten.at
Wenig Begeisterung fürs ewige Leben
Osterfestspiele / Chorkonzert I
Eine Weile, bevor der himmlische Chor einsetzt, ringen noch bedrohliche Töne des Dies Irae und volkstümliche Melodien um die verstorbene Seele. Gerade an diesem spannenden Punkt im Schluss-Satz von Mahlers Auferstehungs-Symphonie griff die Dame in der Reihe vor mir zum Handy.
DrehpunktKultur.at
Berlin
Augen zu und nur zuhören: „Norma“ in der Staatsoper Berlin (Podcast)
inforadio.de.podcast
Ein wahres Belcanto-Fest – „Norma“ an der Berliner Staatsoper (Bezahlartikel)
Die Cavatine „Casta Diva“ ist die Vorzeigearie aus der Oper Norma, eine Visitenkarte sängerischer Kunst. Jedes Mal, wenn eine Sängerin es wagt, sich Bellinis „Norma“ und damit der Herausforderung des „Casta Diva“ zu stellen, muss sie gegen die Schatten aller Norma-Interpretinnen vor ihr ansingen: von Giuditta Pasta über Joan Sutherland, Leyla Gencer und Renata Scotto, Anita Cerquetti, Montserrat Caballé und eben La Divina, Maria Callas. In den ca. sieben Minuten, die die Paradearie – längst eine Ikone des italienischen Belcanto – dauert, entscheidet sich das Schicksal der Partie (bzw. ihrer Sängerin) und damit des ganzen Abends.
NeueMusikzeitung/nmz.de
Liebe in Zeiten des Hasses: So lief die „Norma“-Premiere an der Staatsoper (Bezahlartikel)
Zu den Festtagen präsentiert die Staatsoper Unter den Linden Vincenzo Bellinis „Norma“. Regisseur Vasily Barkhatov verlegt die Handlung aus der Antike in eine moderne Diktatur.
Tagesspiegel.de
Baden-Baden
„Butterfly“ in Baden-Baden: Ein Ostergeschenk zum Abschied (Bezahlartikel)
Letztmals spielt dieses Orchester bei den Osterfestspielen Baden-Baden, und die Aufführung gerät zum Triumph: Puccinis Oper „Madama Butterfly“ mit den Berliner Philharmonikern.
FrankfurterAllgemeine.net
Vergangenheitsbewältigung deluxe
Giacomo Puccini: Madama Butterfly. Der Eröffnungsabend der Osterfestspiele Baden-Baden ist mit Puccinis „Madama Butterfly“ theatralisch und musikalisch meisterhaft. Davide Livermores Inszenierung ist klug und hat Platz für große Emotionen.
https://www.die-deutsche-buehne.de/kritiken/vergangenheitsbewaeltigung-deluxe/
Puccinis „Madama Butterfly“ bei den Osterfestspielen in Baden-Baden: „Augen zu und Ohren auf“
Die Hauptrolle in Vincenzo Bellinis Oper „Norma“ gilt als eine der schwierigsten Opernpartien überhaupt. In der Berliner Staatsoper gab Sopranistin Rachel Willis-Sørensen ein perfektes Debut in der Rolle. Von Barbara Wiegand
swr.de.Kultur
„Madama Butterfly“
Die Kirschblüte – Ein Abschiedstopos?
https://www.concerti.de/oper/opern-kritiken/baden-baden-madama-butterfly-12-4-2025/
München
Teodor Currentzis in München: Denkwürdiges Konzert in der Isarphilharmonie
BR.Klassik.de
Meiningen
Drogenabenteuer ohne Liebestod: „Tristan und Isolde“ in Meiningen (Bezahlartikel)
Eine Produktion von „Tristan und Isolde“ mit dieser hohen musikalischen Qualität und einer Besetzung nur aus dem eigenen Ensemble ist ein durchschlagskräftiger Leistungsbeweis. Verena Stoiber präsentierte ihre zweite Meininger Inszenierung nach „Salome“. GMD Killian Farrell und die Meininger Hofkapelle zelebrierten Richard Wagners Extremwerk mit packenden Kontrasten von ‚Realität‘ und Rausch, bis Stoibers Regie schwächelte. Marco Jentzsch ist ein eher leichter und beglückend intelligenter Tristan, Lena Kutzner eine klarstimmig imposante Isolde.
NeueMusikzeitung/nmz.de
Delirium aus der Pipette
Ein bemerkenswert junges Ensemble erklimmt in „Tristan und Isolde“ den Mount Everest des Wagner-Gesangs gemeinsam mit GMD Killian Farrell, der eine hohe Sensitivität im Rausch beweist. Die Regie von Verena Stoiber allerdings enttäuscht.
concerti.de.oper
Frankfurt
»Der Rosenkavalier«: Ein Blick auf die Wiederaufnahme an der Oper Frankfurt
Von der menschlichen Endlichkeit handelt Aribert Reimanns Trilogie lyrique L’invisible, die kürzlich an der Oper Frankfurt Premiere feierte. Die 2. Wiederaufnahme von Richard Strauß´ populärer Komödie für Musik Der Rosenkavalier knüpft daran unmittelbar an. Denn in der Inszenierung von Claus Guth (Mai 15) liegt der Schwerpunkt auf der Vergänglichkeit unseres Daseins.
Kulturfreak.de
Düsseldorf
Fantastische Welt
Offenbach: Hoffmanns Erzählungen
Die Deutsche Buehne.de
Köln
„Leuchtende Liebe, lachender Tod“ –
Neuer Blick auf iWagners „Siegfried“ in der Kölner Philharmonie
opernmagazin.de
Münster
Roterfadenlos inszeniert – Leoš Janáčeks „Das schlaue Füchslein“ am Theater Münster
Alles hängt mit allem zusammen. Und alles befindet sich, wenn es ideal läuft, miteinander im Gleichgewicht. Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung sondern „nur“ ein Teil von ihr, ein kleines Rad im Gefüge der Natur, ein Lebewesen, das ebenso entsteht und vergeht wie ein Pilz im Wald oder eine Henne im Stall. Dieser pantheistischen Haltung folgt Leoš Janáček ganz besonders in seiner Oper „Das schlaue Füchslein“, uraufgeführt im Jahr 1924, jetzt von Regisseurin Magdalena Fuchsberger im Theater Münster herausgebracht. Zu hören ist ein musikalisches Meisterwerk, das an Kraft, Sinnlichkeit und Emotionalität auch nach einhundert Jahren nichts eingebüßt hat.
NeueMusikzeitung/nmz.de
Basel
Theater Basel: Liederabend Mané Galoyan – ein musikalisches Portrait
opernmagazin.de
Links zu englischsprachigen Artikeln
Budapest
Witnessing music making at its best: OAE’s Bach St Matthew Passion in Budapest
seenandheard.international.com
London
Variations, Ólafsson, Wigmore Hall review – Bach in the shadow of Beethoven
Late changes, and new dramas, from the Icelandic superstar
TheArts.desk.com
Cardiff
Searingly powerful Peter Grimes from Welsh National Opera
https://operatoday.com/2025/04/searingly-powerful-peter-grimes-from-welsh-national-opera/
New York
Choral Society, soloists deliver a worthy Verdi Requiem at Carnegie
NewYork.classical.com
Miami
FGO’s lurid “Carmen” more show biz than Bizet
southflorida.classical.com
San Francisco
Marin Alsop and the San Francisco Symphony bring energy to powerful music of the Americas
seenandheard.international.com
Recordings
Pygmalion’s Bach: Mass in B Minor — vivid and deeply felt
Raphaël Pichon and his early music group deliver a hyper-emotional performance of this Baroque masterpiece
https://www.ft.com/content/b320d0b4-9354-4304-b8d0-57cb33bb991b
Schubert: Licht und Schatten (Samuel Hasselhorn, Ammiel Bushakevitz) Hasselhorn cements his place in the new guard with Schubert 2000 project.
limelight.arts.com
Ballett / Tanz
Tanztheater Wuppertal: Sakrosankte Kapitalismus-Dystopie Die einmal mehr umjubelte Brecht-/Weill-Kompilation gerät zu einem alterslosen Beitrag für hedonistische Emanzipationsutopie: Pina Bausch war ihrer Zeit weit voraus, was ihre Kreation aus dem Jahr 1976 grandios beweist.
Concerti.de
Nijinsky (The Australian Ballet)
John Neumeier’s Nijinsky is a ballet that with each viewing and hearing shows something new and precious.
https://limelight-arts.com.au/reviews/nijinsky-the-australian-ballet/
Sprechtheater
Ödön von Horváths „Figaro lässt sich scheiden“ am Tiroler Landestheater
DerStandard.at.story
Politik
Österreich
Kasperl der Woche: Was kümmert mich meine Meinung von gestern?
Wöchentlich küren wir an dieser Stelle den „Kasperl der Woche“. Diesmal hat sich Neo-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) dafür qualifiziert. Sie hat nämlich ihre Meinung zum Thema Postenschacher (Karl Nehammer) „vergessen“. In der „ZIB 2“ wurde Meinl-Reisinger nun nach ihrer Meinung dazu gefragt. Ihre überraschende Antwort: „Ich erlaube mir das Recht, meine Meinung in diesem Fall für mich zu behalten.“ Und hat damit doch alles gesagt. Und noch etwas: Meinl-Reisinger nennt die Arbeit der Koalition übrigens einen „guten und neuen Weg“. Oder frei interpretiert: Was kümmert mich meine Meinung von gestern?
https://www.krone.at/3755037
„Es ist, wie’s ist“: Alle sollen länger arbeiten: Neue Ansage von Ministerin
Das faktische Pensionsalter soll an das gesetzliche angehoben werden. Gelingt das nicht, könnten weitere Maßnahmen kommen, so Beate Meinl-Reisinger.
Heute.at
Wien
Die sieben spannendsten Bezirke: Wo sich die Wien-Wahl entscheidet
Neben dem Gemeinderat wird am 27. April auch in den 23 Wiener Bezirken gewählt. Dabei stechen sieben Bezirke besonders ins Auge, in denen sich die Machtverhältnisse ändern könnten – oder die politische Auffälligkeiten aufweisen.
DiePresse.com
———————
Unter’m Strich
Österreich
Tschick, Urlaube, Reinigung: So verprasste Strache FPÖ-Geld
In die Spesenaffäre um HC Strache kommt Bewegung hinein. Es geht um mehr als 1 Million Euro, die HC Strache veruntreut haben soll. In einem Behördendokument dröseln die Ermittler nun die exakte Schadensumme auf. Insgesamt soll sich diese auf 1.065.803,64 Euro belaufen. In der Tabelle heißt es etwa:
3225,18 Euro für „Zigaretten und Süßigkeiten
90.225,64 Euro für „Urlaube“
198.413,36 Euro für „Reinigungskraft“
9.564,00 Euro für „Überwachung“ (Straches Ex-Frau wurde offenbar observiert)
Andere Posten sind: Umbau einer Wohnung, Gehalt eines Kindermädchens, Mietzahlungen, Taxifahrten, Friseur und Kleidung. Sogar Strafen für Falschparken (!) soll Strache an die Partei verrechnet haben. Seine mittlerweile von ihm geschiedene Ex-Frau Philippa ließ er mutmaßlich auf Parteikosten ausspionieren und observieren.
oe24.at
MARIGONA QERKEZI: „Ich liebe es einfach zu singen“
MARIGONA QERKEZI: „Ich liebe es einfach zu singen“
Am 8. November 2024 gibt die Sopranistin Marigona Qerkezi ein wichtiges Hausdebüt an der Oper am Rhein in Düsseldorf. Es handelt sich bei ihr um eine wirklich wunderbare junge aufstrebende dramatische Koloratursopranistin, Verdi- und Puccinisängerin. In Düsseldorf singt sie Abigaille, sie hat aber auch Aida im Repertoire, wird bald als Manon Lescaut und Tosca debütieren. Hier ein Video ihrer Lucrezia Contarini in „I due Foscari“.
: https://youtu.be/CfIpIz4ir-s?feature=shared
Die junge Sopranistin im Gespräch über Norma, Abigaille, ihren Repertoirewechsel und anstehende Vorstellungen an der Deutschen Oper am Rhein, der Oper Frankfurt und der Oper von Lüttich.

Marigona Qerkezi. Copyright: Mario Amaral
Wie begann Ihr Weg, Opernsängerin zu werden? Wo haben Sie studiert und was können Sie uns über die Anfänge Ihrer Karriere erzählen?
Als Tochter einer Mezzosopranistin und eines Kostümbildners, die beide in der Oper tätig waren, war ich schon immer von Musik und Kunst umgeben, insbesondere von Oper. Ich habe das Glück, dass meine Mutter, Merita Juniku, immer noch meine Gesangslehrerin ist und mit mir all meine Rollen vorbereitet. Neben meinem Gesangsstudium habe ich auch Flöte studiert, bin häufig als Solistin aufgetreten und habe einen Abschluss in Betriebswirtschaft gemacht. All diese Erfahrungen haben meine Ausbildung sehr bereichert und meinen Horizont erweitert. Mein erstes Konzert gab ich bereits im Alter von sechs Jahren als Kindersopran!
Sie haben als lyrische Koloratursopranistin angefangen, oder?
Ich begann meine Karriere als junge, dramatische Koloratursopranistin und hatte mein Operndebüt als Königin der Nacht am Royal Opera House in Muscat. Bald darauf folgten Rollen wie Contessa d’Almaviva in Le Nozze di Figaro, Lucia di Lammermoor, Rosalinde in Die Fledermaus, Donna Anna in Don Giovanni, Gilda in Rigoletto, Adina im Liebestrank oder Mathilde in Guglielmo Tell.
Wie war Ihr Werdegang von Rollen wie Königin der Nacht, Lucia und Gilda zu Abigaille und Lady Macbeth? Wie kam es zu diesem Repertoirewechsel?
Ich hatte eigentlich schon immer eine sehr flexible Stimme. Im Laufe der Jahre hat mich meine natürliche stimmliche und künstlerische Entwicklung dazu gebracht, ein breiteres Rollenspektrum zu übernehmen. Ich singe alles mit meiner wirklichen Stimme, etwa ohne die Stimme künstlich abzudunkeln und respektiere dabei immer den Stil und die Absichten des Komponisten. Wenn ich zum ersten Mal in eine neue Partitur eintauche, muss es sein, als ob eine Art Funken entfacht wird. Ich muss aufgeregt sein und mich gleichzeitig geerdet fühlen. Das signalisiert mir dann, dass dies ein Charakter ist, der weiter erforscht und ausgebaut werden muss.
Sie haben mehrere wichtige Wettbewerbe in Italien gewonnen, darunter ASLICO, den Magda Olivero-Wettbewerb, den ersten Preis beim Leyla Gencer-Wettbewerb und einen Sonderpreis der Accademia der Mailänder Scala. Welche Bedeutung hatte Italien für Ihre Karriere?
Ich liebe es einfach zu singen und nehme Herausforderungen gerne an. Diese Kombination hat mich dazu gebracht, an all diesen Wettbewerben und Vorsingen teilzunehmen, was mir wiederum viele Türen geöffnet und unzählige Möglichkeiten geschaffen hat. Es ist ein wahrer Segen für mich, dass meine Reise als Opernsängerin in Italien begann – der Heimat der Oper. Mein erster internationaler Preis beim „Aslico“-Wettbewerb war ein entscheidender Moment, dem dann weitere Wettbewerbe und Meilensteine folgten. Ich habe eine besondere Verbindung zu Italien, einem Land, das sich für mich wie eine zweite Heimat anfühlt und mir enorme Freude und Erfüllung bereitet hat und bereitet.
Demnächst werden Sie Ihr Debüt an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf als Abigaille in Nabucco geben, die Sie bereits zweimal zuvor gesungen haben: Welche Herausforderungen bringt diese Rolle mit sich, die von vielen als „Killerrolle“ angesehen wird?
Meine erste Produktion von „Nabucco“ und mein Rollendebüt als Abigaille habe ich beim Savonlinna Opera Festival gesungen. Dem folgte eine weitere Produktion am Theatro Municipal de São Paulo und nun freue ich mich wirklich sehr, meine Abigaille an der Deutschen Oper am Rhein vorstellen zu dürfen und hier in Düsseldorf mein Hausdebüt zu geben. Ich habe die Abigaille also schon mehrmals gesungen und empfinde sie keineswegs als eine „Killerrolle“. Es kommt ganz darauf an, wie man diese Partie angeht. Wenn man drückt und ungesund singt, kann sie gefährlich sein. Ich singe die Rolle wie eine dramatische Belcantopartie. Verdi hat so viele „Piani“ und „Pianissimi“ für die Abigaille geschrieben, und es handelt sich bei der Rolle um eine Partie für einen dramatischen Koloratursopran. Abigaille ist eine sehr komplexe Rolle, sowohl stimmlich als auch psychologisch. Es ist eine Mischung aus dramatischem explosivem Feuerwerk und lyrisch-emotionalen Momenten. Und auch dies macht sie zu einer der anspruchsvollsten Rollen überhaupt für Sopran.
Sie haben mehrere andere Verdi-Rollen gesungen: welche genau?
Mit der Erweiterung meines Repertoires habe ich neben der Abigaille Leonora in Il Trovatore, Violetta in La Traviata, Giovanna d’Arco, Elvira in Ernani, Lucrezia Contarini in I due Foscari, Aida und die Sopranpartie in Messa da Requiem gesungen. Als nächstes kommen Lady Macbeth und Lina in Stiffelio!
Puccini ist in Ihrem Repertoire hingegen nicht sehr präsent. Laut Ihrer Biografie haben Sie Mimì in „La Bohème“ gesungen, und Manon Lescaut wird in naher Zukunft auf Sie zukommen. War das eine bewusste Entscheidung, auf allzu viele Puccini-Rollen zu verzichten?
Meine erste Begegnung mit einer Puccini-Rolle war mein Debüt als Mimì, und jetzt bin ich absolut dazu entschlossen, diese Reise fortzusetzen! Ich werde als Manon Lescaut am Teatro Petruzzelli in Bari und als Tosca an der Königlichen Dänischen Oper in Kopenhagen debütieren, und ich könnte nicht aufgeregter darüber sein!
Auch viele Belcanto-Heroinen haben Sie bereits gesungen, Rossini, Bellini und Donizetti. Im Laufe dieser Saison werden Sie an der Oper Frankfurt in einer Partie debütieren, die oft als der „Mount Everest der Sopranrollen“ bezeichnet wird, der Norma, die Sie bereits in Palm Beach gesungen haben. Was macht diese Rolle so besonders und, wenn man so will, fast „gefürchtet“? Wie gehen Sie die Norma an?
Die Norma vereint wirklich außergewöhnliche stimmliche, emotionale und technische Anforderungen an die Sängerin dieser wunderbaren Rolle. Man muss die tiefen inneren Konflikte der Figur und ihre starke, aber gleichzeitig zerbrechliche Natur möglichst glaubhaft vermitteln. Ich bin schon dabei, die Rolle vorzubereiten und konzentriere mich hierbei ganz auf ihr Inneres, versuche, die Motivation für ihr Handeln möglichst gut zu verstehen und nachzuvollziehen, ihre Verletzlichkeit, ihren inneren Konflikt zwischen Liebe und Pflichten als Oberpriesterin. Norma ist solch eine vielschichtiger Charakter, und die Musik Bellinis ist von ätherischer Schönheit. Ich freue mich sehr, die Rolle kommendes Jahr an der Oper Frankfurt zu singen!
Zeitgenössische Musik ist unter Ihren kommenden Engagements ebenfalls zu finden. Sie werden etwa bei der Uraufführung von Andrea Battistonis „Pucciniana“ in Lüttich dabei sein.
Ich freue mich sehr, dass mir die Weltpremiere von Andrea Battistonis „Pucciniana“ an der Opéra Royal de Wallonie-Liège anvertraut wurde. Das Ganze wird am 29. November 2024 unter der musikalischen Leitung von Maestro Giampaolo Bisanti anlässlich des 100. Todestages von Giacomo Puccini stattfinden. Es handelt sich um eine Kantate, die Elemente aus Puccinis Opern wie La Bohème und Madama Butterfly verbindet, sowie aus einer unvollendeten Oper über Marie-Antoinette. Es ist also keine „zeitgenössische Musik“ im klassischen Sinne. Im zweiten Teil dieser Puccini-Gala werde ich Szenen aus Madama Butterfly und Turandot singen, und es ist mir eine große Ehre, bei dieser Hommage dabei zu sein.
Das Interview führte Isolde Cupak im November 2024
29. SEPTEMBER 2024 – Sonntag
Bayerische Staatsoper
Bayerische Staatsoper. Saisonstart und Verleihung der OPERA AWARD
Mit einem Oper für alle-Konzert in Oberammergau und dem UniCredit Septemberfest eröffnete die Bayerische Staatsoper vergangenes Wochenende feierlich die neue Spielzeit. In den kommenden Wochen stehen Giacomo Puccinis Tosca, Erich Wolfgang Korngolds Die tote Stadt sowie die Ballette Onegin und Le Parc auf dem Programm.
Außerdem sollten Sie sich zwei weitere Termine im Kalender anstreichen: Nachdem die Bayerische Staatsoper vergangenes Jahr von den International Opera Awards zur „Opera Company of the Year“ gekürt wurde, findet die diesjährige Preisverleihung in München statt. Seien Sie dabei, wenn am Mittwoch, 2. Oktober 2024, die Gewinnerinnen und Gewinne gekürt werden. Und es gibt noch etwas zu feiern: Die Bayerische Staatsoper wurde bei der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift Opernwelt mehrfach ausgezeichnet.
Das Bayerische Staatsorchester ist erneut Orchester des Jahres
Wiener Staatsoper: Skandal um Verdis „Don Carlo“!
https://www.krone.at/3541106
„Don Carlo“ an der Wiener Staatsoper: Kleider machen Leute (Bezahlartikel)
Fridays for Future und historische Kostüme, Konsumkritik und Laboratmosphäre: Kirill Serebrennikov packt vieles in seine Inszenierung von Giuseppe Verdis Oper – und scheitert. Das Premierenpublikum ließ seinem Unmut über den Regisseur am Donnerstag freien Lauf.
https://www.sn.at/kultur/musik/don-carlo-wiener-staatsoper-kleider-leute-165753928
Mit dieser missglückten Produktion will ich mich gar nicht mehr auseinandersetzen. Mich beruhigt, dass das Wiener Opernpublikum diesmal klar „Kante gezeigt hat“. Die Publikumsreaktion war also nicht das übliche Geplänkel zwischen Buh und Bravo, sie war aussagekräftiger als sonst. Leider wird der Regiekünstler seine nächsten Wiener Verträge bereits in der Tasche haben, die Vorlaufzeiten betragen ja drei Jahre – und mehr ! Nach derzeitigem Stand soll er in Salzburg bei den Osterfestspielen den „Ring“ inszenieren!
Leser Matthias Rademacher macht uns „Don Carlo“ heute im Arte-Stream“ aufmerksam:
Hallo Online Merker, obwohl sich diesmal tatsächlich alle einig zu sein scheinen, dass die Serebrennikov-Inszenierung an der Wiener Staatsoper nichts taugt, weisen Sie doch bitte trotzdem auf den Stream HEUTE Abend auf Arte Concert hin: https://www.arte.tv/de/videos/120902-001-A/giuseppe-verdi-don-carlo/
Dem mündigen Opernfan ist zuzumuten, das selbst zu überprüfen. Außerdem haben wir die Option, den Bildschirm abzuschalten und nur die Tonspur mitzuverfolgen. (Zitat Ende)
Mehr noch: „Erlebnis Bühne“ auf ORF III zeigt Don Carlo heute um 20,18 h zeitversetzt!
Wien/ Kammeroper: Monteverdis Madrigale mit Maschinenpistolen (Bezahlartikel)
Viel Wildheit, wenig Genauigkeit: Monteverdis „Il combattimento di Tancredi e Clorinda“ an der Kammeroper wirkte ungeschliffen, war aber auch unterhaltsam. Das Sängerensemble steigerte sich im Verlauf des Abends.
https://www.diepresse.com/18909260/monteverdis-madrigale-mit-maschinenpistolen
MAILAND: DER ROSENKAVALIER (Kupfer-Inszenierung; Kirill Petrenko; Stoyanova, Lindsey, Devieilhe, Baumgartner, Groissböck, Kränzle, Pretti u.a. 12. – 29.Oktober
Die Besetzung der Produktion umfasst renommierte Sängerinnen und Sänger wie Krassimira Stoyanova, Günther Groissböck, Kate Lindsey, Sabine Devieilhe, Tanja Ariane Baumgartner und Piero Pretti als italienischen Tenor. Diese herausragenden Künstler werden mit ihren beeindruckenden Stimmen und ihrem dramatischen Talent das Publikum in ihren Bann ziehen und die facettenreichen Charaktere der Oper zum Leben erwecken.
Kirill Petrenko, der als erfahrener Operndirigent gilt, wird mit seinem feinfühligen und nuancierten Dirigat die musikalische Schönheit von Strauss‘ Partitur hervorheben. Mit seiner Leidenschaft und seinem tiefen Verständnis für das Werk wird er eine herausragende Aufführung von „Der Rosenkavalier“ an der Mailänder Scala schaffen.
ZU INSTAGRAM mit mehreren Fotos, Videos
ZU INSTAGRAM mit mehreren Fotos
ISTANBUL: 10. Leyla Gencer-Gesangswettbewerb – Finale am 27. September 2024
Die Gewinner der ersten drei Preise- Foto: Klaus Billand
Fernanda Allande (Sopran, Mexiko) gewann den Sonderpreis des Jette Parker Young Artists Programme des Royal Opera House, der eine einwöchige Coaching-Sitzung im Covent Garden beinhaltet. HuanHong Li (Bass, China) gewann den Sonderpreis der Deutschen Oper Berlin, der die Teilnahme an einer der Produktionen der Oper ermöglicht, sowie den Sonderpreis des Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, der ein Auftreten mit dem Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra ermöglicht. Der Gewinner des Sonderpreises der Accademia Teatro alla Scala, Nazlıcan Karakaş, erhielt ein dreimonatiges Stipendium an der Accademia Teatro alla Scala. Karakaş wurde außerdem mit dem Leyla Gencer-Publikumspreis ausgezeichnet. Anna Imedashvili (Sopran, Georgien) gewann den Sonderpreis des Staatstheaters für Oper und Ballett in Tiflis, der der Gewinnerin die Teilnahme an einer der Opernproduktionen ermöglicht. Jennifer Mariel Velasco (Sopran, Mexiko) wurde der Sonderpreis (Überraschungspreis) des Teatro di San Carlo di Napoli verliehen.
Der chinesische Bass-Sänger dürfte seiner Hose nach zu schließen aus einer Hochwassergegend kommen!
Spaß beiseite: Schon wieder ein Gesangswettbewerb! Wie soll „der Markt“ diese hoffnungsfrohen Künstler alle aufnehmen? Das Argument, nach dem dadurch immer bessere Qualität nachkommt und das Opernpublikum der eigentliche Sieger ist, klingt zynisch und sogar menschenverachtend. Sind Opernsänger „Wegwerfprodukte, die nach kurzem Gebrauch entsorgt werden, weil immer wieder nachgeschoben wird ?“
Zum Bericht von Klaus Billand
HERBSTTAGE BLINDENMARKT/NÖ
ein wahres Feuerwerk an zündenden Pointen verspricht die Matinee im Rahmen der diesjährigen Herbsttage Blindenmarkt am 13. Oktober 2024. Robert Kolar und Alexander Kuchinka wollen dabei ihre Begeisterung für Klassiker des österreichischen Humors mit dem Publikum teilen und servieren mit viel Schwung und Leidenschaft Doppelconférencen, Kabarett-Chansons, Kleinkunst-Soli und Satirisches unter anderem von Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Maxi Böhm, Hugo Wiener sowie Ephraim Kishon, der heuer seinen 100 Geburtstag begangen hätte.
——————————–
Mittwoch, beging die österreichische Schauspielerin und Werbeikone Dany Sigel ihren 85. Geburtstag. Bei den Herbsttagen Blindenmarkt ist sie spontan für Gabriele Schuchter eingesprungen und übernimmt in der Operette „Maske in Blau“ (Premiere: 4. Oktober 2024) gleich zwei Rollen. Aufgrund der Schlussproben hat sie alle Feierlichkeiten zu ihrem Geburtstag abgesagt, auch die privaten Familienfeiern – dafür sei ja „jetzt wirklich keine Zeit“, so Sigel, „denn die Bühne war und ist mein Leben …“.
Stefano Bernardin, Dany Sigel, Michael Garschall. Foto: Lukas Beck
Also feierte Sigel nach der Bühnenorchesterprobe ihren runden Geburtstag und stieß auf der Bühne mit allen Kolleginnen und Kollegen an, unter anderem mit Elisabeth Engstler, Stefano Bernardin, Regisseurin Isabella Gregor, Intendant Michael Garschall, Maestro Kurt Dlouhy u.v.a. Dabei wurde ihr auch eine Geburtstagstorte übergeben, begleitet von den Worten des Intendanten Michael Garschall: „Unsere Dany, rüstig wie eh und je!“
HEUTE: OBERDÜRNBACH/ NÖ: SEENADENKONZERT: GOTTFRIED VON EINEM-SERENADE
Initiator: Gottfried von Einem und Lotte Ingrisch-Gesellschaft. Präsident: Dr. Manfred A. Schmid
WIEN / Schloss Neugebäude: DER SIMMERRING
27. September 2024 (Uraufführung 25, September 2024)
Copyright: MusikTheaterTageWien / Ronja Eline Kappl
…Der Simmerring, angekündigt als „eine musiktheatrale Suche nach Inspiration im ungeliebtesten Schloss Wiens“, erweist sich tatsächlich als eine unterhaltsame Oper. Der Aufführungsort, ein riesiger (Ritter-?)Saal im Rohzustand, ist so passend, dass man der Behauptung „ungeliebtest“ gerne widersprechen möchte. Ebenso nicht ganz ernst zu nehmen ist die Behauptung, dass diese Oper „den künstlerischen Prozess und dessen Irrwege selbst inszeniert und komponiert“. Für die „szenische Komposition“ verantwortlich ist vielmehr der vielseitige Komponist, Performer und Improvisator Alexander Chernyshkov, dessen Werke u.a. an der Staatsoper Hamburg, dem Stanislavsky Elektrotheatre in Moskau, in den Musiktheatertagen Wien, Wien Modern, beim Steirischen Herbst in Graz und beim Maggio Fiorentino in Florenz aufgeführt wurden.
Zum Bericht von Manfred A. Schmid
Paris: „LE DOMINO NOIR“ von Auber an der Opéra Comique – 26 9 2024
Funkelnder Anfang der neuen Spielzeit in Paris: eine Komödie, so spritzig wie die „Fledermaus“, perfekt szenisch, musikalisch, sängerisch und tänzerisch umgesetzt.
Zwei Nonnen auf einem Maskenball: Brigitte de San Lucar (Victoire Bunel) und Angèle de Olivarès mit einem domino noir (Anne-Catherine Gillet), umgarnt durch den aufgedrehten Comte Juliano (Léo Vermot-Desroches). © Stefan Brion
Ein neuer Spielzeit-Anfang in Paris und es gibt sehr viel zu berichten! Die jetzige Spielzeit fing in derselben Woche gleichzeitig an den drei Pariser Opernhäusern an. Wir beginnen mit dem meist besonderen Werk an der Opéra Comique, auch weil dort nun eine wirklich einzigartige Atmosphäre herrscht. Seit seinem schwierigen Start im November 2021 (wir haben im Januar 2022 darüber berichtet), hat der Direktor Louis Langrée wieder so etwas wie ein eigenes Ensemble und eine Akademie für junge Sänger gegründet, mit denen er um jede Produktion eine ganze Serie von „Sternschnuppen“ („Pléiades“) organisiert, die jetzt die halbe Saisonbroschüre füllen. Zu den vierzig (meist kostenlosen) Konzerten gehört ein innovatives Projekt mit dem Musée d’Orsay, wo die Sänger zu einem spezifischen Thema – ich war bei „L’amour à la française“ (Liebe auf Französisch) – im Museum vor den Kunstwerken singen. Das war akustisch nicht unproblematisch, aber als Initiative natürlich toll, weil so neues Publikum erreicht wird. Dieses kommt dann z. B. auch zu den vielen Symposien, an denen nun auch musiziert wird, und wo ich nun ganz andere Gesichter sehe als (früher nur) Wissenschaftler. Vor jeder Vorstellung gibt es eine Einführung von der Hausdramaturgin Agnès Terrier (wofür das Publikum schon vor dem Öffnen der Türen Schlange steht) und nach quasi jeder Vorstellung einen entspannten Drink im schönen Foyer, wozu die jungen Musiker andere Werke des geraden gespielten Komponisten singen. Nach der rezensierten Vorstellung gab es auch ein Publikumsgespräch im Saal, mit dem Direktor & Dirigenten und dem Team, wo man ganz entspannt Fragen stellen konnte: über den Komponisten, was eine Aufführung kostet, andere Werke die man gerne hören würde etc. Solch eine Atmosphäre vor und hinter der Bühne gibt es in keinem anderen Opernhaus in Paris und meines Wissens auch nicht in Frankreich. Schon gleich beim Eintreten ist man gut gelaunt, denn bei „Fantasio“ trug das ganze Personal im Eingangsbereich (auch z.B. in der Garderobe) dreispitzige Narrenkappen. Jetzt waren es weiße Nonnenhäubchen, weil „Le domino noir“ in einem Kloster spielt…
Zum Bericht von Waldemar Kamer
WIEN / Scala: BURKE & HARE
Eine Ballade über Angebot und Nachfrage
Schwarze Komödie von BRUNO MAX
Uraufführung. Premiere: 28. September 2024
Und treibt mit dem Entsetzen Scherz…
Foto: Scala Wien
Das Schlimme an der Sache ist: Sie ist wahr. Vielmehr war wahr im Edinburgh des Jahres 1828, wo zwei kleine irische Ganoven zu Massenmördern wurden. Als Protagonisten der „West Port Murders“ gingen William Burke und William Hare in die Geschichtsbücher und Schauerballaden ein. Hintergrund: Leichenraub bzw. Leichenbeschaffung durch Mord, angeregt von der Tatsache, dass rivalisierende Institutionen – die Universität von Edinburgh mit Dr. Alexander Monro und das private Anatomieinstitut von Dr. Robert Knox – mehr Leichen benötigten, als der freie Marke hergab.
„Eine Ballade über Angebot und Nachfrage“ hat Bruno Max folglich sein neues Stück „Burke & Hare“ genannt, und obwohl auf der Bühne gemordet und hingerichtet wird, ist es ihm als sein eigener Regisseur doch gelungen, all dies im Rahmen einer schwarzen Komödie nie degoutant ausufern zu lassen. Nicht vergessen – den Namen „Theater zum Fürchten“ hat die Scala in der Wiedner Hauptstraße immer noch im Untertitel.
Zum Premierenbericht von Renate Wagner
Heute auf Schloss Trautenburg/Steiermark: Pumeza „Lady Z“ Mathsikiza. Dem Komponisten Johann Joseph Fux gewidmet
Filme der Woche
Filmstart: 26. September 2024
MEGALOPOLIS / USA / 2024
Regie: Francis Ford Coppola
Mit: Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight u.a.
Rätsel über Rätsel
Besuchen Sie Renate Wagners FILMSEITE
Wenn man sich fragt, was in seinem Kopf vorging, als er sein Spätwerk „Megalopolis“ schuf, erinnert man sich daran, was man von dem nun 85jährigen Francis Ford Coppola schon bewundert hat – vor allem „Apocalypse Now“ und die drei Teile des „Paten“, denen absolut nichts Konfuses anhaftete. Nun, nach langer Pause sein „Lebenswerk“ vorlegend, für das er persönlich enorme finanzielle Opfer brachte, hat er einen wahrlich kruden und weitgehend unübersichtlichen Mix zwischen Altem Rom und Amerika im 20. Jahrhundert geliefert, der es auch eisernen Fans seiner Arbeit schwer macht.
Zu Beginn steht Adam Driver als Cesar Catilina (die Namen, die gefunden wurden, sind grotesk) auf einem riesigen Gebäude und erwägt offenbar, hinunter zu springen. Aber es ist der Sprung vom USA heute in die Zukunft, in eine ideale Stadt, den er wagen will, ein neues, „New Rome“ zu schaffen und damit an die großen Zeiten des antiken Römischen Weltreichs anknüpfen. (Etwas in der Zeit gerutscht ist Coppola sowieso – die Autos sind alle noch aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.)
Zur Filmbesprechung von Renate Wagner
Aktuelles aus „Neue Zürcher Zeitung“
Der Hizbullah bestätigt den Tod seines Führers Hassan Nasrallah – Israel hat ihn bei einem massiven Luftangriff in Beirut getötet: Nasrallah hatte sich offenbar in einem Bunker im Süden der libanesischen Hauptstadt aufgehalten. In Beirut herrscht Chaos, israelische Quellen äussern sich nur vorsichtig zum Hergang des Angriffs.
Jetzt lesen
«Schwer fassbarer Zivilisationsbruch» – nachdem Clan-Mitglieder Pflegepersonal angegriffen haben, ist die Entrüstung in Essen gross
Seit Jahren gilt die Stadt Essen als Clan-Hochburg. Immer wieder kommt es zu Razzien und Tumulten. Doch dieses Mal sei es etwas anderes, heisst es vor Ort.
Jetzt lesen
Steckt im Kollegen, im Nachbarn und im eigenen Ehemann auch ein Vergewaltiger? Der Prozess von Avignon wühlt Frankreich auf
Gisèle Pélicot wurde hundertfach in betäubtem Zustand vergewaltigt. Weil der Prozess gegen ihren Ehemann und fünfzig weitere mutmassliche Täter öffentlich stattfindet, lernen die Franzosen, wie «gewöhnliche Männer» zu Tätern schwerster Verbrechen wurden.
Jetzt lesen
Putin kann frohlocken: Die Spaltungen im westlichen Lager vertiefen sich: Vor zwei Jahren wurde der ukrainische Präsident in Amerika noch wie ein Held empfangen, diesmal ist er gescheitert. Die Ukraine und ihre Verbündeten sind sich uneinig. So kann der Krieg nicht gewonnen werden.
Jetzt lesen
Ein «Vatikan für Muslime»: Edi Rama will in Albanien einen toleranten Zwergstaat für einen Sufi-Orden gründen: Der albanische Regierungschef hat mit seiner Ankündigung an der Uno-Generalversammlung alle überrascht. Was hat es mit dem Projekt eines souveränen Staates für den Bektaschi-Orden auf sich?
Jetzt lesen
Frauenheld gegen Frauenversteher – der amerikanische Wahlkampf spaltet Männer und Frauen wie kaum je zuvor: Wann ist ein Mann ein Mann? Und wie männlich muss ein Präsident sein? Darüber streitet Amerika derzeit. Die Antworten darauf könnten die Wahl im November entscheiden.
Jetzt lesen
Tausende fliehen vor Israels Bomben, der Süden entvölkert sich – Libanon gleicht einem untergehenden Land
Seit fast einer Woche fliegt Israel schwere Luftangriffe gegen die Hizbullah-Miliz. Die Bombardements haben in Libanon eine gewaltige Fluchtwelle ausgelöst. Zurück bleiben Geisterstädte – eine Reise ins Kampfgebiet.
Jetzt lesen
Hassan Nasrallah ist tot: Im Nahen Osten war kaum einer so mächtig wie er: Der langjährige Hizbullah-Chef hat aus einer Guerilla-Truppe die stärkste Miliz des Nahen Ostens geformt. Nun ist er bei einem israelischen Luftangriff getötet worden.
Jetzt lesen
Zitat Ende „Neue Zürcher Zeitung“
Abschied aus dem Parlament: Was lernt man eigentlich als Politiker? Bezahlartikel
In jeder Fraktion gibt es Abgeordnete, die dem Nationalrat endgültig den Rücken kehren. Was nehmen sie mit – und was werden sie nicht vermissen?
Kurier.at
Instagram-Clips
„Depperter Trampl“: Grüne provozieren im Wahlkampf-Finish
Einen Tag vor der Wahl versuchen Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer und Grünen-Chef Werner Kogler noch, möglichst viele Wähler zu überzeugen. Die beiden Politiker setzen dabei auf humorvoll gemeinte Instagram-Videos.
Oe24.at
Fußball
Alles kompliziert! Alaba spielt erst wieder 2025. Knorpelschaden im Knie
David Alaba wird noch länger nicht auf dem Rasen zu sehen sein. Coach Ancelotti: „Man muss geduldig sein.“ Der beim Kreuzbandriss im Dezember ebenfalls im linken Knie entstandene Knorpelschaden macht alles kompliziert.
https://www.krone.at/3541746
Heute wählt Österreich. Ich bin ein hochpolitischer Mensch, war selbst Regionalpolitiker, habe dieses Medium nicht für politische Parteiwerbung missbraucht. Das bleibt auch am Wahltag so!
Haben Sie einen schönen Tag!
A.C.
IN MEMORIAM-GEBURTSTAGE IM JULI 2024
IN MEMORIAM-Geburtstage im Juli 2024
Berücksichtigt wurden runde und halbrunde Geburtstage. Zusammenstellung der Liste: Walter Nowotny
2.7. Hélène FORTIN: 65. Geburtstag
Biographie der kanadischen Sopranistin auf Französisch: https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Fortin
4.7. Libuše DOMANÍNSKÁ: 100. Geburtstag
Sie studierte am Konservatorium von Brno bei Hana Pírková und bei Bohuslaw Sobeský. 1946 debütierte sie in Brno als Vendulka in »Der Kuss« von Smetana. In den neun Jahren ihres Wirkens in Brno sang sie rund 40 Partien, darunter vor allem Rollen in Opern von Smetana, Dvorák und Janácek. 1955 wurde sie an das Nationaltheater Prag engagiert. Mit dem Ensemble dieses Hauses gastierte sie 1955 sehr erfolgreich in Moskau sowie 1964 bei den Festspielen von Edinburgh, wo sie als Jitka in »Dalibor« von Smetana (englische Erstaufführung dieser Oper) sowie in den Titelpartien von Janáceks »Katja Kabanowa« und Dvoráks »Rusalka« bewundert wurde. 1956 zu Gast an der Komischen Oper Berlin, 1968 am Teatro Colón Buenos Aires, im gleichen Jahr auch am Teatro San Carlo von Neapel zu Gast; auch in Amsterdam (Titelheldin in »Katja Kabanowa« von Janácek im Rahmen des Holland Festivals von 1959) und Brüssel aufgetreten. Seit der Spielzeit 1957-58 gastierte sie bis 1968 regelmäßig an der Wiener Volksoper. Aus ihrem reichhaltigen Repertoire für die Bühne seien die Marie in Smetanas »Die verkaufte Braut«, die Titelheldin in Smetanas Festoper »Libussa«, die Aida, die Elisabeth in »Don Carlos« von Verdi, die Eurydike in »Orpheus und Eurydike« von Gluck und die Titelgestalt in »Eva« von J.B. Foerster genannt. Neben ihrer Bühnentätigkeit war sie nicht weniger erfolgreich im Konzert- und Oratoriengesang. Die Sängerin, die zur Nationalkünstlerin der CSSR ernannt wurde, trat 1985 aus ihrer Karriere an der Prager Oper zurück. Sie starb 2021 in Hodonin (Tschechien).
Supraphon-Aufnahmen (Glagolitische Messe von Janácek, Titelpartie in Janáceks »Jenufa«, die als ihre besondere Glanzrolle galt, »Das schlaue Füchslein«, von Janácek, »Die Teufelswand« von Smetana, Kantate »Ein Blumenstrauß« von B. Martinù).
4.7. Roy HENDERSON: 125. Geburtstag
Ausbildung an der Royal Academy of Music in London, wo er mehrere Preise gewann und als »the most distinguished student of the year« ausgezeichnet wurde. Bereits 1924 sang er im englischen Rundfunk. Konzertdebüt 1925 in London in »A Mass of Life« von Delius. 1926 kam es zu seinem ersten Opernauftritt, als er bei der British National Opera Company in London den Ford in »Falstaff« von Verdi sang. In der Spielzeit 1928-29 hatte er seine ersten großen Erfolge an der Londoner Covent Garden Oper (Debüt als Donner im »Rheingold«), an der er seitdem oft auftrat. 1930-37 war er Dirigent der Nottingham Harmonic Society und mehrerer Chöre. 1933 erschien er beim Internationalen Fest für zeitgenössische Musik in Amsterdam. Bei den ersten Festspielen von Glyndebourne 1934 sang er den Grafen in »Le nozze di Figaro«. Er trat dann bis 1939 bei diesen Festspielen immer wieder auf, als Guglielmo in »Così fan tutte«, als Papageno in der »Zauberflöte« und als Masetto in »Don Giovanni«. 1936 wirkte er in Huddersfield in der Uraufführung des Werks »Dona nobis pacem« von Vaughan Williams mit. 1939-40 sang er bei einer England-Tournee den Peachum in »The Beggar’s Opera«. Er war ein bekannter Chor-Dirigent; so dirigierte er 1931-39 die Huddersfield Glee and Madrigal Society, 1937-52 den Nottingham Oriana Choir, 1942-53 den Bournemouth Municipal Choir. 1940-74 war er Professor an der Royal Academy of Music in London. Zu seinen Schülern zählten die große Altistin Kathleen Ferrier, die Sopranistin Jennifer Vyvyan und der Bariton John Shirley-Quirk. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte er zu den Begründern der Festspiele von Edinburgh, bei denen er 1947-48 auch als Sänger in Erscheinung trat. Sein letzter Auftritt erfolgte 1962 in der Kathedrale von Southwark als Christus in der Matthäus-Passion von J.S. Bach, ebenfalls eine seiner großen Kreationen. 1951 hatte er bereits seine Bühnenkarriere aufgegeben. Seit 1952 war er nur noch als Pädagoge, dazu auch schriftstellerisch tätig. Auf der Bühne schätzte man den Künstler vornehmlich als Mozartsänger, im Konzertsaal als Interpreten moderner englischer Musik. Er war auch ein bedeutender Oratoriensänger, vor allem bekannt als Elias in dem gleichnamigen Oratorium von Mendelssohn. Er starb 2000 in Bromley (England) im Alter von über 100 Jahren. Er war der Bruder der bekannten englischen Schauspielerin Anna Neagle (1904-86).
Schallplatten: HMV (Graf in »Figaros Hochzeit«, 1934, Masetto in »Don Giovanni«, Glyndebourne 1936), Decca, Columbia (»Les Noces« von Strawinsky, »Serenade to Music« von Vaughan Williams).
5.7. Tom KRAUSE: 90. Geburtstag
Sein Vater war Direktor einer Versicherungsgesellschaft. Während er in Helsinki Medizin studierte, spielte er Piano und Gitarre in einer Jazzband. 1956 begann er das Gesangstudium, das er teils in Hamburg, teils an der Wiener Musikakademie betrieb. Seine Lehrer waren die Pädagogen Margot Skoda, Sergio Nazor und Rudolf Bautz. 1957 debütierte er als Liedersänger (unter dem Namen Thomas Krause) in Helsinki. Bühnendebüt in der Spielzeit 1958-59 an der Städtischen Oper (Deutsches Opernhaus) Berlin als Escamillo in »Carmen«. Bald begann er eine große Karriere mit Gastspielen an der Mailänder Scala (1965 als Heerrufer in »Lohengrin« und 1978 mit dem Bariton-Solo im Deutschen Requiem von J. Brahms, zuvor bereits 1963 bei einem Gastspiel der Hamburger Staatsoper in »The Flood« und »Oedipus Rex« von Strawinsky), bei der English National Opera London, am Théâtre de la Monnaie Brüssel, in Toulouse und Bordeaux, an der Oper von Rom, am Teatro Colón Buenos Aires, an der Grand Opéra bzw. der Opéra Bastille Paris (1973 und 1992 Graf sowie 1973-74 und 1979 Figaro in »Le nozze di Figaro«, 1974 und 1976 Amfortas sowie 1999 und 2001 Titurel in »Parsifal«, 1974-76 und 1979-80 Guglielmo in »Così fan tutte«, 1974 Orest in »Elektra« von R. Strauss, 1975, 1978 und 1980 vier Dämonen sowie 2000 Crespel und Luther in »Hoffmanns Erzählungen«, 1976 Valentin in »Faust« von Gounod, 1977 und 1980 Marcello in »La Bohème«, 1977 Dandini in »La Cenerentola«, 1978 Sharpless in »Madame Butterfly«, 1992 Frère Bernard in »Saint Francois d‘Assise« von Messiaen, 1993 Tomski in »Pique Dame« von Tschaikowsky, 1996 Dikoj in »Katja Kabanowa« von Janácek), an der Nationaloper Helsinki, in Köln, Hannover, München, Berlin und später an der Chicago Opera. An der Wiener Staatsoper debütierte er bereits 1961 als Kruschina in Smetanas »Die verkaufte Braut«, in den Jahren 1970-83 gastierte er hier in insgesamt 28 Vorstellungen als Don Giovanni, als Posa in Verdis »Don Carlos«, als Don Pizarro in »Fidelio«, als Graf in »Le nozze di Figaro«, als Escamillo und als Amfortas. 1962-75 gehörte er dem Ensemble der Hamburger Staatsoper an. Bei den Bayreuther Festspielen sang er 1962 den Heerrufer, 1963 in London das Bariton-Solo im War Requiem von Benjamin Britten unter der Leitung des Komponisten. Bei den Festspielen von Glyndebourne hörte man ihn 1963 als Grafen in »Capriccio« von Richard Strauss. Bei den Festspielen von Salzburg trat er 1968-70 als Don Giovanni (wobei er 1968 kurzfristig für den erkrankten Nicolai Ghiaurov einsprang), 1969-70 und 1982-83 als Minister in »Fidelio«, 1969-70 als Guglielmo, 1972-76 und 1979-80 als Graf in »Le nozze di Figaro«, 1974 als Sprecher in der »Zauberflöte«, 1992 und 1998 als Frère Bernard auf; 1969 sang er dort den Kreon in einer konzertanten Aufführung von Strawinskys »Oedipus Rex«, 1970, 1973 und 1982 gab er bei den gleichen Festspielen große Liederabende; 1991 wirkte er hier in einem Kirchenkonzert und am 15.8.1992 in der Uraufführung der Oper »Mozart in New York« von Helmut Eder in der Rolle des Lorenzo da Ponte mit. In Hamburg wirkte er in den Uraufführungen der Opern »Der goldene Bock« von E. Krenek (16.6.1964 als Jason), »Der Zerrissene« von G. von Einem (17.9.1964), »Die Heimsuchung« (»The Visitation«) von Gunther Schuller (11.10.1966) und »Hamlet« von Humphrey Searle (5.3.1968 in der Titelrolle) mit. 1967 folgte er einem Ruf an die Metropolitan Oper New York. Hier sang er als Debütrolle den Grafen Almaviva in »Le nozze di Figaro« und trat dort während sechs Spielzeiten (bis 1973) in insgesamt 48 Vorstellungen als Escamillo, als Malatesta in »Don Pasquale« und als Guglielmo auf. Am Grand Théâtre Genf gastierte er 1982 als Amfortas, 1983 als Golaud in »Pelléas et Mélisande« und 1985 als Nick Shadow in »The Rake’s Progress« von Strawinsky sowie 1983 und 1986 mit Liederabenden; 1985 hörte man ihn bei den Festspielen von Savonlinna in der Bass-Partie des Königs Philipp in Verdis »Don Carlos«, in Houston/Texas als Mephisto in »Faust« von Gounod. 1989 gastierte er am Gran Teatre del Liceu in Barcelona und 1991 an der Oper von Miami als Alfonso in Donizettis »La Favorita«. 1992 zu Gast in Amsterdam, 1996 in Miami als Musikmeister in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss. 1995 nahm er bei den Festspielen von Savonlinna an der Uraufführung der Oper »Der Palast« von Aulis Sallinen teil. 1997 übernahm er bei den Festspielen von Savonlinna die Partie des Sprechers in der »Zauberflöte«. Als weitere Glanzrollen galten der Renato in Verdis »Un ballo in maschera«, der Amonasro in »Aida« und der Germont-père in »La Traviata«. Im Konzertsaal trat er in einem sehr umfangreichen Oratorien- und Liedrepertoire auf. Er starb 2013 in Hamburg.
Warm timbrierte, kraftvolle, durch eine überlegene Ausdruckskunst gekennzeichnete Baritonstimme, von der sehr viele Schallplatten vorhanden sind, u.a. auf den Marken Ariola-Bertelsmann, Decca (Kurwenal in »Tristan und Isolde«, Graf in »Le nozze di Figaro«, Guglielmo in »Così fan tutte«, Don Pizarro in »Fidelio«, »La Bohème«, »Andrea Chénier«, »Don Pasquale«, »Roméo et Juliette« von Gounod, »Turandot« von Puccini, »I Pagliacci«, »Salome« und »Elektra« von R. Strauss, »Un ballo in maschera« und »Otello« von Verdi, zum Teil auch in kleineren Rollen; Matthäuspassion von J.S. Bach, C-Dur-Messe von Beethoven), DGG (»Carmen«, Frère Bernard in »Saint François d’Assise« von O. Messiaen), Orfeo (»Alceste« von Gluck), Philips (»Lohengrin«, »Die Fledermaus«), Finlandia (»Kung Karls Jakt« von F. Pacius, Lieder von R. Schumann und M. Mussorgsky, Lieder von Sibelius), CBS (»Oedipus Rex« von Strawinsky), HMV (»Euryanthe« von Weber), RCA-Erato (»Jolanthe« von Tschaikowsky, Oratorium »Christus« von Liszt), Koch Records (»Der Palast« von Aulis Sallinen), Telarc (Mozart-Requiem).
5.7. Oskar CZERWENKA: 100. Geburtstag
Er wollte ursprünglich Maler werden, ließ dann aber seine Stimme ausbilden. Er war Schüler von Otto Iro in Wien. Er debütierte 1947 am Opernhaus von Graz als Eremit im »Freischütz« von Weber. 1951 folgte er einem Ruf an die Wiener Staatsoper (Debüt als Nachtwächter in »Die Meistersinger von Nürnberg«), deren Mitglied er bis 1986 blieb (letzter Auftritt als Osmin in der »Entführung aus dem Serail«). Er trat an der Wiener Staatsoper im Ablauf seiner langen Karriere in 1100 Vorstellungen und 60 Rollen auf und wurde zu deren Ehrenmitglied ernannt. An der Wiener Staatsoper hörte man ihn u.a. als König wie als Ramfis in »Aida«, als Lodovico in Verdis »Otello«, als Mesner in »Tosca«, als Rocco in »Fidelio«, als Timur in Puccinis »Turandot«, als Monterone in »Rigoletto«, als Leporello in »Don Giovanni«, als Marchese di Calatrava wie als Pater Guardian in »La forza del destino«, als Peneios in »Daphne« von R. Strauss, als Daland in »Der fliegende Holländer«, als Madruscht in »Palestrina« von H. Pfitzner, als Jake Wallace in »La Fanciulla del West«, als Colline in »La Bohème«, als Herold in »Alceste« von Gluck, als Kezal in Smetanas »Die verkaufte Braut«, als Banquo in Verdis »Macbeth«, als Graf Des Grieux in Massenets »Manon«, als Onkel Bonze in »Madame Butterfly«, als van Bett in »Zar und Zimmermann« von Lortzing, als Pope in »Iwan Tarassenko« von Fr. Salmhofer, als Kommerzienrat in »Intermezzo« von R. Strauss, als Orest in »Elektra« von R. Strauss, als Warlaam in »Boris Godunow«, als Veitinger in »Das Werbekleid« von Fr. Salmhofer, als Odysseus in »Penelope« von R. Liebermann, als Don Pasquale, als Ochs im »Rosenkavalier«, als Einarmiger in »Die Frau ohne Schatten« von R. Strauss, als König Marke in »Tristan und Isolde«, als Geronte in Puccinis »Manon Lescaut«, als König Philipp in Verdis »Don Carlos«, als Basilio im »Barbier von Sevilla«, als Stadthauptmann im »Revisor« von W. Egk, als Riedinger in »Mathis der Maler« von Hindemith, als Bote in »Oedipus Rex« von Strawinsky, als Fasolt im »Rheingold«, als Ptolemäus in Händels »Julius Caesar«, als Gremin in »Eugen Onegin«, als Bauer in C. Orffs »Die Kluge«, als Boris in »Katerina Ismailowa« von Schostakowitsch, als Zuniga in »Carmen«, als Morosus in »Die schweigsame Frau« von R. Strauss, als Rodrigo wie als Tierbändiger in »Lulu« von A. Berg, als Waldner in »Arabella« von R. Strauss, als Budivoj in »Dalibor« von Smetana, als Neger in »Angélique« von Ibert, als Dikoj in »Katja Kabanowa« von Janácek, als La Roche in »Capriccio« von R. Strauss und als König Balthasar in »Amahl und die nächtlichen Besucher« von G.C. Menotti. Er trat auch oftmals an der Wiener Volksoper auf, u.a. 1964 als Ramiro in Ravels »Die spanische Stunde«, 1965 als Hanswurst in Haydns »Das brennende Haus«, 1966 ans Anzoleto in Wolf-Ferraris »Der Campiello«, 1970 als Mustafà in Rossinis »Italienerin in Algier«, 1972 als Sulpice in Donizettis »Regimentstochter«. Er erwarb internationales Ansehen vor allem durch seine vortreffliche Gestaltung von Buffo-Rollen, beherrschte aber insgesamt mehr als 75 Opernpartien. Seit 1952 trat er bei den Festspielen von Salzburg auf. Hier sang er den Notar im »Rosenkavalier« (1953), den Kuno im »Freischütz« (1954), den Truffaldin in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss (1954-55), den Bartolo in »Le nozze di Figaro« (1956, 1962) und den Buonafede in J. Haydns »Il mondo della luna« (1959), wirkte in den Uraufführungen der Opern »Der Prozess« von Gottfried von Einem (17.8.1953 als Untersuchungsrichter und als Prügler) und »Irische Legende« von Werner Egk (17.8.1955 als 2. Kaufmann) mit und trat als Konzertsolist in der C-Moll-Messe von Mozart (1952-53), in Haydns »Schöpfung« (1953), in »Judas Makkabaeus« von Händel (1953), im Mozart-Requiem (1954) und in Bruckners »Te Deum« (1956) auf. 1959-60 sang er beim Glyndebourne Festival den Ochs auf Lerchenau. Er gastierte an den Opernhäusern von Köln und Frankfurt a.M., an der Deutschen Oper Berlin, an den Staatsopern von Hamburg, München und Stuttgart, am Teatro San Carlos Lissabon, an den Nationalopern von Prag und Budapest, am Opernhaus Zürich und am Théâtre de la Monnaie in Brüssel (1954). In der Saison 1959-60 debütierte er an der Metropolitan Oper New York als Ochs und hatte dort in der gleichen Spielzeit einen großen Erfolg als Rocco, er sang dort jedoch nur insgesamt in 8 Vorstellungen. 1965 sang er in Hamburg in der Uraufführung der Oper »Jacobowsky und der Oberst« von G. Klebe. Zu seinen großen Bühnenrollen gehörte auch der Abul Hassan im »Barbier von Bagdad« von P. Cornelius. Großer Konzert- und Oratorienbassist. In den siebziger Jahren hatte er als Tevje in dem Musical »Anatevka« große Erfolge, ebenso als Liedersänger. Er wirkte in zahlreichen Fernsehsendungen von Opern in Österreich und in Deutschland mit. Er betätigte sich auch als Fernsehmoderator und nach seinem Abschied von der Bühne wieder als Maler. Er veröffentlichte »Lebenszeiten-Ungebetene Briefe« (Wien, 1987). Er starb nach langer, unheilbarer Krankheit 2000 in Vöcklabruck.
Schallplatten: Columbia (»Der Barbier von Bagdad« von Cornelius), MMS (Komtur in »Don Giovanni«), Philips (»Tiefland«, »Salome«, »Die Hochzeit des Figaro«), Legendary Recordings (»Aida«), Teatro Dischi (»Der Barbier von Sevilla«), Decca (»Die Frau ohne Schatten« von R. Strauss), Preiser (»Winterreise« von Schubert, Balladen von C. Loewe, weitere Lied-Aufnahmen); auch auf EJS und Remington (Verdi-Requiem) zu hören.
5.7. Henry SKJÆR: 125. Geburtstag
Nach seinem Studium der Politologie und der Wirtschaftswissenschaft war er 1916-19 bei einer großen Bank in Kopenhagen beschäftigt. Er strebte jedoch den Beruf eines Sängers an und war 1920-24 Schüler des Kopenhagener Konservatoriums. Debüt 1924 in Kopenhagen als Don Pizarro in »Fidelio« von Beethoven. Seit 1930 fest engagiertes Mitglied der Königlichen Oper Kopenhagen, der er bis 1973 angehörte. Er sang in dieser langen Zeit dort eine Fülle von Partien, seit 1950 in zwanzig Spielzeiten u.a. den Grafen in »Die Hochzeit des Figaro«, ferner den Rigoletto, den Grafen Luna im »Troubadour«, den Titelhelden in »Giulio Cesare« von Händel und den Scarpia in »Tosca«. In der denkwürdigen Kopenhagener Premiere von Gershwins »Porgy and Bess« mitten in der deutschen Besatzungszeit 1943 sang er den Crown. Bedeutender Konzertsänger und Pädagoge. Er starb im März 1991.
Schallplatten: einige Titel auf HMV.
6.7. Jean PÉRISSON: 100, Geburtstag
Biographie des französischen Dirigenten auf Englisch: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_P%C3%A9risson
6.7. Helene PESSIACK: 175. Geburtstag
Sie war die Tochter des Kaufmanns Simon Pesjak (auch Pessiack geschrieben) und der slowenischen Dichterin Luise Pesjak (1828-98). Sie kam im Lauf ihrer Bühnenkarriere zu sehr erfolgreichen Auftritten am Hoftheater von Hannover, an dem sie 1874-76 engagiert war, dann am Hoftheater Wiesbaden (1876-78), am Opernhaus von Breslau (1882-83), am Stadttheater von Barmen (1885-86), am Stadttheater von Aachen (1886-87) und am Stadttheater von Krefeld (Gast-Engagement 1987-88). Sie trat als Gast an den Hoftheatern von Dresden, Berlin und Kassel sowie 1881 an der Berliner Kroll-Oper auf. 1886 gastierte sie am Opernhaus von Riga in drei ihrer großen Partien: als Agathe im »Freischütz«, als Gräfin in »Die Hochzeit des Figaro« und als Marguerite in »Faust« von Gounod. Auch als Konzertsängerin hatte sie eine bedeutende Karriere. Sie starb im Januar 1917. Sie war mit dem Schauspieler Wilhelm Rieckhoff (1849-1914) verheiratet, der u.a. am Berliner Lessing-Theater, in Hamburg und 1885-89 sowie 1913-14 in Riga engagiert war.
7.7. Elena OBRAZTSOVA: 85. Geburtstag
Sie besuchte das Konservatorium von Leningrad in der Klasse der Pädagogin Antonina Grigorjewna. Noch während ihrer Ausbildung gewann sie 1962 eine Goldmedaille bei den Welt-Jugendfestspielen in Helsinki. 1963 wurde sie vom Konservatorium aus sogleich an das Bolschoi Theater von Moskau verpflichtet. Hier sang sie als Antrittsrolle die Marina in »Boris Godunow«. In den folgenden Jahren hatte sie dort ihre größten Erfolge als Marfa in »Chowanschtschina« von Mussorgsky, als Eboli in »Don Carlos« von Verdi, als Carmen, als Ljubascha in der »Zarenbraut« von Rimski-Korsakow, als Hélène Besuchowa in »Krieg und Frieden« von Prokofjew, als Polina wie als alte Gräfin in »Pique Dame« von Tschaikowsky, als Amneris in »Aida«, als Kontschakowna in »Fürst Igor« von Borodin, als Dalila in »Samson et Dalila« von Saint-Saëns und 1965 als Oberon in der Moskauer Premiere der Oper »A Midsummer Night’s Dream« von Benjamin Britten. Viele Gastspiel zusammen mit dem Ensemble des Bolschoi Theaters: 1964 in Mailand (als Gouvernante in »Pique Dame« und als Fürstin Maria in »Krieg und Frieden«), 1967 in Montreal, 1969 in Paris, 1971 in Wien (als Polina, als Hélène Besuchowa und als Marina), 1973 in Mailand (als Marfa und als Prosia in »Semjon Kotko« von Prokofjew), 1975 in New York. 1970 gewann sie den Tschaikowsky-Wettbewerb, im gleichen Jahr den internationalen Wettbewerb für Sänger in Barcelona. 1973 sang sie bei den Festspielen von Wiesbaden. An der Mailänder Scala hatte sie 1976 einen besonderen Erfolg als Charlotte in »Werther« von Massenet. Hier sang sie auch 1978-79 die großen Verdi-Partien der Eboli, der Ulrica in »Un Ballo in maschera« und im Requiem, außerdem gab sie dort ein Gala-Konzert. An der Mailänder Scala sang sie auch 1980 die Iocasta in Strawinskys »Oedipus Rex«, 1981 die Santuzza in »Cavalleria rusticana«, 1982 die Giovanna Seymour in Donizettis »Anna Bolena«, 1996 die Babulenka in Prokofjews »Der Spieler« und 2005 die alte Gräfin in »Pique Dame«. An der Oper von San Francisco 1975 als Azucena im »Troubadour«, 1977 als Principessa di Bouillon in »Adriana Lecouvreur« von Cilea und 1990 als Principessa in »Suor Angelica« von Puccini zu Gast. 1973-74 und 1983 große Erfolge am Gran Teatre del Liceu in Barcelona. 1975-87 gastierte sie in insgesamt 26 Vorstellungen an der Wiener Staatsoper als Carmen, als Amneris, als Santuzza und als Azucena. 1975-81 gab sie mehrfache Gastspiele an der Nationaloper Budapest. 1976-79, 1987, 1990 und 2001-02 Mitglied der Metropolitan Oper New York, wo sie im Oktober 1976 als Antrittsrolle die Amneris sang und in insgesamt 55 Vorstellungen auch als Dalila, als Charlotte, als Carmen, als Adalgisa in »Norma«, als Azucena, als Ulrica, als Babulenka und als Madame Akhrosimova in Prokofjews »Krieg und Frieden« eine glanzvolle Karriere entwickeln konnte. 1978 übernahm sie bei den Festspielen von Salzburg die Partie der Eboli und gab dort 1979 einen Liederabend. 1985 gastierte sie bei den Festspielen in der Arena von Verona, 1987 in Budapest und bei den Festspielen von Wiesbaden, 1989 am Teatro Colón Buenos Aires als Amneris, 1985 beim Festival von Ravenna als Santuzza. An der Covent Garden Oper London hörte man sie 1981 und 1985 als Azucena. 1996 gastierte sie mit dem Ensemble der Oper von St. Petersburg an der Opéra Bastille Paris als Babulenka. 1998 hinterließ sie bei einem Gastspiel in Venedig als Principessa in Puccinis »Suor Angelica« einen bewegenden Eindruck, ebenso als alte Gräfin in »Pique Dame« und als Babulenka im neu eröffneten Festspielhaus von Baden-Baden. 1999 gastierte sie (zusammen mit dem Bolschoi-Ensemble) im Coliseum Theatre in London als Marina; im gleichen Jahr sang sie an der Oper von St. Petersburg die alte Gräfin in »Pique Dame«. 2000 übernahm sie an der Opéra Bastille Paris die Madame Akhrosimova. Im Laufe ihrer Karriere ist sie auf der Bühne wie auf dem Konzertpodium als Gast in Italien, Frankreich, England, Spanien und Deutschland, in Kanada und Japan und natürlich in den russischen Musikmetropolen aufgetreten. Sie führte auch in Opernaufführungen Regie, u.a. 1986 am Bolschoi Theater Moskau in Massenets »Werther«. Sie wurde 1973 zur Volkskünstlerin der UdSSR ernannt und erhielt 1976 den Staatspreis der Sowjetunion. Sie starb 2015 in Leipzig. Seit 1984 war sie mit dem aus Litauen stammenden Dirigenten Algis Žiūraitis (1928-98) verheiratet. – Ihre üppige, dunkel timbrierte, ausdrucksstarke, bis zu suggestiver Dramatik reichende Stimme wurde durch ein herausragendes Darstellungsvermögen ergänzt. Im Konzertsaal erwies sie sich als hoch begabte Lied-Interpretin, und zwar sowohl für das russische Lied wie für das Liedgut der deutschen Romantik als auch für spanische Kompositionen (Lieder von Manuel de Falla, »Tonadillas« von Granados). Eine der bedeutendsten Altistinnen ihrer Generation.
Schallplatten der staatlichen sowjetrussischen Produktion, darunter die vollständige Oper »Fürst Igor« von Borodin. Sang auf HMV die Azucena im »Troubadour«, auf DGG in »Samson et Dalila« von Saint- Saëns (mit Placido Domingo als Partner), in Massenets »Werther«, in »Aida«, »Rigoletto« und »Luisa Miller« von Verdi, auf CBS in »Adriana Lecouvreur« von Cilea, auf Capriccio in »Herzog Blaubarts Burg« von Béla Bartók.
8.7. Rudolf HAAS: 175. Geburtstag
Nachdem er mit der österreichischen Armee am Italien-Feldzug von 1866 teilgenommen hatte, wurde er Respicient in der staatlichen Finanzverwaltung und war an Zollämtern in Schärding und in Passau beschäftigt. 1879 ging er als Dilettant zu einer reisenden Theatertruppe und trat erstmals in Rottmünster in Bayern auf der Bühne auf. Er war dann als Schauspieler und Sänger bei derartigen Truppen tätig, die u.a. in München (Elysium-Theater), Wien (Fürst-Theater), Saaz, Eger und Prag, schließlich in Salzburg und in Bukarest, ihre Vorstellungen gaben. Er schloss sich einer Wanderbühne an, deren Tournee durch Italien bis nach Sizilien führte. Dann wiederum kamen Auftritte in Bad Kissingen, am Deutschen Theater Budapest, in Würzburg, Nürnberg, Hannover und Chemnitz zustande. In den Jahren 1893-96 war er als Sänger, Schauspieler und Spielleiter am Wilhelm-Theater in Magdeburg beschäftigt. Seit 1899 wirkte er als erster Komiker in humoristischen Väterrollen am Gärtnerplatztheater in München. 1902 ging er als Regisseur an das Stadttheater Leipzig, dem er bis 1918 angehörte, und wo er als Regisseur für Operetten und musikalische Possen tätig war, aber auch noch als Operettensänger auftrat. Er verbrachte seinen Ruhestand in Herrsching am Ammersee, wurde aber durch die wirtschaftliche Situation nach dem Ersten Weltkrieg gezwungen, erneut zu gastieren und ging dieser Tätigkeit von Leipzig aus nach. Er betätigte sich auch als Sprecher am damals aufkommenden Rundfunk. Aus seinem Repertoire für die Bereiche der Oper und der Operette sind der Beppo in »Fra Diavolo«, der Ritter Adelhof im »Waffenschmied« von Lortzing, der Ollendorf in Millöckers »Der Bettelstudent«, der Frank wie der Frosch in der »Fledermaus«, der Bobèche in »Blaubart« von Offenbach und der Larivandière in »La fille de Mme Angot« von Lecocq zu nennen. Er starb 1927 in Leipzig.
9.7. Eberhard WAECHTER: 95. Geburtstag
Er studierte seit 1947 zuerst Klavierspiel und Musiktheorie an der Wiener Musikhochschule, seit 1950 Gesang bei Elisabeth Rado. 1953 folgte er einem Ruf an die Wiener Staatsoper (Debüt als St. Brioche in »Die lustige Witwe«), an der er bis 1983 blieb (letzter Auftritt als Sprecher in der »Zauberflöte«). Er trat an der Wiener Staatsoper im Ablauf seiner langen Karriere in 1193 Vorstellungen auf und wurde zu deren Ehrenmitglied ernannt. Man sah ihn hier u.a. als Silvio im »Bajazzo«, als Valentin in »Faust« von Gounod, als Tomski in »Pique Dame« von Tschaikowsky, als Dr. Falke wie als Eisenstein in der »Fledermaus«, als Graf von Liebenau im »Waffenschmied« von Lortzing, als Ottokar im »Freischütz«, als Lord Kookburn in »Fra Diavolo« von Auber, als Wolfram in »Tannhäuser«, als Germont-père in »La Traviata«, als Moralès wie als Escamillo in »Carmen«, als Marcello in »La Bohème«, als Melot in »Tristan und Isolde«, als Lescaut in Puccinis »Manon Lescaut«, als Ping in Puccinis »Turandot«, als Posa in Verdis »Don Carlos«, als Renato in Verdis »Un ballo in maschera«, als Graf in »Le nozze di Figaro«, als Don Giovanni, als Sharpless in »Madame Butterfly«, als Ford in Verdis »Falstaff«, als Kothner in »Die Meistersinger von Nürnberg«, als Donner wie als Wotan im »Rheingold«, als Titelheld in Händels »Julius Caesar« wie in Borodins »Fürst Igor«, als Gérard in Giordanos »Andrea Chénier«, als Amfortas in »Parsifal«, als Golaud in »Pelléas et Mélisande«, als Minister in »Fidelio«, als Graf Luna im »Troubadour«, als Nick Shadow in »The Rake’s Progress« von Strawinsky, als Scarpia in »Tosca«, als Heerrufer in »Lohengrin«, als Jochanaan in »Salome« von R. Strauss, als Orest in »Elektra« von R. Strauss, als Figaro im »Barbier von Sevilla«, als Titelheld in »Dantons Tod« von G. von Einem, als Don Alfonso in »Così fan tutte«, als Titelhelden in »Simon Boccanegra« von Verdi, als Mandryka in »Arabella« von R. Strauss, als Wladislaw in »Dalibor« von Smetana, in den Rollen der vier Dämonen in »Hoffmanns Erzählungen«, als Rigoletto, als Morone in »Palestrina« von H. Pfitzner, als Musiklehrer in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss und als König Melchior in »Amahl und die nächtlichen Besucher« von G.C. Menotti. Am 23.5.1971 sang er an der Staatsoper Wien in der Uraufführung der Oper »Der Besuch der alten Dame« von Gottfried von Einem den Ill, bereits am 17.6.1956 in der Uraufführung von Frank Martins »Der Sturm« den Prospero. Er trat auch oftmals an der Wiener Volksoper auf, u.a. 1965 als Homonay im »Zigeunerbaron«, 1973 als Danilo in »Die lustige Witwe«, 1979 als Bartolo im »Barbier von Sevilla« (während sein Sohn Franz Wächter den Figaro sang) und 1986 als Beppo in »Fra Diavolo« von Auber. Der Künstler hatte dann eine glanzvolle internationale Karriere. Er gastierte an der Scala in Mailand (Debüt 1960 als Graf in »Le nozze di Figaro«, 1962 als Titelheld in Luigi Dallapiccolas »Il Prigioniero«, als Kothner und als Golaud), an der Covent Garden Oper London (1956 als Graf in »Le nozze di Figaro«, 1959 als Amfortas und als Renato, 1965 als Don Giovanni), an den Staatsopern von München und Stuttgart, in Rom, Berlin und Brüssel. Seit 1956 trat er bei den Festspielen von Salzburg in Erscheinung, wo man ihn vor allem als Mozart-Sänger bewunderte (1956 als Arbace in »Idomeneo« und als 2. Priester in der »Zauberflöte«, 1958 als Graf in »Le nozze di Figaro«, 1960 als Sprecher in der »Zauberflöte«, 1960-61 als Don Giovanni, 1961 als Oberpriester in »Idomeneo«, 1964-65 als Orest in »Elektra« von R. Strauss, 1965 als Schtschelkalow in Mussorgskys »Boris Godunow«). Bei den Festspielen von Bayreuth wirkte er 1958-60 und 1966 als Amfortas mit, 1958-59 als Kothner, 1958-60 als Heerrufer, 1962 und 1966 als Kurwenal in »Tristan und Isolde« und 1962, 1964 und 1966 als Wolfram. Gastspiele an der Opernhäusern von Dallas (1960) und San Francisco (1964 als Barak in »Die Frau ohne Schatten« von R. Strauss, als Germont-père, als Graf in »Le nozze di Figaro« und als Amfortas). 1960 wurde er an die New Yorker Metropolitan Oper verpflichtet, an der er im Jänner 1961 dreimal den Wolfram sang. In dieser Partie hatte er auch 1959 an der Grand Opéra Paris debütiert; an der Oper von Chicago übernahm er als Antrittsrolle 1960 den Grafen in »Le nozze di Figaro«. Am 18.9.1980 wirkte er am Theater an der Wien in der Uraufführung der Oper »Jesu Hochzeit« von Gottfried von Einem als Josef mit. 1985 nahm er an der Japan-Tournee der Wiener Volksoper teil. Aus seinem umfangreichen Repertoire für die Bühne sind ergänzend der Eugen Onegin von Tschaikowsky und der Wozzeck von A. Berg zu nennen. Seit etwa 1973 verlegte er sich auf den Vortrag von Buffo-Rollen wie dem Dulcamara in »L’Elisir d’amore« (1973 Theater an der Wien) und dem Gianni Schicchi in Puccinis gleichnamiger Oper. 1979 trat er nochmals bei den Salzburger Festspielen – diesmal als Schauspieler – auf: er spielte in »Das weite Land« von Arthur Schnitzler den Doktor von Aigner. 1987 wurde er Direktor der Wiener Volksoper, 1991 übernahm er dann die Direktion der Wiener Staatsoper. Er brach 1992 plötzlich während eines Spaziergangs mit seiner Gattin im Wiener Wald tot zusammen. – Dunkel glänzende, ausdrucksvolle Baritonstimme, sowohl auf der Bühne als auch im Konzertsaal in einem umfassenden Repertoire erfolgreich.
Schallplatten der Marken DGG (»Tristan und Isolde«, »Der Freischütz«, Wolfram in »Tannhäuser«, Wien 1963), Decca (»Salome«, »Arabella«, »Das Rheingold«, »Die Fledermaus«, »Wozzeck« und »Lulu« von A. Berg), Columbia (»Le nozze di Figaro«, »Don Giovanni«, »Die Fledermaus«, »Der Rosenkavalier«, »Capriccio« von R. Strauss), Philips (»Don Giovanni«, »Tannhäuser«, »Tiefland«), Ariola-Eurodisc (»Cavalleria rusticana«), Italia (»Il Prigioniero« von Dallapiccola), Sony (»Die Csárdásfürstin« von E. Kálmán), Amadeo-Polygram (»Der Besuch der alten Dame«) und RCA (»Die Fledermaus«). Auf Replica singt er den Heerrufer in »Lohengrin« (Bayreuth, 1958), weiter Opernmitschnitte auf Melodram (»Parsifal« und »Lohengrin«, Bayreuth 1958 bzw. 1960), Movimento Musica (»Fidelio«, »Die Zauberflöte« und aus Salzburg als Titelheld in »Don Giovanni«, 1960 und in »Idomeneo«, 1961), Morgan (»Don Carlos«).
9.7. Signe AMUNDSEN: 125. Geburtstag
Sie erhielt ihre erste Ausbildung bei Mimi Hviid in Oslo und studierte dann weiter bei W. Bernardi in Paris und in Mailand. 1920 debütierte sie in Oslo als Norina in »Don Pasquale« von Donizetti, doch spielte sich ihre weitere Karriere im Wesentlichen außerhalb ihrer norwegischen Heimat ab. Häufig trat sie in Italien auf, wo sie meistens unter den Namen Silvia Garetti oder Gina Garini sang; so wirkte sie in Italien an Theatern in Rom, Neapel, Turin, Bologna und Catania (1935). 1935 sang sie an der Oper von Monte Carlo die Margherita in »Mefistofele« von Boito, 1936 an der Opéra-Comique Paris die Santuzza in »Cavalleria rusticana«. Dazu trat sie gastweise in Bordeaux und Nizza, in Berlin, Antwerpen und Stockholm auf. Zu ihren wichtigsten Bühnenrollen gehörten die Leonore im »Troubadour«, die Traviata, die Aida, die Amelia in Verdis »Un ballo in maschera«, die Agnese in »Beatrice di Tenda« von Bellini, die Butterfly, die Mimi in »La Bohème«, die Titelfigur in »Manon Lescaut« von Puccini, die Elsa in »Lohengrin«, die Brünnhilde in der »Walküre« und die Marguerite in »Faust« von Gounod. Sie starb 1987 in Oslo.
Einige Schallplattenaufnahmen auf HMV.
10.7. Jonny BLANC: 85. Geburtstag
Er erhielt seine Ausbildung an der Königlichen Musikakademie von Stockholm; seine hauptsächliche Lehrerin war hier Käthe Sundström; weitere Studien bei Clemens Kaiser-Breme in Essen. Debüt als Bariton 1962 am Stora Theater Göteborg; er sang 1963-65, immer noch im Baritonfach, am Odeontheater in Stockholm. 1967 erneutes Debüt, jetzt als Tenor, an der Königlichen Oper Stockholm in der Rolle des Dimitrij in Mussorgskys »Boris Godunow«. Seither große Karriere an der Stockholmer Oper. Zahlreiche Gastspiele an den Opernhäusern von Malmö und Oslo, dann auch an der Oper von Frankfurt a.M., an der Oper von Kopenhagen, bei der Scottish Opera Glasgow (1976-77 als Danilo in Lehárs »Die lustige Witwe«), in Miami, Helsinki und Lissabon. Seit 1966 eine der Hauptkräfte des Ensembles der Drottningholmer Festspiele, wo er 1973-74 in der Wiederaufführung der vergessenen Oper »Gustaf Adolf och Ebba Brahe« von G.J. Vogler mitwirkte. Er gastierte mit dem Drottningholm Theater bei den Festspielen in Hannover-Herrenhausen. 1971 sang er in Oslo in der Uraufführung der Oper »Anne Pedersdotter« von Braein, am 18.1.1973 an der Stockholmer Oper in der von J.L. Werles »Tintomara«. Beim Edinburgh Festival trat er 1974 bei einem Gastspiel der Königlichen Oper Stockholm als Stewa in Janáceks »Jenufa« auf. In seinem umfangreichen Bühnenrepertoire fanden sich sowohl lyrische als auch heldische Tenorpartien, von denen noch der Nerone in Monteverdis »L’Incoronazione di Poppea«, der Riccardo in Verdis »Maskenball«, der Cavaradossi in »Tosca«, der Don José in »Carmen«, der Florestan in »Fidelio«, der Siegmund in der »Walküre«, der Hermann in »Pique Dame« von Tschaikowsky und der Eisenstein in der »Fledermaus« genannt seien. Erfolgreicher Konzert- und Oratoriensänger. Er starb im Dezember 2011.
Schallplatten auf HMV und auf Gramofon ab Electra. Auf MRF Mitschnitt einer Aufführung von Voglers »Gustaf Adolf och Ebba Brahe« aus Drottningholm von 1973.
11.7. Hermann PREY: 95. Geburtstag
Er erhielt seine Gesangsausbildung an der Berliner Musikhochschule durch Jaro Prohaska, Günther Baum und Harry Gottschalk. 1951 gab er seinen ersten Liederabend. Er gewann 1952 einen Gesangwettbewerb des Hessischen Rundfunks in Frankfurt a.M. Er debütierte 1952 bei einem Gastspiel des Staatstheaters Wiesbaden in Bad Salzschlirf als Moruccio in »Tiefland« von d’Albert. Er war 1953-58 an der Staatsoper Hamburg, 1958-60 an der Städtischen Oper Berlin, seit 1960 bis zu seinem Tod an der Bayerischen Staatsoper München engagiert. 1956 unternahm der Künstler eine sehr erfolgreiche Nordamerika-Tournee, bei der man ihn vor allem als Lied-Interpreten bewunderte. Bereits 1957 debütierte er an der Wiener Staatsoper als Figaro im »Barbier von Sevilla« und sang hier bis 1994 in insgesamt 79 Vorstellungen außerdem noch den Wolfram in »Tannhäuser«, den Kapellmeister Storch in »Intermezzo« von R. Strauss, sowohl den Grafen als auch den Figaro in »Le nozze di Figaro«, den Olivier in »Capriccio« von R. Strauss, den Guglielmo in »Così fan tutte«, den Beckmesser in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den Don Giovanni, den Sprecher in der »Zauberflöte« und den Eisenstein in der »Fledermaus«. Seit 1959 Jahr für Jahr bedeutende Erfolge bei den Salzburger Festspielen; er sang dort 1959 den Barbier in »Die schweigsame Frau« von R. Strauss, 1960-65 und 1972-77 den Guglielmo, 1967-68, 1970 und 1974 den Papageno, 1968 den Figaro im »Barbier von Sevilla«, 1971 den Grafen in »Le nozze di Figaro«; er trat in Salzburg auch als Solist in Konzerten (1960 und 1975 in Mahlers 8. Sinfonie sowie 1965 in Haydns »Die Schöpfung«), vor allem aber fast alljährlich als Liedersänger (1961-68, 1970-79, 1981-82, 1984-85, 1987-88, 1991, 1993, 1995-97) in Erscheinung. Bei den Bayreuther Festspielen hörte man ihn 1965-67 als Wolfram, dort wiederum 1981-84 und 1986 mit sensationellem Erfolg als Beckmesser aufgetreten. Er gastierte in Kopenhagen, Amsterdam und Brüssel. 1960 folgte er einem Ruf an die Metropolitan Oper New York (Antrittsrolle: Wolfram). Dort trat er in zwölf Spielzeiten in insgesamt 65 Vorstellungen auch als Graf in »Le nozze di Figaro«, als Papageno, als Figaro im »Barbier von Sevilla«, als Musiklehrer in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss, als Eisenstein und als Beckmesser auf. 1960 Gastspiel an der Oper von Dallas, 1961 an der Oper von Philadelphia (als Wolfram), 1961 in Den Haag (als Graf in »Le nozze di Figaro«), 1963 an der San Francisco Opera (als Olivier, als Guglielmo und als Figaro im »Barbier von Sevilla«, 1982 noch einmal als Figaro in »Le nozze di Figaro«) sowie beim Maggio Musicale von Florenz (1963 als Wolfram), 1971 in Chicago. An der Mailänder Scala sang er 1969 und 1976 die Titelrolle im »Barbier von Sevilla«, 1974 den Grafen in »Le nozze di Figaro«, 1976 den Guglielmo, 1986 den Papageno und 1990 den Beckmesser; er gab an der Scala 1972, 1974, 1978, 1985-86, 1988, 1990 und 1996 erfolgreiche Liederabenden. Er sang mit dem Ensemble der Münchner Oper 1965 beim Edinburgh Festival in der englischen Erstaufführung der Richard Strauss-Oper »Intermezzo«. Seit 1973 war er auch oft an der Covent Garden Oper London zu hören (1973 als Figaro im »Barbier von Sevilla«, 1977 als Figaro in »Le nozze di Figaro«, 1977-79 und 1983-84 als Eisenstein, 1979 als Guglielmo, 1983 als Papageno und 1990 als Beckmesser). Weitere Gastspiele am Teatro Colón Buenos Aires, bei den Festspielen von Aix-en-Provence (1962 als Don Giovanni), Wiesbaden, Köln, Florenz (1986 als Beckmesser) und Bregenz (Konzert 1976 sowie 1978, 1980 und 1983 Liederabende), in Frankfurt a.M., Stuttgart, Boston, Houston (Texas) und an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg. Er sang am 17.10.1955 in Hamburg in der Uraufführung von E. Kreneks Oper »Pallas Athene weint«, am 22.5.1960, ebenfalls an der Hamburger Staatsoper, in der von H.W. Henzes »Prinz von Homburg«. 1961 gastierte er als Konzertsolist in Tokio, 1962 in Den Haag, Stockholm und Oslo, 1977 in Prag. 1981 trat er in einem Liederabend an der Grand Opéra Paris auf. Seit 1982 Professor an der Musikhochschule Hamburg. Er starb ganz plötzlich im Juli 1998 in Krailling (Oberbayern) an einem Herzinfarkt, nachdem er noch wenige Tage vorher in München ein Konzert gegeben hatte. Seine warme, ausdrucksschöne Baritonstimme erregte auf der Bühne vornehmlich in lyrischen Partien, im Konzertsaal in der überlegenen, tief musikalischen Interpretation des Oratoriums wie namentlich des Liedes Bewunderung. – Sein Sohn Florian Prey (* 1960) schlug auch die Sängerlaufbahn ein und debütierte 1986 an der Wiener Kammeroper.
Viele Schallplattenaufnahmen auf Columbia (»Der Barbier von Bagdad« von Cornelius, »Die Kluge« von Orff, »Ariadne auf Naxos«, »Carmen«, »Le nozze di Figaro«, »Der Barbier von Sevilla«, »Zar und Zimmermann«, Lieder-Zyklen wie Schuberts »Winterreise«), DGG (»Oberon«, »Palestrina« von Pfitzner, »Ariadne auf Naxos«, 8. Sinfonie von G. Mahler), Decca (»Die Zauberflöte«), Philips, Eurodisc (»Carmina Burana«, Matthäuspassion), Orfeo (»Lazarus« von Schubert, »La Traviata«, »Das Liebesverbot« von Richard Wagner), RCA (»Die tote Stadt« von Korngold), CBS (»Schwanda der Dudelsackpfeifer« von Weinberger), HMV-Electrola (»Boccaccio« von F. von Suppé), Dino-Records (Matthäuspassion), Sony (Ein deutsches Requiem von J. Brahms), Melodram (»Intermezzo« von R. Strauss), Capriccio (»Das Nachtlager von Granada« von C. Kreutzer, »Der Trompeter von Säckingen« von V. Nessler). Hinzu tritt eine Fülle von Liedaufnahmen auf verschiedenen Marken, u.a. auf Capriccio (Lieder und Balladen von Carl Loewe) und Denon (»Winterreise« von Schubert, Lieder von R. Schumann, auch Solo in der 8. Sinfonie von G. Mahler); Castle-Video (Matthäuspassion), RCAAriola-Video (Carmina Burana). Frühe Aufnahmen auf Imperial.
Weitere Informationen auf der ihm gewidmeten Homepage: http://www.hermannprey.de/
11.7. Liliane BERTON: 100. Geburtstag
Zunächst studierte sie am Konservatorium von Lille, dann am Conservatoire National in Paris. 1950 kam es zu ihrem Bühnendebüt an der Oper von Marseille als Blondchen in Mozarts »Entführung aus dem Serail«. 1952 kam sie an die Pariser Grand Opéra (Antrittsrolle: Siebel in »Faust« von Gounod). Im gleichen Jahr 1952 wirkte sie an der Opéra-Comique Paris in der Uraufführung der Oper »Dolorès« von Lévy mit. Ihre Karriere entwickelte sich sehr schnell. Sie trat an den beiden großen Opernhäusern der französischen Metropole Paris auf und galt bald als eine der bedeutendsten lyrischen Koloratursopranistinnen, die Frankreich innerhalb ihrer Generation aufzuweisen hatte. Gastspiele in Lyon, Marseille, Lille und auch an ausländischen Bühnen brachten ihr immer neue Erfolge ein. 1961 gab sie Gastspiele in Nordafrika. 1963 sang sie bei den Festspielen von Glyndebourne die Susanna in »Le nozze di Figaro«, 1965 am Teatro Colón Buenos Aires und 1970 am Teatro San Carlos Lissabon in »Dialogues des Carmélites« von Fr. Poulenc, 1967 an der Oper von Monte Carlo in »The Telephone« von Gian Carlo Menotti. Sie trat auch gastweise an den Opernhäusern von Toulouse und Bordeaux, in Rio de Janeiro und London, in Holland und in der Schweiz auf. In ihrem Repertoire standen an erster Stelle Rollen wie der Cherubino in »Le nozze di Figaro«, die Rosina im »Barbier von Sevilla«, die Titelheldin in »Les Noces de Jeannette« von Massé, die Eurydice in »Orfeo ed Euridice« von Gluck und die Marguerite in »Faust« von Gounod. 1957 sang sie an der Grand Opéra in der Erstaufführung der Oper »Dialogues des Carmélites« von Poulenc die Partie der Constance, 1957 wie 1968 die Sophie im »Rosenkavalier«. Auch als Konzertsängerin schätzte man sie allgemein. Sie wirkte später als Pädagogin am Conservatoire National de Paris. Sie starb 2009 in Paris.
Die Künstlerin hat auf der Schallplatte eine Reihe vollständiger Opern gesungen: auf Pathé (»Der Barbier von Sevilla«, »Werther« von Massenet, Eurydice in »Orfeo ed Euridice« von Gluck, »Les Noces de Jeannette« von Massé), auf HMV (»Faust«, »Dialogues des Carmélites« von Poulenc), EMI (Hélène in »Une Education manquée« von Chabrier), auf Philips, auf Concert Hall und auf Pleïade. Sehr viele Operettenquerschnitte auf Decca-Oméga (u.a. auch die Opern »Si j’étais Roi« von Adam und »Les Dragons de Villars« von Maillart).
11.7. Adolphe SAMUEL: 200. Geburtstag
Er begann seine musikalische Ausbildung am Konservatorium seiner Geburtsstadt Lüttich bei Louis-Joseph Daussoigne-Méhul und in der Klavierklasse von Étienne Soubre. 1838 verzog seine Familie nach Brüssel, wo er gemeinsame Auftritte mit Charles de Bériot und der Sängerin Paulina García hatte. Ab 1839 studierte er auf Anraten von François-Joseph Fétis am Brüsseler Konservatorium Klavier bei Jean-Baptiste Michelot, Harmonielehre bei Charles Bosselet, Orgel bei Christian Friedrich Girschner sowie Kontrapunkt und Fuge bei Fétis. 1845 gewann er mit der Kantate La Vendetta den belgischen Prix de Rome. Auf der damit verbundenen Studienreise suchte er Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig, Giacomo Meyerbeer in Berlin und Ferdinand Hiller in Dresden auf. Über Stationen in Prag und Wien erreichte er Ende 1846 Rom. Dort entstanden unter anderem seine Opera seria Giovanni da Procida und seine Zweite Sinfonie, die nach seiner 1849 erfolgten Rückkehr nach Brüssel, durch Fétis aufgeführt wurde. Im gleichen Jahr fand die Uraufführung seiner Oper Madelaine statt. Die sinfonische Dichtung Roland à Ronceveaux wurde bei einer Sitzung der Königlichen Akademie des Beaux Arts 1850 aufgeführt. Im Folgejahr begann er im Auftrag der belgischen Regierung mit der Arbeit an der komischen Oper Les deux prétendants. Zum 25. Jahrestag der Krönung von Belgiens erstem König Leopold von Sachsen-Coburg 1856 komponierte er die Kantate L’union fait la force. Eine Kantate zur Einweihung der Kongresssäule in Brüssel wurde mit 2500 Choristen und Instrumentalisten aufgeführt. Seit 1853 verband Samuel eine Freundschaft mit Hector Berlioz, nachdem er als Kritiker der Zeitung Le Télégraphe, der Londoner Uraufführung von dessen Oper Benvenuto Cellini beigewohnt und im Gegensatz zur verbreiteten Meinung der Musikkritik das Werk gelobt hatte. Nach einer Zeit als Korrepetitor in Solfège- und Klavierklassen wurde er 1860 Professor für Harmonielehre am Brüsseler Konservatorium. 1865 gründete er in Brüssel nach dem Vorbild von Jules Pasdeloup eine Konzertreihe, die den musikalischen Bildungsstand des Volkes erhöhen und das Interesse für gute Musik verbreiten sollte. Im Rahmen der Reihe wurden neben Werken zeitgenössischer Komponisten und von Berlioz Kompositionen von Peter Benoit, Léon de Burbure, François-Joseph Fétis, Gustave Huberti und Henri Vieuxtemps aufgeführt. Es traten Anton Rubinstein als Dirigent und Musiker wie Clara Schumann und Joseph Joachim als Solisten auf. Nachdem er 1871 Direktor des Konservatoriums von Gent wurde, musste er seine Concerts populaires aufgeben. Im Rahmen der Konservatoriumskonzerte an seiner neuen Wirkungsstätte, fanden vor allem seine Wagner-Aufführungen Beifall. Samuels bedeutendste Werke waren seine letzten beiden Sinfonien. Die Sechste, die als dritte Fassung der Zweiten Sinfonie über einen Zeitraum von 45 Jahren entstand, sollte als Symphonie à programme die Menschheitsgeschichte mit musikalischen Mitteln darstellen. Sie wurde bei einem Konzert des Konservatoriums von Gent Ende 1889 uraufgeführt. Die Siebente Sinfonie als Symphonie mystique trug den Titel Christus. 1874 wurde er zum Mitglied der Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique gewählt. Er starb 1898 in Gent. Auch Adolphe Samuels Sohn Eugène Samuel-Holeman (1866–1942) wurde als Pianist und avantgardistischer Komponist bekannt, der bereits vor Arnold Schönberg die Atonalität anwandte.
12.7. Brünnhild FRIEDLAND: 100. Geburtstag
Sie war an der Dresdner Musikakademie Schülerin von Eduard Plate und von J.H. Eduard. 1947 Debüt an der Volksoper Dresden als Leonore im »Troubadour«; 1948-50 in Görlitz, 1950-69 an der Staatsoper Dresden verpflichtet. Hier hatte sie eine große Karriere und sang u.a. die Agathe im »Freischütz«, die Elisabeth in »Tannhäuser«, die Elsa in »Lohengrin«, die Desdemona in »Otello«, die Isolde in »Tristan und Isolde« und die Marschallin im »Rosenkavalier«. 1951 und 1953 wirkte sie bei den Festspielen von Bayreuth als Gerhilde in der »Walküre« mit, wie sie denn überhaupt als begabte Wagner-Interpretin galt. Nach einem kurzen Aufenthalt in Westdeutschland kam sie 1970 wieder in die DDR zurück, wo sie noch Gastspiele (Leipzig, Dresden) gab. Später lebte sie wieder in Westdeutschland. Sie starb 1986 in Hamburg.
Einige Aufnahmen bei Eterna (Querschnitt durch Verdis »Otello«), Columbia (3. Akt »Walküre« aus Bayreuth, 1951).
13.7. Christa-Maria ZIESE: 100. Geburtstag
Ihre Lehrer waren die Pädagogen Gottlieb Zeithammer und Josef-Maria Hausschild in Leipzig. Sie gewann den Bach-Gesangwettbewerb in Dresden und den internationalen Concours von Prag (1949). Bühnendebüt 1947 an der Oper von Leipzig als Hänsel in »Hänsel und Gretel«. Sie war dann bis 1951 und wiederum 1954-77 hoch geschätztes Mitglied dieses Opernhauses, gastierte aber gleichzeitig an den Staatsopern von Dresden und Berlin und an der Komischen Oper Berlin. 1952-54 war sie am Nationaltheater von Weimar engagiert Erfolgreiche Gastspiele am Moskauer Bolschoi Theater, an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg, an den Opernhäusern von Hamburg, Hannover, Zürich, Brno (Brünn) und Nizza. Ihre groß dimensionierte, von besonderer Ausdruckskraft getragene Sopranstimme erreichte ihre besten Leistungen im hochdramatischen Repertoire (Leonore in »Fidelio«, Santuzza in »Cavalleria rusticana«, Salome, Aida, Tosca, Carmen, Turandot von Puccini, Senta in »Der fliegende Holländer«, Isolde in »Tristan und Isolde«, Venus in »Tannhäuser«). Auch im Konzertsaal hatte die Künstlerin große Erfolge. Sie starb 2012 in Meiningen. Sie war verheiratet mit dem Bass-Bariton Rainer Lüdeke (1927-2005), der ebenfalls am Opernhaus von Leipzig wirkte.
Schallplatten: Eterna.
13.7. Carlo BERGONZI: 100. Geburtstag
Studium bei Maestro Grandini und am Konservatorium von Parma. Während seines Studiums wurde er wegen antifaschistischer Tätigkeit verhaftet. Im Zweiten Weltkrieg wurde er zur italienischen Armee eingezogen und kam 1943 in ein deutsches Internierungslager. Er konnte erst nach Kriegsende seine Ausbildung beenden. Er war u.a. auch Schüler des Pädagogen Francesco Carrino in Triest. Debüt im Baritonfach 1947 in Catania als Schaunard in Puccinis »La Bohème«. 1948 begann er seine eigentliche Karriere am Stadttheater von Lecce als Titelheld in Rossinis »Barbier von Sevilla«. Er sang drei Jahre lang im Bariton-Fach, wurde dann Tenor und debütierte als solcher 1951 am Teatro Petruzzelli in Bari als Titelheld in »Andrea Chénier« von Giordano. 1951 sang er die Tenor-Partien in einem Zyklus von Verdi-Opern, die der italienische Rundfunk anlässlich der Verdi-Gedenkfeiern sendete. Dann Gastspiele in Neapel, Brescia und Rom, schließlich seit 1953 große Erfolge an der Mailänder Scala, wo er am 25.3.1953 in der Uraufführung der Oper »Masaniello« von Jacopo Napoli (in der Titelrolle) debütierte. Er kam an der Mailänder Scala zu einer sehr erfolgreichen Karriere und sang dort 1955 und 1965 den Alvaro in »La forza del destino«, 1956 den Gabriele Adorno in »Simon Boccanegra«, 1963, 1965 und 1976 den Radames in »Aida«, 1963-64 und 1967 das Tenor-Solo im Verdi-Requiem, 1964 den Faust in A. Boitos »Mefistofele« und den Edgardo in »Lucia di Lammermoor«, 1964 und 1967 den Manrico im »Troubadour«, 1966 den Nemorino in »L’Elisir d‘amore« und 1968 den Riccardo in Verdis »Un ballo in maschera« sowie 1983 und 1993 sehr erfolgreiche Liederabende. Weitere Gastspiele am Teatro Colón von Buenos Aires und an der Hamburger Staatsoper. Er bereiste Spanien, Portugal, England, Frankreich und Südamerika. 1953 sang er am Stoll Theatre London den Alvaro, seit 1962 regelmäßig an der Covent Garden Oper London zu hören (Antrittsrolle: gleichfalls Alvaro). Er trat an der Londoner Covent Garden Oper bis 1985 u.a. auch als Manrico, als Riccardo, als Rodolfo in »Luisa Miller« von Verdi und als Edgardo auf. Sein US-Debüt fand an der Oper von Chicago 1955 statt, als er an einem Abend den Luigi in Puccinis »Il Tabarro« und den Turiddu in »Cavalleria rusticana« sang. 1956 wurde er an die Metropolitan Oper New York berufen (Antrittsrolle: Radames). Hier wurde er bis 1988 in insgesamt 324 Aufführungen in 22 Rollen gefeiert: als Manrico, als Cavaradossi in »Tosca«, als Rodolfo in »La Bohème«, als Don José in »Carmen«, als Alvaro, als Andrea Chénier, als Edgardo, als Pinkerton in »Madame Butterfly«, als Des Grieux in Puccinis »Manon Lescaut«, als Canio im »Bajazzo«, als Gabriele Adorno, als Riccardo, als Ernani, als Herzog in »Rigoletto«, als Nemorino, als Enzo in »La Gioconda«, als Pollione in Bellinis »Norma«, als Alfredo in »La Traviata«, als Turiddu und als Rodolfo in Verdis »Luisa Miller«. Ostern 1964 sang er dort im Verdi-Requiem zum Gedächtnis des amerikanischen Präsidenten Kennedy. 1959 erschien er in der Premiere von Verdis »Macbeth« als Macduff. 1981 feierte man seine 25jährige Zugehörigkeit zur Metropolitan Oper mit einer Gala-Soirée. 1996 trat er letztmalig in einem Gala-Konzert für James Levine an der Metropolitan Oper auf. 1958-78 wirkte er bei den Festspielen von Verona mit und trat 1990 nochmals dort auf. An der Wiener Staatsoper, an der er 1959 als Radames debütierte, sang er bis 1988 in insgesamt 38 Vorstellungen außerdem noch den Andrea Chénier, den Canio, den Rodolfo in »La Bohème«, den Turiddu, den Alvaro, den Riccardo, den Pinkerton, den Cavaradossi, den Manrico und den Edgardo. 1970 übernahm er bei den Festspielen von Salzburg das Tenor-Solo im Verdi-Requiem. 1985 sang er in der New Yorker Carnegie Hall den Oronte in einer konzertanten Aufführung von Verdis »I Lombardi«. Noch 1999 gab er am Teatro Verdi in Carrara ein Konzert. 2000 sang er in der Carnegie Hall in New York, inzwischen 75 Jahre alt, die Titelrolle in einer konzertanten Aufführung von Verdis »Otello«, musste die Aufführung aber im 2. Akt abbrechen. Im Juli 2000 gab er in Wien, im September in Zürich einen Liederabend. Er starb 2014 in Mailand.
Seine klangschöne Stimme und sein nuancenreicher musikalischer Vortrag wurden vor allem im Verdi-Repertoire geschätzt. Nach Beendigung seiner Karriere eröffnete er ein Hotel und ein Restaurant in Busseto, dem Geburtsort von Giuseppe Verdi, betätigte sich dort aber auch als Gesangspädagoge.
Lit: R. Celletti: Le grandi Voci (Rom, 1964).
Zahlreiche Schallplattenaufnahmen auf Cetra (»I Pagliacci«, »Simon Boccanegra«), Decca (»Aida«, »Don Carlos« von Verdi, »La Traviata«, »Adriana Lecouvreur« von Cilea), DGG (»Il trovatore«, »Cavalleria rusticana«, »Rigoletto«), RCA (»Luisa Miller«, »Edgar« von Puccini, »Un ballo in maschera«, »Ernani«, »Macbeth«, »Lucia di Lammermoor«, »La Traviata«), Morgan (»I due Foscari« von Verdi), EJS (»Giovanna d’Arco« von Verdi), Philips (»Attila« und »I Masnadieri« von Verdi), Orfeo (»Oberto« von Verdi), Harmonia mundi, CBS (»Edgar« von Puccini), Melodram (»Werther« von Massenet), JPC (»Lucia di Lammermoor«), Capriccio (Belcanto-Kanzonen), Relief/Helikon (Aufnahme eines Lieder- und Arienabends vom 30.9.1991 im Opernhaus von Zürich), Myto (Alvaro in »La forza del destino«), Gala (Enzo in Ausschnitten aus »La Gioconda«, Metropolitan Oper New York 1979); Hardy-Video (»Aida«, Verona 1966). Im Christophorus-Verlag erschienen Alben mit Barock-Arien und neapolitanischen Liedern.
14.7. Benito MARESCA: 90. Geburtstag
Schüler von Marcel Klass in São Paulo. Bühnendebüt 1965 am Opernhaus von São Paulo als Turiddu in »Cavalleria rusticana«. Er gehörte bald zu den bekanntesten brasilianischen Sängern seiner Generation und wurde vor allem an den Opernhäusern von São Paulo und Rio de Janeiro in großen Aufgaben herausgestellt. Gastspiele führten den Künstler an die Staatsopern von München und Stuttgart, an das Teatro San Carlo Neapel, an die Opernhäuser von Frankfurt a.M., Mannheim, Graz und Palermo. Er trat 1975-76 an der Wiener Staatsoper als Turiddu und als Pinkerton in »Madame Butterfly« auf. Er sang das klassische italienische Repertoire für Tenor, vor allem Verdi- und Puccini-Partien, den Pollione in »Norma« von Bellini, den Don José in »Carmen«, den Pery in »Il Guarany« von Carlos Gomes, den Americo in »Lo Schiavo« und den Fernando in »Colombo« vom gleichen brasilianischen Komponisten. Nicht weniger erfolgreich als Konzertsolist. Er starb 2011 in São Paulo.
Aufnahmen auf privaten Marken aus Brasilien.
14.7. Piero BELLUGI: 100. Geburtstag
Er studierte zunächst Violine in Florenz. Dann studierte er Komposition bei Luigi Dallapiccola und Ronerto Lupi und Dirigieren bei Paul van Kempen und Igor Markevitch. Er vertiefte seine Dirigentenausbildung bei Rafael Kubelik und Leonard Bernstein. 1956-58 war Bellugi Lehrer an der University of California, Berkeley. 1958-59 war er Dirigent des Oakland Symphony Orchestra. 1959-61 war er künstlerischer Direktor und Dirigent des Protland Symphony Orchestra. 1961 kehrte er nach Europa zurück. Er wirkte hier als Gastdirigent bedeutender Konzertorchester und Opernhäuser. Er wurde künstlerischer Leiter des Lissaboner Radioorchester. 1969 wurde er zum Chefdirigenten des Orchestra Sinfonica della RAI di Torino ernannt. An der Wiener Staatsoper dirigierte er 1981-86 insgesamt 9 Vorstellungen von Bellinis I Capuleti e i Montecchi. Er starb 2012 in Florenz.
Weitere Informationen auf seiner Homepage: http://www.pierobellugi.com/
14.7. Ida CANASI: 125. Geburtstag
Nach einer ersten Ausbildung in der argentinischen Hauptstadt kam sie zur Ergänzung dieses Studiums nach Italien. Hier debütierte sie 1915 am Teatro Sociale von Treviso. Sie trat an weiteren Bühnen in Italien auf, kehrte aber aufgrund der politischen Lage während des Ersten Weltkrieges nach Argentinien zurück. Seit 1916 war sie für rund 15 Jahre am Teatro Colón von Buenos Aires tätig, wo zu ihren Rollen die Maddalena in »Rigoletto«, die Cieca in »La Gioconda« von Ponchielli, der Madrigalist in »Manon Lescaut« von Puccini, die Mignon in der gleichnamigen Oper von Thomas, die Albine in »Thaïs« von Massenet, die Wirtin in »Boris Godunow« und die Fricka in der »Walküre« gehörten. Sie gab auch Gastspiele an anderen Bühnen in Südamerika, so 1917 und 1918 an der Oper von Rio de Janeiro. Später wirkte sie als Pädagogin in Buenos Aires.
14.7. Erika ROKYTA: 125. Geburtstag
Tochter eines österreichisch-ungarischen Offiziers, der 1916 im Ersten Weltkrieg fiel. Der Bruder ihrer Großmutter war der berühmte Bariton Hans Feodor von Milde (1821-99), der lange Jahre in Weimar wirkte und in der dortigen Uraufführung von Wagners »Lohengrin« 1850 unter der Leitung von Franz Liszt den Telramund sang, während seine Gattin, die Sopranistin Rosa Agthe-Milde (1827-1906) die Elsa kreierte. Die Künstlerin verbrachte ihre Jugend in Wien, studierte dort Klavierspiel und Gesang und erwarb 1919 ihr Staatsdiplom als Musiklehrerin. In einem Singverein in Wiener Neustadt erregte ihre schöne Stimme Aufsehen, die dann durch Frau Singer-Burian weitergebildet wurde. 1925 gab sie ihren ersten Liederabend und begann eine Karriere als Oratorien- wie als Liedersängerin. 1933 erregte sie großes Aufsehen, als sie in Wien unter Bruno Walter ein Sopransolo in der 8. Sinfonie von Gustav Mahler vortrug. Sie wurde bald eine der bedeutendsten Konzertsopranistinnen für den deutschen Sprachraum, wobei ihre Stimme einerseits durch eine ungewöhnliche Schönheit in den hohen Lagen, anderseits durch ihre Ausdruckskraft und ihre Tonfülle ausgezeichnet war. In Wien nahm sie ihren Wohnsitz, wo sie Jahre hindurch bei den großen Konzertveranstaltungen auftrat, u.a. bei den Bruckner-Festen von 1936, 1946 und 1949, in der Uraufführung des Oratoriums »Das Buch mit sieben Siegeln« von Franz Schmidt 1938, unter Dirigenten wie Hans Knappertsbusch, Bruno Walter, Richard Strauss, Erich Leinsdorf und vielen anderen, in zahllosen Liederabenden und Rundfunksendungen. Bei den Salzburger Festspielen sang sie 1933 in »Ein deutsches Requiem« von Brahms und in Mozarts C-Moll-Messe, 1935 in einem Mozart-Konzert, 1936 in »Christus« von Liszt und in einem Kirchenkonzert, 1937, 1947-48 und 1951 in weiteren Konzerten. Immer wieder gab sie Konzerte in Berlin, Köln und Hamburg, in Paris und zusammen mit dem Straßburger Domchor, in Dänemark und Schweden; in der Leipziger Thomaskirche trat sie als Bach-Interpretin hervor; weitere Konzerte in Brüssel, Zürich, Bern, Basel, Belgrad, Dresden, Graz und Danzig. Dabei enthielt ihr Repertoire alle großen klassischen Oratorienpartien in Werken von J.S. Bach, Händel, J. Haydn, Mozart, Beethoven, Johannes Brahms, Mendelssohn, Gustav Mahler bis hin zu zeitgenössischen Komponisten. Vortreffliche Leistungen im Liedgesang. Auf der Bühne trat sie nicht in Erscheinung, sang aber (vor allem Mozart-) Opernarien bei ihren Konzerten. 1948-52 Lehrerin am Konservatorium von Saarbrücken, 1959-64 Leiterin einer Liedklasse am Wiener Konservatorium, nachdem sie etwa 1955 ihre Karriere beendet hatte. Sie starb 1985 in Wien.
Schallplatten der Marke Oiseau Lyre (Lieder von Schumann und Hugo Wolf, Oratorien- und geistliche Musik).
15.7. Harrison BIRTWISTLE: 90. Geburtstag
Er studierte ab 1952 Klarinette und Komposition am Royal Northern College of Music in Manchester. Zusammen mit den Komponisten Peter Maxwell Davies, Alexander Goehr, John Ogdon und Elgar Howarth gründete er die New Music Manchester, eine Gemeinschaft von Komponisten und Musikern, die sich der Aufführung serieller und anderer zeitgenössischer Musik widmete. Birtwistle arbeitete als Musiklehrer und setzte sein Studium in den USA fort. 1975 wurde er musikalischer Leiter des neugegründeten Royal National Theatre in London und war in dieser Position bis 1988. 1994-2001 hatte er den Lehrstuhl Henry Purcell Professor for Composition am King’s College London inne und wurde dort von George Benjamin abgelöst. Birtwistle komponiert in einem komplexen, modernistischen Stil. Seine frühen Werke sind von Igor Strawinsky und Olivier Messiaen beeinflusst, und seine Nebeneinanderstellung von Klangblöcken wird mit Kompositionen Edgar Varèses verglichen. Birtwistle erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Grawemeyer Award 1986, den Siemens Musikpreis 1995 sowie den British Order oft he Companions of Honour 2001. Er wurde 1986 zum Chevalier des Arts et des Lettres und 1988 in den britischen Adelsstand erhoben. Im Jahr 2003 erhielt er den renommierten Music Award der Royal Philharmonic Society in London. Die University of Cambridge verlieh ihm 2010 die Ehrendoktorwürde. 2015 wurde Birtwistle mit dem Wihuri-Sibelius-Preis ausgezeichnet. Ab 2007 war er auswärtiges Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Letters. Er starb 2002 in Mere (Wiltshire).
15.7. Charles ANTHONY: 95. Geburtstag
Er studierte zuerst an der Loyola University New Orleans bei Dorothy Hulse, dann im Opernstudio der Metropolitan Oper New York. 1952 gewann er den Gesangwettbewerb der New Yorker Metropolitan Oper Auditions of the Air und erhielt ein Stipendium für seine weitere Ausbildung in Italien, wo er Schüler von Riccardo Picozzi und Giuseppe Ruisi war. 1954 kam er in die USA zurück. Noch im gleichen Jahre debütierte er an der Metropolitan Oper New York als Gottesnarr im »Boris Godunow«. In den folgenden 55 Jahren war er dort sehr erfolgreich, vor allem in den leichteren lyrischen Partien und als Spieltenor. So sang er an der Metropolitan Oper u.a. den Beppe im »Bajazzo«, den Grafen Almaviva im »Barbier von Sevilla«, den Incroyable in »Andrea Chénier«, die vier Dienerrollen in »Hoffmanns Erzählungen«, den Arturo in »Lucia di Lammermoor«, den Ernesto in »Don Pasquale«, den Edmondo in Puccinis »Manon Lescaut«, den David in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den Andres in »Wozzeck« von A. Berg, den Jaquino in »Fidelio«, den Don Ottavio in »Don Giovanni«, den Matteo in »Arabella« von R. Strauss, den Nemorino in »L’Elisir d’Amore«, den Ferrando in »Così fan tutte«, den Steuermann in »Der fliegende Holländer« und den Goro in »Madame Butterfly«. In erster Linie übernahm er jedoch an der Metropolitan Oper kleinere und Comprimario-Partien aus allen Bereichen der Opernliteratur; er ist an diesem Haus in 57 Spielzeiten in 111 Rollen in 69 Opern in insgesamt 2928 Vorstellungen aufgetreten; am 28. Jänner 2010 gab er an der New Yorker Metropolitan Oper als Kaiser in Puccinis »Turandot« seine Abschiedsvorstellung. Er trat als Gast an Opernhäusern in Nordamerika (Boston, Dallas, Santa Fé) wie in Europa auf; dazu war er ein gesuchter Konzertsänger. Er starb 2012 in Tampa (Florida).
Schallplatten: RCA (Querschnitt »Don Pasquale« und »Hoffmanns Erzählungen«), Melodram (Beppe im »Bajazzo«), Gala (Bote in »Aida«, Metropolitan Oper New York 1976), Myto (»Roméo et Juliette« von Gounod, Metropolitan Oper 1973).
16.7. Ondina OTTA KLASINC: 100. Geburtstag
Die Künstlerin war in Triest Schülerin von Luigi Toffolo. 1946 debütierte sie am Opernhaus von Ljubljana (Laibach) als Rosina in Rossinis »Barbier von Sevilla«. 1946-51 war sie Mitglied dieses Theaters und gastierte seitdem, vor allem an italienischen Bühnen (so 1955 in Turin), 1956 in London, 1962 am Théâtre de la Monnaie Brüssel. Sie gastierte 1956 am Teatro Verdi Triest, 1957 an der Oper von Monte Carlo. Auch in Frankreich, in Österreich, in Ägypten und in Südamerika trat sie als Bühnen- wie als Konzertsängerin auf. 1958-72 war sie am Opernhaus von Maribor (Marburg a. d. Drau) engagiert. Ihr Bühnenrepertoire hatte seine Höhepunkte in Partien wie der Gilda in »Rigoletto«, der Violetta in »La Traviata«, der Marguerite in »Faust« von Gounod, der Marzelline in »Fidelio«, der Mimi wie der Musetta in Puccinis »La Bohème« und der Rusalka in der Märchenoper gleichen Namens von Dvorák. Sie war später Präsidentin des Komitees eines nach ihr benannten Gesangwettbewerbs. Sie starb 2016 in Maribor.
16.7. Zdeněk ŠVEHLA: 100. Geburtstag
Er begann seine Ausbildung an der Janácek-Akademie in Brno bei Bohumil Sobeský und vollendete sie als Schüler von Apollo Granforte in Mailand und von Carlo Polacco in Venedig. Debüt 1951 am Opernhaus von Olomouc (Olmütz) als Gabriele Adorno in »Simon Boccanegra« von Verdi. Er war dann für viele Jahre eines der prominentesten Mitglieder des Nationaltheaters von Prag. Große Erfolge bei internationalen Gastspielen; so war er zu Gast an der Wiener Staatsoper (1967 als Hans in Smetanas »Die verkaufte Braut«), am Gran Teatre del Liceu in Barcelona, an der Oper von Brüssel, an den Nationalopern von Bukarest, Belgrad und Zagreb, in Zürich, Bologna und Neapel. Er beherrschte ein weit gespanntes Rollenrepertoire, das Partien in Opern von Verdi, Mozart, Smetana, Janácek, Tschaikowsky, Prokofjew, Puccini, R. Strauss und Moniuszko enthielt. In einer Verfilmung von Dvoráks Oper »Rusalka« stellte er den Prinzen dar. Er starb 2014 in Prag.
Schallplatten: Supraphon (»Dalibor« und »Zwei Witwen« von Smetana, Oratorium »Die heilige Ludmilla« von Dvorák), Decca (»Katja Kabanowa«, »Die Sache Makropulos«, »Aus einem Totenhaus«, alle von Janácek).
17.7. Michael THEODORE: 85. Geburtstag
Erste Ausbildung durch den Pädagogen Liondas in seiner Heimat, dann an der Wiener Musikakademie, schließlich bei Alfred Knopf in München. 1967 gewann er bei einem Gesangwettbewerb des Süddeutschen Rundfunks den ersten Preis und debütierte darauf an der Staatsoper von Stuttgart. Nachdem er bereits in Griechenland einzelne Konzerte gegeben hatte, widmete er sich jetzt in erster Linie dem Konzertgesang, wobei er ein umfangreiches Repertoire von altitalienischen Arien über Opernfragmente und Szenen aus Operetten bis zu griechischen und deutschen Liedern zu Gehör brachte. Allgemein bekannt wurde er durch seine schönen Schallplattenaufnahmen, die zuerst bei Intercord, seit 1970 exklusiv bei Ariola-Eurodisc herauskamen. Hier werden alle Vorzüge seines strahlenden, im Ausdruck fein abgestuften Tenors deutlich. Konzert-Tourneen trugen ihm in den deutschen Musikzentren, in Holland, in seiner griechischen Heimat wie auch in Nordamerika Erfolge ein. Er starb im Dezember 2015.
17.7. Lilian BENNINGSEN: 100. Geburtstag
Sie erhielt ihre Ausbildung in Wien durch die bekannten Pädagoginnen Anna Bahr-Mildenburg und Elisabeth Rado. 1947 gewann sie den ersten Preis im Gesangwettbewerb der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde. Darauf kam es 1948 zu ihrem Bühnendebüt am Landestheater von Salzburg als Bostana im »Barbier von Bagdad« von P. Cornelius. Es schlossen sich Engagements am Stadttheater von Göttingen und an der Oper von Köln (1950-52) an. 1951 gastierte sie an der Staatsoper von München als Eboli in Verdis »Don Carlos«. Der Erfolg war so groß, dass sie an diese Bühne verpflichtet wurde, deren Mitglied sie für lange Jahre blieb. Neben Partien wie der Fricka im Ring-Zyklus, der Carmen, der Amneris in »Aida« waren weitere Höhepunkte in ihrem umfangreichen Bühnenrepertoire der Octavian im »Rosenkavalier«, die Dorabella in »Così fan tutte« und die Marzelline in »Le nozze di Figaro«. Sie gastierte an der Wiener Staatsoper (1956 als Amneris, 1956-61 als Octavian und 1973 als alte Buryja in Janáceks »Jenufa«) und bei den Festspielen von Salzburg (1947 in Haydns Harmoniemesse, 1955 in einem Mozart-Konzert, am 17.8.1955 in der Uraufführung der Oper »Irische Legende« von W. Egk als 2. Eule und 1965 in »La Betulia liberata« von Mozart), in London, Lissabon und beim Festival von Athen. An der Covent Garden Oper London sang sie 1953 in der englischen Erstaufführung der Richard Strauss-Oper »Die Liebe der Danaë«. 1953 gastierte sie am Stadttheater (Opernhaus) von Zürich in der Schweizer Erstaufführung der Oper »Die Liebe der Danaë« von Richard Strauss als Alkmene, 1954 in »Salome« vom gleichen Komponisten, 1955 als Amneris. Bei den Schwetzinger Festspielen von 1961 wirkte sie in der Uraufführung der Oper »Elegie für junge Liebende« von H.W. Henze mit, 1969 an der Münchner Oper in der von »Aucassin und Nicolette« von G. Bialas, zuvor bereits 1960 in »Seraphine oder die stumme Apothekerin« von Heinrich Sutermeister. Gleichzeitig hatte sie eine bedeutende Karriere als Konzert- und Liedersängerin. Sie starb 2014 in München. – Sie war verheiratet mit dem Opernsänger Hans Reischl.
Schallplatten: DGG (»Le nozze di Figaro«, »Tentation de Saint Antoine« von Egk), Decca, Eurodisc (Magdalene in »Die Meistersinger von Nürnberg« unter Keilberth), RAI-Electrola (»Die Walküre«, Rom 1953). Auf EJS ist sie in den vollständigen Opern »Ariadne auf Naxos« und »Die tote Stadt« von Korngold zu hören.
17.7. Wilhelm JOST: 175. Geburtstag
Er war zunächst Chorist am Stadttheater (Opernhaus) von Hamburg, bildete dann aber seine Stimme weiter aus und erhielt 1877 ein Solisten-Engagement am Stadttheater von Bremen. Dort blieb er bis 1883 und sang darauf 1883-84 am Theater von Königsberg (Ostpreußen) und 1884-88 an der Dresdner Hofoper. Bei Gastspielen trat er u.a. an der Berliner Hofoper (1883) und am Opernhaus von Leipzig auf. Er musste jedoch krankheitshalber bereits 1888 seine Bühnenlaufbahn beenden. Einige seiner Opernpartien seien aus einem umfangreichen Repertoire aufgeführt: der Basilio im »Barbier von Sevilla«, der Bartolo in »Die Hochzeit des Figaro«, der Mathisen in Meyerbeers »Der Prophet«, der Lefort in »Zar und Zimmermann« von Lortzing und der Raimundo in »Rienzi« von Richard Wagner. Er starb 1916 in Dresden.
18.7. Eva ILLES: 95. Geburtstag
Die aus Ungarn stammende Sängerin erhielt dort ihre Ausbildung und begann auch ihre Karriere in Ungarn. 1967 kam sie nach Westdeutschland und wurde für zwei Jahre (1967-69) an das Stadttheater von Regensburg engagiert. Sie ging dann an das Stadttheater von Freiburg i.Br. (1969-71) und war 1971-75 Mitglied des Opernhauses von Zürich. 1974-81 war sie gleichzeitig Mitglied des Staatstheaters Hannover und sang dann noch während der Spielzeit 1981-82 am Opernhaus von Frankfurt a.M. Während der siebziger Jahre bestanden Gastspielverträge mit dem Opernhaus von Nürnberg, für die Jahre 1973-75 auch mit den Staatsopern von Hamburg und Stuttgart. Sie gab Gastspiele u.a. an der Wiener Staatsoper (1971 als Ariadne auf Naxos in der Oper gleichen Namens von R. Strauss), an der Griechischen Nationaloper Athen (als Senta in »Der fliegende Holländer«), an der Covent Garden Oper London (1972 als Senta) und am Gran Teatre del Liceu in Barcelona (1979). Sie trat vor allem in jugendlich-dramatischen Sopranpartien auf, darunter als Elsa in »Lohengrin«, als Elisabeth wie als Venus (zum Teil als Doppelrolle in der gleichen Vorstellung) in »Tannhäuser«, als Amelia in Verdis »Simon Boccanegra«, als Leonore im »Troubadour«, als Elena in »I Vespri Siciliani« von Verdi, als Maddalena in »Andreas Chénier« von Giordano und als Turandot von Puccini. Sie starb 2010 in Wien. Sie war verheiratet mit dem ungarischen Bassisten István Trefas, der längere Zeit am Stadttheater von Bremen und dann am Staatstheater von Braunschweig engagiert war.
Schallplatten: Sonopress (Querschnitte »Aida« und »Der Troubadour«), ZYX-Records.
18.7. Oscar BERGSTRÖM: 150. Geburtstag
Er absolvierte seine Studien bei dem Stockholmer Pädagogen Ivar Hallström. 1896 erfolgte sein Bühnendebüt an der Königlichen Oper Stockholm als Lothario in »Mignon« von A. Thomas. 1897-99 war er Mitglied der Stockholmer Oper, wandte sich dann jedoch der Operette zu und sang bis 1918 an verschiedenen Operettentheatern der schwedischen Metropole. 1918 emigrierte er nach Nordamerika, wo er sich als Konzertsänger betätigte. Er starb 1941 in Stockholm.
Von Bedeutung ist vor allem seine Tätigkeit als Schallplattensänger. In der Frühzeit der Schallplatte hat er vor allem durch Aufnahmen schwedischer Lieder große Popularität erlangt. Insgesamt hat er über 400 Schallplattenaufnahmen unter dem Etikett von HMV (auch auf G & T) gemacht. Auch Pathé-Aufnahmen vorhanden, die 1909 in Stockholm aufgenommen wurden, dazu weitere Aufnahmen auf Odeon und Columbia, auch noch elektrische Aufnahmen.
18.7. Anna JUDIC: 175. Geburtstag
Eigentlicher Name Anne Damiens; sie war Schülerin des Conservatoire National Paris und wurde ganz jung 1867 in Paris als Operettensängerin bekannt. Sie trat bereits 1870-71 in Brüssel und 1873 in London auf. Bald kam sie zu einer glanzvollen Karriere an den führenden Pariser Operettenbühnen der damaligen Epoche: am Théâtre Gaité, am Théâtre Palais-Royal, am Théâtre des Variétés, am Théâtre Gymnase, am Théâtre Eldorado, vor allem aber an den von Jacques Offenbach gegründeten und geleiteten Bouffes-Parisiens. Sie wurde eine der großen Interpretinnen der Operetten von Offenbach, der ihre Stimme in einem Pariser Café-Concert entdeckt hatte. In mehreren Uraufführungen seiner Werke stand sie auf der Bühne, darunter in »Madame l’Archiduc« (Bouffes-Parisiens, 31.10.1874) und in »La Créole« (ebenfalls Bouffes-Parisiens, 3.11.1875). Weitere Höhepunkte in ihrem Repertoire waren die Titelfiguren in Offenbachs Operetten »La belle Hélène« und »La Grande Duchesse de Gerolstein«. Sie hatte ihre größten Erfolge in den Uraufführungen der Operetten »Lili« (Théâtre des Variétés Paris, 11.1.1882) und »Mam’zell Nitouche« (Théâtre des Variétés, 26.12.1883) von Hervé; sie trat auch in den Uraufführungen von »La roussotte« (Théâtre des Variétés, Januar 1881) und »Le grand Casimir« (Théâtre des Variétés, 11.1.1879) von Lecocq und »Niniche« von Boullard auf. Auf der Bühne gefiel die Künstlerin durch den leichten, beschwingten Vortrag ihrer Couplets wie durch ihr temperamentvolles Spiel und ihre anmutige Erscheinung. 1875 hatte sie große Erfolge bei Auftritten in der russischen Haupt- und Residenzstadt St. Petersburg. Reynaldo Hahn erinnert sich in seinen »Souvenirs d’un Musicien« an »die Grazie und den Takt« ihrer Bühnenauftritte. Gegen Ende ihrer Karriere war sie sowohl auf dem Gebieten der Operette wie des Schauspiels, aber auch in Café-Concerts, anzutreffen. 1909 verabschiedete sie sich in der Rolle der Großmutter in der Operette »La belle au bois dormant« von Lecocq von der Bühne. Sie starb 1911 in Golfe Juan bei Nizza.
Lit: F. Duquesnel: Anna Judic (in »Le Théâtre«, 1911).
Schallplatten: Es sind Pathé-Zylinder der Künstlerin vorhanden, die 1901-02 in Paris hergestellt wurden, darunter Couplets aus Hervé-Operetten, die sie kreiert hatte.
18.7. Maria Antonia Walpurgis, Kurfürstin von Sachsen: 300. Geburtstag
Sie war die Tochter des Kurfürsten Karl Albrecht von Bayern (der sich bei seinem Anspruch auf den Kaiserthron Karl VII. nannte). 1747 heiratete sie den königlichen Prinzen von Polen und Kurprinzen von Sachsen Friedrich Christian († 1763). Sie war eine ungewöhnlich geistreiche Frau, dazu in vielseitiger Weise künstlerisch begabt. So beschäftigte sie sich mit der Malerei wie der Poesie, in erster Linie aber mit der Musik. Man berichtet von ihr: »Sie sang sehr angenehm und spielte mit Ausdruck und großer Fertigkeit sehr schön das Pianoforte«. Nicht zuletzt war es ihr zu verdanken, dass das Musikleben, und vor allem auch die Oper, in der sächsischen Residenz eine Epoche von besonderem Glanz durchlebte. An führender Stelle wirkte dabei der berühmte Komponist Johann Adolf Hasse, der erstmals 1733 nach Dresden kam und in den Jahren 1734-63 am Hof angestellt war; dessen Gattin Faustina Hasse-Bordoni war bis 1751 als große Primadonna am Dresdner Hoftheater engagiert. Die Kurfürstin schrieb für J.A. Hasse italienische Texte zu Kantaten; sie war dessen Schülerin, wurde aber auch durch Giovanni Battista Ferrandini und durch Nicola Porpora 1747-52 in die Musik eingeführt. Sie komponierte selbst, darunter zwei Opern, »Il trionfo della Fedeltà« (Uraufführung 1754 in Dresden) und »Talestri, Regina delle Amazoni« (Uraufführung 1760 in Nymphenburg, anschließend in Dresden). Bei der Komposition waren ihr Hasse und Ferrandini, in der Abfassung des Librettos Pietro Metastasio, der als der bedeutendste Librettist seiner Generation galt und als Hofdichter am Wiener Kaiserhof lebte, behilflich. Als die berühmte Sängerin Gertrud Elisabeth Mara, damals am Beginn ihrer Karriere stehend, 1767 nach Dresden kam, wählte sie für ihr Debüt die erwähnte Oper der Kurfürstin Maria Antonia »Talestri« aus und wurde von dieser in das Werk eingeführt. Ihre Kompositionen ließ sie unter den Pseudonym E.T.P.A. (Ermelinda Talea Pastorella Arcada) veröffentlichen. Ihr Briefwechsel mit König Friedrich II. von Preußen, der sich über die Jahre 1763-69 erstreckte, enthält interessante Mitteilungen über ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Musik wie allgemein über ihre Musik- und Kunstverständnis. In der gedruckten Partitur zu ihrer Oper »Il trionfo della Fedeltà« befindet sich ihr in Kupfer gestochenes Porträt (Dresden, 1754). Sie starb 1780 in Dresden.
19.7. Amedeo ZAMBON: 90. Geburtstag
Er sang bereits als Knabe in einem Kirchenchor seines Heimatortes Fontana Villorba (nördlich von Venedig) und begann mit 17 Jahren sein Gesangstudium, das er u.a. bei Marcello del Monaco, einem Bruder des berühmten Tenors Mario del Monaco, absolvierte. Nachdem er bereits in der Saison 1960-61 am Teatro Fenice Venedig in Puccinis »La Bohème« debütiert hatte, gewann er Gesangwettbewerbe in Busseto und Parma, schließlich 1965 einen Concours, den das Teatro Fenice Venedig ausgeschrieben hatte. 1962 sang er sehr erfolgreich an der Oper von Istanbul, wo er in den folgenden drei Jahren in Partien wie dem Rodolfo in »La Bohème«, dem Cavaradossi in »Tosca«, dem Calaf in »Turandot«, dem Radames in »Aida«, dem Canio im »Bajazzo« und dem Hans in Smetanas »Die verkaufte Braut« (in türkischer Sprache) auftrat. 1965 begann er dann eine erfolgreiche Karriere an den großen italienischen Opernhäusern, zuerst am Teatro Massimo Palermo, dann am Teatro San Carlo Neapel und an der Mailänder Scala (1968 Calaf, 1970 Demodoco und Tiresia in »Ulisse« von Dallapiccola, 1970 Canio, 1971 Andrej Chowanski in »Chowanschtschina« von Mussorgsky, 1978 Pinkerton in »Madame Butterfly«, 1978 Manrico im »Troubadour«). Er sang als Antrittsrolle an der Wiener Staatsoper 1969 den Canio und trat dort bis 1987 in insgesamt 32 Vorstellungen außerdem als Manrico, als Radames, als Turiddu in »Cavalleria rusticana«, als Calaf, als Cavaradossi, als Dick Johnson in »La Fanciulla del West«, als Andrea Chénier von Giordano und als Otello von Verdi auf. Internationale Gastspielauftritte an der Grand Opéra Paris (1982 als Canio), an den Opern von Monte Carlo, Frankfurt a.M., Hamburg, Stockholm, Lüttich (1981-83) und 1967 bei den Festspielen von Verona. Zur Hundertjahrfeier der Uraufführung von Verdis »Aida« sang er 1970 an der Oper von Kairo den Radames; zum 50. Todestag von Giacomo Puccini trat er in einer Aufführung von dessen Oper »Turandot« in dem Wohnort des Komponisten Torre del Lago als Calaf auf. 1988 Gastspiel an der Deutschen Oper Berlin als Otello von Verdi. Sein Repertoire umfasste 50 große Partien in italienischen und französischen Opern von den Meistern der klassischen Romantik (Rossini, Bellini, Mercadante, Donizetti) bis hin zu zeitgenössischen Komponisten. Im September 1985 hatte er einen seiner größten Erfolge, als er in Bern die Titelpartie in Verdis »Otello« gestaltete. Er starb 2000 in Treviso. Er war seit 1963 verheiratet mit der Sopranistin Diana Jamieson, die mit ihm zusammen zunächst in Istanbul, dann in Italien, namentlich in Opernpartien Puccinis, Mascagnis und anderer italienischer Meister, auftrat.
Schallplatten: MRF (vollständige Opern »Il Pirata« und »La Straniera« von Bellini, beide mit Montserrat Caballé als Partnerin, 1969 New York; weiter »Siberia« und »La cena delle beffe« von Giordano, Mailand 1977; Duette mit Leyla Gencer).
19.7. Amy SHUARD: 100. Geburtstag
Sie war am Londoner Trinity College Schülerin von Ivor Warren. 1949 debütierte sie am Opernhaus von Johannesburg in Südafrika als Aida. Sie sang an der Oper von Johannesburg 1949 auch die Venus in »Tannhäuser« und die Giulietta in »Hoffmanns Erzählungen«. Noch im gleichen Jahr 1949 wurde sie an die Sadler’s Wells Oper London berufen und sang dort als Antrittsrolle die Marguerite in »Faust« von Gounod. Sie trat 1951 an der Sadler’s Wells Opera in der englischen Erstaufführung der Oper »Katja Kabanowa« von Janácek in der Titelrolle auf. Bis 1955 blieb sie Mitglied dieses Opernhauses. 1954-74 war sie als erste dramatische Sopranistin an der Covent Garden Oper London engagiert, wo sie u.a. als Aida, als Freia, als Gerhilde, als 3. Norn, als Sieglinde, als Gutrune und als Brünnhilde im Nibelungenring, als Madame Butterfly, als Giulietta in »Hoffmanns Erzählungen«, als 1. Dame in der »Zauberflöte«, als Lisa in »Pique Dame« von Tschaikowsky, als Amelia in Verdis »Un ballo in maschera«, als Liu wie als Titelheldin in Puccinis »Turandot«, als Cassandre in »Les Troyens« von Berlioz, als Santuzza in »Cavalleria rusticana«, als Lady Macbeth in Verdis »Macbeth«, als Leonore in »Fidelio«, als Frau in dem Monodrama »Erwartung« von A. Schönberg, als Titelheldin in »Elektra« von R. Strauss und als Kundry in »Parsifal« aufgetreten ist. Sie trat auch 1956 an der Covent Garden Opera in der englischen Erstaufführung der Oper »Jenufa« von Janácek in der Titelrolle auf. In späteren Aufführungen von »Jenufa« an der Covent Garden Oper hörte man sie 1972 und 1974 als Kostelnicka. An der Wiener Staatsoper gastierte sie 1961-65 in insgesamt 22 Vorstellungen als Turandot, als Aida, als Brünnhilde in der »Walküre«, als Santuzza und als Amelia in Verdis »Un ballo in maschera«. Weitere Gastspiele an der Mailänder Scala (1962 und 1964 als Turandot, 1968 als Brünnhilde in der »Walküre«), am Teatro Colón von Buenos Aires, an den Opernhäusern von Brüssel und Lüttich und an der Oper von San Francisco (1963 als Brünnhilde in der »Walküre«, 1966 als Titelheldin in »Elektra« von R. Strauss, 1968-69 als Turandot, 1969 als Brünnhilde in »Götterdämmerung«). Bei den Festspielen von Bayreuth des Jahres 1968 sang sie die Kundry. 1972 gastierte sie am Grand Théâtre Genf als Isolde in »Tristan und Isolde«. Sehr große Erfolge erzielte sie auch als Ortrud in »Lohengrin«, als Tatjana in »Eugen Onegin« und als Magda Sorel in Menottis »The Consul«. 1974 gab sie ihre Karriere auf. Sie starb 1975 in London.
Lit: H. Rosenthal: Amy Shuard (in »Opera«, 1960).
Von ihrer groß dimensionierten dramatischen Sopranstimme ist eine Schallplatte mit Opernarien auf HMV vorhanden. Auf Mondo Musica wurde eine vollständige »Parsifal«-Aufnahme aus dem Teatro Fenice Venedig von 1978 publiziert, in der sie als Partnerin von René Kollo die Kundry singt.
19.7. Eugenie BURKHARDT: 125. Geburtstag
Sie wurde zunächst durch Frau Rückbeil-Hiller in Stuttgart, dann durch Jacques Stückgold in München ausgebildet. 1917 begann sie ihre Bühnenlaufbahn als Volontärin am Hoftheater von Karlsruhe. 1919-21 war sie am Theater von Altenburg in Thüringen engagiert, 1921-24 am Stadttheater von Chemnitz. 1924 folgte sie einem Ruf an die Dresdner Staatsoper, an der sie bis 1935 als erste hochdramatische und Wagner-Sopranistin wirkte. 1927 gastierte sie am Stadttheater von Bremen, an der Staatsoper von Wien in den Jahren 1927-28 (als Amme in der »Frau ohne Schatten« von R. Strauss), 1930 (als Titelheldin in »Elektra« von R. Strauss)
und 1933 (als Isolde in »Tristan und Isolde«). In Dresden wirkte sie in der Uraufführung der Oper »Penthesilea« von Othmar Schoeck in der Partie der Meroë mit (8.1.1927), auch in der Uraufführung von »Die Hochzeit des Mönchs« von Alfred Schattmann (19.5.1926); im Rahmen der von Dresden in den zwanziger Jahren ausgehenden Verdi-Renaissance sang sie 1928 die Lady Macbeth in Verdis »Macbeth«. Bei den Festspielen in der Waldoper von Zoppot gastierte sie 1928 als Kundry in »Parsifal«, 1933 als Leonore in »Fidelio« und als Venus in »Tannhäuser«. Aus ihrem Repertoire sind noch zu nennen: die Martha in »Tiefland« und die Alaine in »Revolutionshochzeit« von Eugen d’Albert. Auch als Konzertsopranistin aufgetreten. Sie starb 1976 in Heilbronn.
Schallplattenaufnahmen der Künstlerin sind nicht bekannt.
20.7. Jens-Peter OSTENDORF: 75. Geburtstag
Bereits im Alter von 10 Jahren komponierte er; mit 14 Jahren spielte er seine Kompositionen vor; mit 17 führte er seine erste eigene Komposition öffentlich auf. Nach seinem Abitur am Gymnasium für Jungen in Eppendorf, heute Gymnasium Eppendorf, begann er 1964 mit dem Studium der Musiktheorie und Komposition an der Staatlichen Hochschule für Musik in Hamburg bei Ernst Gernot Klußmann und Diether de la Motte. Außerdem wurde er in Schulmusik und Dirigieren bei Wilhelm Brückner-Rüggeberg ausgebildet. Seine Vorbilder waren György Ligeti, Steve Reich und Luigi Nono. 1968 ermöglichte ihm der Bach-Förderpreis, ein Stipendium der Stadt Hamburg, die Mitarbeit im Kompositionsstudio von Stockhausen und die Teilnahme an dessen Kollektivkomposition „Musik für ein Haus“ in Darmstadt. 1969-78 war er Leiter der Abteilung Bühnenmusik am Thalia Theater Hamburg und gründete im selben Jahr die Gruppe „Hinz & Kunzt“, eines insbesondere der Arbeit Hans Werner Henzes verpflichteten Ensembles für szenische Musik. Innerhalb der Gruppe „Hinz & Kunzt“ engagierte sich Ostendorf besonders bei Henzes Cantiere im toskanischen Montepulciano, wo sich später die Musikhochschule Köln einrichtete. 1972 begann er mit dem Studium der experimentellen Musik und nahm das Studium der experimentellen Phonetik an der Universität Hamburg auf. 1973/74 erhielt er ein Villa-Massimo-Stipendium der Deutschen Akademie in Rom. Dort befreundete er sich mit dem französischen Komponisten Gérard Grisey, Mitbegründer der Gruppe „L’Itinéraire”, deren materialorientierte Ästhetik Ostendorf seither teilte. Die römischen Werkstattgespräche animierten Ostendorf zu einer intensiven Beschäftigung mit den physikalischen Voraussetzungen der Klangfarbe. 1976 folgten weitere Einladungen der Villa Massimo und 1977 ein Arbeitsaufenthalt in die Villa Romana nach Florenz. 1979 löste Ostendorf sein Engagement mit dem Thalia Theater Hamburg und war als freischaffender Komponist tätig.
Zunächst reiste er studienhalber in die Sahara und zur Insel Djerba, machte Tonbandaufzeichnungen von Tuaregg-Gesängen und Liedern der Djerba-Juden. Ein Halbjahres-Stipendium in der Cité Internationale des Arts in Paris schloss sich an. 1980 arbeitete Ostendorf am renommierten Pariser IRCAM-Institut (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) und erhielt eine Professur für Musiktheorie, Komposition und Analyse an der Universität Bremen. Einer seiner Schüler war Peter Friemer. 1981 und 1983 bereiste er Kuba, um musikalische und musiksoziologische Studien durchzuführen. Dort nahm er teil am Kongress für elektronische und Computermusik und betreute Sendungen des Kubanischen Rundfunks in Havanna. Im Rahmen der Komponistenwettbewerbe der Hamburger Staatsoper wurde am 15. Februar 1982 seiner Oper William Ratcliff nach Heinrich Heine an der Opera Stabile, der experimentellen Bühne der Hamburger Oper, uraufgeführt. Damit fanden Ostendorffs Kompositionen nationale Beachtung, denn die gesamte Tragödie Ratcliffs wurde vom Komponisten als eine Übereinanderschichtung verschiedener Bilder begriffen, ein Zusammenspiel von Schauspiel, Gesang, Pantomime, Hörspiel, Stimmen und dialogischen Selbstgesprächen mit Life-Orchester, Bild- und Bandaufnahmen. Seine zweite Oper, namens Murieta, nach Pablo Nerudas Glanz und Tod Joaquin Murieta, war ein Auftragswerk der Kölner Oper, die dort am 25. Oktober 1984 uraufgeführt wurde. Seine vierte Oper Questi Fantasmi…! wurde am 5. Dezember 1992 vom Stadttheater Koblenz uraufgeführt als Auftragswerk zur 2000 Jahrfeier der Stadt. Diese Uraufführungen machten Ostendorf als Neuerer des Musiktheaters bekannt, so dass 1987 die Stadt Gütersloh ein sechstägiges Ostendorf-Porträt feierte. Dazu komponierte er die Orchesterwerke Mein Wagner (1983) und Psychogramme (1984), die daraufhin im Rahmen der Tage „Neue Musik aus der Bundesrepublik” eine Einladung nach Kiev erhielten und dort zusammen mit seiner Oper William Ratcliff erstaufgeführt wurden. Jens-Peter Ostendorf lebte und arbeitete in Hamburg und Formentera/Spanien. Er schrieb neben Opern für modernes Musiktheater auch Filmmusiken. Mitte der 90er Jahre versiegte sein Schaffen infolge einer unheilbaren Erkrankung. Er starb 2006 in Norderstedt.
20.7. Arwed SANDNER: 100. Geburtstag
Er wurde in Berlin ausgebildet und kam ins Opernstudio der Komischen Oper Berlin. An diesem Haus debütierte er 1954 als 2. Geharnischter in der »Zauberflöte«. Er blieb bis 1961 der Komischen Oper Berlin verbunden, wo er Rollen wie den Moruccio in »Tiefland« von d’Albert, den Osmin in der »Entführung aus dem Serail«, den Matteo in »Fra Diavolo« von Auber, den Schnock in »Ein Sommernachtstraum« von B. Britten und den Höllenpförtner in »Die Teufelskäthe« (»Cert a Káca«) von Dvorák übernahm. 1962-68 war er dann Mitglied des Staatstheaters Karlsruhe, anschließend 1968-77 des Opernhauses Zürich und seitdem bis gegen Ende der achtziger Jahre der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg. Er sang vor allem Partien aus dem Charakterfach wie den Bartolo im »Barbier von Sevilla«, den Bijou im »Postillon von Lonjumeau« von Adam, den Kothner in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den Juan Lopez im »Corregidor« von Hugo Wolf und den Pfarrer im »Besuch der alten Dame« von G. von Einem. Er trat als Gast u.a. am Théâtre de la Monnaie Brüssel (1967) und am Gran Teatre del Liceu in Barcelona (1970 als Klingsor in »Parsifal«) auf. Er starb 1995 bei einem Verkehrsunfall in Hamburg.
Schallplatten: Wergo (»Neues vom Tage« von P. Hindemith), Gala (Major-General und Pirat Mac in der Operette »Die Piraten« von A. Sullivan, 1968).
21,7, Andrew GREENWOOD: 70. Geburtstag
Biographie des britischen Dirigenten auf Englisch:
https://www.theguardian.com/music/2021/feb/25/andrew-greenwood-obituary
21.7. Jonathan MILLER: 90. Geburtstag
Er wuchs in London auf. Sein Vater Emanuel Miller war Psychiater, seine Mutter Betty schrieb Romane und Biographien. Er studierte Naturwissenschaften und Medizin am St. John’s College, Cambridge und wechselte schließlich an das University College London. Während des Medizinstudiums begann er sich beim Theaterklub Cambridge Footlights zu engagieren. 1959 machte er seinen Doktor in Medizin und arbeitete 2 Jahre im Central Middlesex Hospital, London. In den 60er Jahren schrieb und produzierte er zusammen mit Alan Bennett, Peter Cook und Dudley Moore ein Musical (Beyond the Fringe) für das Edinburgh Festival. Im Jahr 1964 inszenierte er das 1. Stück im gerade neu gegründeten American Place Theatre – The Old Glory von Robert Lowell mit Frank Lagella, Roscoe Lee Brown und Lester Rawlins in den Hauptrollen. Das Stück gewann 5 Obie Awards unter anderem als Bestes Amerikanisches Stück. 1966 schrieb er eine Filmadaption von Alice in Wonderland und führte hierbei auch Regie. 1970 spielte Laurence Olivier in Millers Produktion von Shakespeares Der Kaufmann von Venedig. 1970-73 hatte Miller ein Forschungsstipendium für Medizingeschichte am University College, London, inne. Nachdem er 1973 seine erste Oper inszenierte (eine englische Erstaufführung von Alexander Goehrs Arden muss sterben) begann er Opern für die Kent Opera, die Glyndebourne Festival Opera (1975 Das schlaue Füchslein von Janácek) und für die English National Opera zu produzieren, bzw. Regie zu führen. In den 70er Jahren fing er an sich für die Rechte gleichgeschlechtlich Liebender einzusetzen und war Vizepräsident der Campaign for Homosexual Equality, eine der ältesten britischen Organisationen für Gay Rights. In den 1980er Jahren produzierte er Shakespeare-Stücke für den BBC, bei denen er auch teilweise selbst Regie führte. Unter anderem trat John Cleese in einer seiner Produktionen auf. Gleichzeitig studierte er Neuropsychologie und bekam ein Forschungsstipendium für die Sussex Universität. 1988 wurde er künstlerischer Leiter des Londoner Old Vic Theatre und blieb dies bis 1991. In den 1990er und 2000er Jahren war er viel fürs Fernsehen tätig und produzierte einige Dokumentations-Serien für die BBC unter anderem über die Geschichte der Medizin, Madness (Verrücktheit), die Entstehung der menschlichen Sprache sowie eine Serie über Atheismus. In Wien inszenierte Miller 1991 Mozarts Le nozze di Figaro, eine Produktion der Wiener Staatsoper im Theater an der Wien, im Jahr 1993 folgte Fedora von Umberto Giordano bei den Bregenzer Festspielen als Koproduktion mit der Wiener Staatsoper, an der diese Inszenierung ab 1994 gezeigt wurde. 1997 führte ihn sein Weg auch zu den Salzburger Festspielen, wo er bei Mitridate, Re di Ponto Regie führte. Erst 2007, 10 Jahre nach seiner letzten Bühnentätigkeit für ein britisches Theater, kehrte er mit Tschechows Der Kirschgarten wieder zurück, gefolgt von Monteverdis L‘Orfeo. Nebenbei kuratierte er noch eine Ausstellung im Imperial War Museum in London. 2010 inszenierte er für die English National Opera und die Cincinnati Opera La Bohème in einem 1930er Setting. 2011 führte er Regie bei La Traviata und 2012 bei Così fan tutte in Washington DC. 2013 fand eine Ausstellung des an abstrakten und modernen Kunstwerken interessierten Multitalentes mit eigenen Werken in Islington statt. Gemeinsam mit 54 anderen bekannten Persönlichkeiten, wie Richard Dawkins, Terry Pratchett und Stephen Fry unterzeichnete er einen offenen Brief im Guardian, der sich gegen einen Staatsbesuch durch Papst Benedikt XVI. richtete. Miller war seit 1956 mit Helen Rachel Collet verheiratet, mit zwei Söhnen und einer Tochter lebten sie in Camden, London. Jonathan Miller starb im November 2019 im Alter von 85 Jahren in London an den Folgen der Alzheimer-Krankheit.
21.7. Osbelia HERNÁNDEZ: 95. Geburtstag
Biographie der mexikanischen Altistin auf Spanisch: https://www.jornada.com.mx/2014/07/29/cultura/a07n1cul#
21.7. Anny FELBERMAYER: 100. Geburtstag
Sie war an der Wiener Musikakademie Schülerin von Josef Witt und Elisabeth Rado. Sie gewann den Ceborati-Preis in Wien sowie Gesangwettbewerbe in Genf und Verviers. 1951 wurde sie an die Wiener Staatsoper berufen (Antrittsrolle: Nannetta in Verdis »Falstaff«), deren Mitglied sie bis 1982 blieb. Allein die Barbarina in »Die Hochzeit des Figaro« sang sie hier in 235 Vorstellungen. Sie trat an diesem Haus in einer Vielzahl von Partien auf, u.a. als Pousette in »Manon« von Massenet, als Echo in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss, als Zdenka in »Arabella« von R. Strauss, als Pamina in der »Zauberflöte«, als Christkindchen in »Das Christelflein« von Hans Pfitzner, als Ismene in »Alceste« von Gluck, als Liu in Puccinis »Turandot«, als Kammerfrau in Verdis »Macbeth«, als Marzelline in »Fidelio«, als Gretel in »Hänsel und Gretel«, als Anna in »Intermezzo« von R. Strauss, als Susanna in »Die Hochzeit des Figaro«, als Giannetta in »L’Elisir d‘amore«, als Kordula in »Das Werbekleid« von Fr. Salmhofer, als Zerlina in »Don Giovanni«, als Heilige Margarethe in Honeggers »Johanna auf dem Scheiterhaufen«, als Ighino in »Palestrina« von H. Pfitzner, als Hirt in »Tannhäuser«, als Nanette im »Wildschütz« von Lortzing, als Ortlinde in der »Walküre«, als Kate Pinkerton in »Madame Butterfly« und als Barena in »Jenufa« von Janácek, dazu in zahlreichen kleineren Partien. Insgesamt sang sie an der Wiener Staatsoper in mehr als 930 Vorstellungen. Seit 1952 trat sie auch während einer Reihe von Jahren bei den Festspielen von Salzburg in Erscheinung. Sie sang dort 1952 den 1. Knaben in der »Zauberflöte« und die Xanthe in der Uraufführung der Oper »Die Liebe der Danaë« von R. Strauss (14.8.1952),
1952 und 1956-58 die Barbarina, 1956 eine der Kreterinnen in Mozarts »Idomeneo« und 1957 die Vertraute in »Elektra« von R. Strauss. Sie gastierte u.a. am Théâtre de la Monnaie in Brüssel, am Gran Teatre del Liceu in Barcelona und am Stadttheater von Graz. Schön gebildete, lyrische Sopranstimme. Im Konzertsaal vor allem als Oratoriensängerin von Bedeutung. Sie starb 2014 in Wien.
Schallplatten: Decca (Barbarina in »Le nozze di Figaro«, kleinere Partien in »Der Rosenkavalier«, »Die Frau ohne Schatten«, »Der Freischütz«), Columbia (Zdenka in »Arabella«, Barbarina in »Le nozze di Figaro«, »Hänsel und Gretel«), Cetra (»Elektra«, Salzburg 1957), schöne Oratorien- und Lied-Aufnahmen auf Amadeo-Vanguard.
22.7. Karl STEFFL: 85. Geburtstag
Biographie des österreichischen Bassisten auf der ihm gewidmeten Homepage:
https://martinasteffl.at/karl-steffl/
22.7. Ann HOWARD: 90. Geburtstag
Eigentlicher Name Ann Pauline Swadling. Nach anfänglicher Ausbildung 1956-62 bei Teplisa Green und bei Rodolphe Lhombino in London gehörte sie 1961-63 dem Chor der Covent Garden Oper an. Sie gewann 1962 einen Nachwuchswettbewerb der Covent Garden Oper und damit ein Stipendium für ihre weitere Ausbildung in Paris durch Dominic Modesti. 1963 debütierte sie an der Londoner Covent Garden Oper als Kate Pinkerton in »Madame Butterfly«, 1964 sang sie hier die Kammerfrau in Verdis »Macbeth«, 1965 die Waltraute in der »Walküre«. Nach Vollendung dieser Ausbildung hatte sie eine bedeutende Karriere an den führenden englischen Opernbühnen, vor allem 1964-73 an der Sadler’s Wells Opera London. Hier hatte sie als Ortrud in »Lohengrin«, als Fricka im Ring-Zyklus, als Hexe in »Hänsel und Gretel«, als Dalila in »Samson et Dalila« von Saint-Saëns, als Türkenbaba in Strawinskys »The Rake’s Progress«, als Boulotte in Offenbachs »Barbe-Bleue«, als 1. Norn in »Götterdämmerung«, als Carmen und als Czipra im »Zigeunerbaron« ihre Erfolge. Die Czipra sang sie auch 1964 bei der Welsh Opera Cardiff. An der Scottish Opera Glasgow sang sie 1966 die Fricka wie die Waltraute in der »Walküre«, 1969 die Cassandre in »Les Troyens« von Berlioz, 1973 die Brangäne in »Tristan und Isolde«, 1984 die Venere in Cavallis »L‘Orione«, 1988 die alte Lady in »Candide« von Bernstein und 1989 die Marcellina in »Le nozze di Figaro«. 1973 sang sie an der Covent Garden Oper die Amneris in »Aida«. Sie konnte auch in Nordamerika eine erfolgreiche Karriere entwickeln. Hier sang sie 1971 an der Oper von New Orleans, 1972 an der City Opera New York, 1974 an der Oper von Santa Fé (Titelrolle in »La Grande Duchesse de Gerolstein« von Offenbach). 1976 hörte man sie an der Fort Worth Opera wie an der Canadian Opera Toronto als Amneris, 1977 an der Oper von Baltimore in der Koloraturrolle der Isabella in Rossinis »L‘Italiana in Algeri«, 1981 an der Fort Worth Opera als Klytämnestra in »Elektra« von R. Strauss. Ihre Karriere wurde durch eine ausgedehnte Gastspieltätigkeit gekennzeichnet. So gastierte sie am Opernhaus von Bordeaux (1978 als Amneris), am Opernhaus von St. Étienne (1982 Titelrolle in »Hérodiade« von Massenet), am Teatro San Carlo Neapel (1979 als Fricka im »Rheingold«), an der Opera North Leeds, bei den Festspielen von Edinburgh, an den Theatern von Nancy, Rouen, Metz und Saarbrücken, in Milwaukee, San Diego und New Orleans und an der Oper von Santiago de Chile (1984 als Dalila). 1985 sang sie an der Oper von Santa Fé in der Uraufführung der Oper »The Tempest« von John Eaton (den Caliban) und in der Offenbach-Operette »Orpheus in der Unterwelt« die Öffentliche Meinung. Seit 1974 trat sie immer wieder an der English National Opera London auf, so auch 1982 in der englischen Erstaufführung von »Le grand Macabre« von Ligeti und 1989 in der Uraufführung der Oper »The Plumber’s Gift« von David Blake. Bereits 1965 sang sie an der Sadler’s Wells Opera in der Uraufführung von »The Mines of Sulphur« von Richard Rodney Bennett die Partie der Leda, 1983 an der Opera North in der der Oper »Rebecca« von Wilfred Josephs. 1994 sang sie an der New Yorker Metropolitan Oper in sechs Vorstellungen die Auntie in Benjamin Brittens »Peter Grimes«. 1996 erschien sie bei der English National Opera als Kathisha in »The Mikado« von Gilbert & Sullivan. 1997 debütierte sie an der Wiener Staatsoper als Auntie, die sie 1999 auch bei der Welsh Opera Cardiff sang. Eine nicht weniger bedeutende Karriere kam im Bereich des Konzert- und des Oratoriengesangs zustande. Sie starb im März 2014.
Schallplatten: EMI-HMV (Hexe in »Hänsel und Gretel«, »Die Walküre«), TER (»Candide« von Bernstein), Collins (»The Doctor of Middfai« von Maxwell Davies), RCA; Walker-Video (»Ruddigore« von Gilbert & Sullivan), Decca-Video (»Peter Grimes«).
22.7. Heinz HAGENAU: 95. Geburtstag
Er erlernte zuerst den Beruf eines Maurers, ließ aber privat seine Stimme durch Irene Schwedthelm und durch Charlotte Feindt in Hamburg ausbilden. 1955 trat er dem Chor des Hamburger Operettentheaters bei. 1956 wurde er als erster seriöser Bass an das Stadttheater von Flensburg engagiert. 1958-61 wirkte er in Lübeck, 1961-63 am Stadttheater Mainz, seit 1963 für mehr als dreißig Jahre bis 1994 erster Bassist am Opernhaus von Frankfurt a.M. Der Künstler, der über 90 Partien seines Stimmfachs beherrschte und vor allem als großer Wagner-Interpret galt, gastierte an den führenden deutschen Opernhäusern, u.a. in München, Hamburg, Stuttgart, Berlin, in Mannheim und an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg. Auslandsgastspiele 1963 am Opernhaus von Graz, 1966 an der Staatsoper Wien (als Rocco in »Fidelio«), 1966 am Opernhaus von Nizza (in Aufführungen des Ring-Zyklus, 1971 als Hunding in der »Walküre«), 1963-65 am Théâtre de la Monnaie Brüssel, 1967 am Teatro Colón Buenos Aires (als Hagen in »Götterdämmerung«), 1967 in Amsterdam (als Hagen, 1969 als Fafner im Nibelungenring), am Teatro Margherita in Genua (1967 als König Marke in »Tristan und Isolde«, 1967 am Opernhaus von Lyon als Hunding), 1971 am Opernhaus von Toulouse (als Daland in »Der fliegende Holländer«), 1972 am Gran Teatre del Liceu in Barcelona (als Hagen) sowie in Griechenland und Irland. 1963 unternahm er eine Russland-Tournee. 1963-64 sang er bei den Festspielen von Bayreuth den Nachtwächter in »Die Meistersinger von Nürnberg« und den Titurel in »Parsifal«. In Frankfurt wirkte er u.a. am 16.6.1986 in der Uraufführung der Oper »Stephen Climax« von Hans Zender mit. Aus seinem Repertoire für die Bühne sind ergänzend noch der Komtur in »Don Giovanni«, der Sarastro in der »Zauberflöte«, der Kaspar im »Freischütz«, der Landgraf in »Tannhäuser«, der Hans Sachs in »Die Meistersinger von Nürnberg«, der Sparafucile in »Rigoletto«, der König Philipp in Verdis »Don Carlos«, der Ramfis in »Aida«, der Pimen in »Boris Godunow« und der Ochs im »Rosenkavalier« zu nennen. Er starb im Oktober 2017.
Schallplatten: Eurodisc (Querschnitt »Der Waffenschmied« von Lortzing); dazu singt er auf einer kleinen amerikanischen Marke das Bass-Solo in der 9. Sinfonie von Beethoven. Auch Aufnahmen auf Opera und auf Melodram (Titurel in »Parsifal«, Bayreuth 1964).
22.7. Jacqueline BÜGLER: 100. Geburtstag
Sie trat als Kind im Kinderballett des Mannheimer Nationaltheaters auf, besuchte dann eine Handelsschule und arbeitete als Büroangestellte bei einer Exportfirma. Nebenher begann sie mit der Ausbildung ihrer Stimme. Sie studierte in Coburg bei Nelly Lieberknecht und in Nürnberg bei Oeckler, dann noch in Zürich bei Sylvia Gähwiller und bei Armin Weltner. Sie war zuerst 1945-49 am Landestheater von Coburg, dann 1949-54 am Opernhaus von Nürnberg und 1954-55 am Stadttheater (Opernhaus) von Zürich engagiert. 1961-63 gehörte sie dem Stadttheater von Mainz an und setzte dann noch ihre Karriere in Form von Gastspielen fort. Sie gastierte u.a. an der Wiener Volksoper, an den Staatstheatern von Wiesbaden und Karlsruhe, in St. Gallen, Basel, Bremen und Heidelberg, in Luxemburg, am Théâtre Mogador Paris, an den Stadttheatern von Würzburg und Regensburg und am Opernhaus von Toulouse. Im Mittelpunkt ihres Repertoires für die Bühne standen Operettenpartien wie die Rosalinde in der »Fledermaus«, die Saffi im »Zigeunerbaron«, die Annina in »Eine Nacht in Venedig« von J. Strauß, die Laura in C. Millöckers »Der Bettelstudent«, die Titelrolle in »La belle Hélène« von Offenbach, die Kurfürstin im »Vogelhändler« von Zeller, die Hanna Glawari in »Die lustige Witwe«, die Sonja im »Zarewitsch« von Lehár, die Anna Elisa in »Paganini« und die Lisa im »Land des Lächelns« vom gleichen Komponisten, dazu viele weitere Rollen in Operetten von P. Abraham, P. Burkhard, L. Jessel, E. Kálmán, P. Lincke, O. Nedbal, O. Straus und R. Heuberger. Sie trat jedoch auch in Opernpartien auf (Giulietta in »Hoffmanns Erzählungen«, Musetta in »La Bohème«). Sie lebte später in Geroldswil im Schweizer Kanton Zürich. Sie starb 2009 in Zürich.
23.7. Mieczysław HORBOWSKI: 175. Geburtstag
Seine Mutter, Antonina Polczewska (1807-50), war als Schauspielerin und dann als Tänzerin tätig. Er begann zuerst ein Medizinstudium, nahm dann aber bei F. Gaffei in Warschau Gesangsunterricht. Weitere Ausbildung bei Francesco Lamperti und Vanuccini in Italien und bei G. Roger in Paris. Er begann seine Opernkariere 1872 in Italien unter dem Pseudonym Francesco Ranieri mit Auftritten in Florenz, Parma, Modena und Pisa. 1873 kehrte er nach Polen zurück und debütierte 1873 an der Großen Oper (Teatr Wielki) in Warschau als Figaro im »Barbier von Sevilla«. 1873-74 war er am Theater von Posen (Poznan) engagiert, 1874-75 am Opernhaus von Lemberg (Lwów). Während der folgenden Jahre gastierte er und gab Konzerte. 1878-88 trat er dann wieder am Teatr Wielki in Warschau auf, u.a. als Germont-père in »La Traviata« und als Valentin in »Faust« von Gounod. Zu seinen Bühnenrollen gehörten der Rigoletto, der Alfonso in »La Favorita« von Donizetti, der Nevers in den »Hugenotten« von Meyerbeer, der Janusz in »Halka« von Moniuszko und der Jakub in »Der Flößer« (»Flis«) vom gleichen Komponisten. Während dieser Zeit gastierte er ständig an anderen polnischen Theatern und trat häufig als Konzertsolist auf; auch an russischen Opernhäusern (u.a. in Moskau) kam er zu bedeutenden Erfolgen. 1886-95 wirkte er als Pädagoge am Musikinstitut in Warschau, 1895-1906 am Konservatorium von Moskau, auch in Krakau und in Wien. Zu seinen Schülern gehörten der international bekannte Tenor Dimitrij Smirnoff und der polnische Bassist F. Freszel. Er publizierte in polnischen Musikzeitschriften mehrere gesangskundliche Abhandlungen, sowie eine zweibändige Gesangschule (»Szkola spiewu teoretyczno-praktycznego«) und war als Komponist tätig. Er starb 1937 in Wien. – Seine Nichte Mira Horbowska (1885-1957) hatte in Polen wie in Russland eine erfolgreiche Karriere als Soubrette in Opern- und Operettenrollen.
23.7. Géza ZICHY: 175. Geburtstag
Er stammte aus einer Adelsfamilie und trug den Titel Graf Vasonyköi. Mit 14 Jahren verlor er bei einem Jagdunfall seinen rechten Arm. Statt zu verzweifeln, verdoppelte er sein Bestreben, sich zu einem wahren Klaviervirtuosen zu entwickeln. „Ich habe die Tür geschlossen“, sagt er in seinen Memoiren, „und mich alleine angezogen. Der Türgriff, die Möbel, meine Beine und meine Zähne halfen. Beim Mittagessen aß ich kein Essen, das ich mir nicht schneiden konnte, und ich akzeptierte auch nicht den geringsten Service. Heute schäle ich Äpfel, schneide mir die Nägel selbst, ziehe mich alleine an, reite, fahre Vierspänner, bin ein guter Jäger mit Kugeln und Schrot und habe sogar gelernt, ein bisschen Klavier zu spielen. Sie können mit einer Hand unabhängig sein, Sie müssen nur wissen wie.“ So absolvierte er eine Klavierausbildung u. a. bei Franz Liszt und studierte Komposition bei Robert Volkmann. Seit den 1870ern trat er international als Pianist auf, gelobt unter anderem von dem Musikkritiker Eduard Hanslick. Er war 43 Jahre lang – von 1875 bis 1918 – Präsident der Königlich Ungarischen Landesmusikakademie und von 1891 bis 1894 Intendant der Oper in Budapest, deren Leiter zu dieser Zeit erst Josef Řebíček (1891–93) und dann Arthur Nikisch war. Er komponierte sechs Opern, von denen die Rákóczi-Trilogie den größten Erfolg hatte, außerdem die Katnate Dolores und das Ballett Gemma, ein Klavierkonzert, Klavieretüden für die linke Hand und Lieder. Er veröffentlichte eine dreibändige Autobiographie Aus meinem Leben. Er starb 1924 in Budapest. Sein Cousin Mihály Zichy (1827–1906) wurde als Maler bekannt.
24.7. Neil HOWLETT: 90. Geburtstag
Anfänglich Studium der Archäologie und der Anthropologie an der Universität von Cambridge. Die Ausbildung zum Sänger erfolgte durch Otakar Kraus in London, durch Tino Pattiera in Wien, an der Musikhochschule Stuttgart und durch Ettore Campogalliani in Mantua. Bühnendebüt am 13.6.1964 bei der English Opera Group in der Uraufführung von Benjamin Brittens »Curlew River« beim Festival von Aldeburgh; zuvor bereits im Konzertsaal aufgetreten. Er war in der Spielzeit 1965-66 am Stadttheater von Bremen engagiert. 1966 begann er eine langjährige Karriere bei der Sadler’s Wells Opera London (Debüt als Agamemnon in Offenbachs »La belle Hélène«) und deren Nachfolgerin, der English National Opera, wo er eine Vielzahl von Bariton-Partien übernahm, sowie an der Covent Garden Oper London, bei den Festspielen von Edinburgh (2002 als Wotan in der »Walküre«, 2005 als König Marke in »Tristan und Isolde« und 2006 als Gurnemanz in »Parsifal«) und Aldeburgh. An der Scottish Opera Glasgow gastierte er 1973 als Golaud in »Pelléas et Mélisande« und 1988 als King Fisher in M. Tippetts »A Midsummer Marriage«. Gastspiele an den Opern von Lyon, Bordeaux, Marseille, Nizza, Rouen, Toulouse, bei den Festspielen von Aix-en-Provence, an der Staatsoper Hamburg und am Stadttheater von Bremen. Er beherrschte ein breites Bühnen- und Konzertrepertoire, das von Werken der Barockepoche bis zu zeitgenössischen Komponisten reichte und u.a. Partien in Opern von Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, R. Wagner und R. Strauss enthielt. 1974 sang er bei der English National Opera London in der Uraufführung von »The Story of Vasco« von Crosse, 1989 in »The Plumber’s Gift« von Blake. 1985 war er am Theater des Herodes Atticus in Athen als Hector in »King Priam« von M. Tippett zu Gast, 1986 am Teatro Colón Buenos Aires als Amfortas in »Parsifal«, 1987 als Fliegender Holländer. 1987-90 trat er bei der English National Opera (und mit deren Ensemble bei mehreren Gastspielen) als Scarpia in »Tosca« auf, 1992 gastierte er am Teatro Bellini Catania als Faninal im »Rosenkavalier«. Beim Holland Festival übernahm er 1990 die Partie des Ruprecht in »L’Ange de feu« von Prokofjew. Auf pädagogischem Gebiet an der Guildhall School of Music in London als Professor wirkend. Er starb im Mai 2020. – Er war in erster Ehe verheiratet mit der lyrischen Sopranistin Elizabeth Robson (* 1939 Dundee), die u.a. an der Covent Garden Oper London bei den Festspielen von Glyndebourne und Aix-en-Provence und an der Mailänder Scala auftrat. In zweiter Ehe war er mit der Mezzosopranistin Carolyn Hawthorn verheiratet.
Schallplatten: Decca.
Weitere Informationen auf seiner Homepage: http://neilhowlett.com/
24.7. Anne Caroline DE LAGRANGE: 200. Geburtstag
Sie entstammte einer sehr wohlhabenden Familie. Ihre Mutter war deutscher Abstammung, sie kam bereits als Kind bei musikalischen Soiréen, die ihr Vater veranstaltete, mit führenden Künstlern ihrer Epoche in Berührung. Sie war dann in Paris Schülerin von Giulio Marco Bordogni, zu seiner Zeit einer der bekanntesten Gesangpädagogen. 1840 trat sie in Paris in einem Wohltätigkeitskonzert für polnische Flüchtlinge auf; 1840 kam es dann zu einem semiprofessionellen Bühnendebüt am Théâtre Renaissance in Paris in »La Duchesse de Guise« von Friedrich von Flotow. Sie ging darauf zur weiteren Ausbildung nach Italien und absolvierte Studien bei Mandacini und Francesco Lamperti in Mailand. Am Liceo musicale Bologna war sie Schülerin des großen Komponisten Gioacchino Rossini, der sie sehr schätzte. 1842 erfolgte dann ihr eigentliches Bühnendebüt am Teatro Comunale von Piacenza in »Il Bravo« von Saverio Mercadante. Sie sang in den folgenden zwanzig Jahren mit anhaltenden Erfolgen an französischen wie an italienischen Theatern. In der Saison 1845-46 und nochmals 1861 erschien sie an der Mailänder Scala. 1855-58 trat sie in New York auf und hatte auch in Nordamerika große Erfolge. Am 3.12.1856 kreierte sie an der Academy of Music in New York die Violetta in »La Traviata« in der amerikanischen Erstaufführung der bekannten Verdi-Oper. 1857-58 unternahm sie eine große Südamerika-Tournee. Bereits 1849 gastierte sie in Hamburg, 1850-53 an der Hofoper Wien tätig, wo sie die Fides in der Premiere von Meyerbeers »Der Prophet« (1850) sang. Weitere Gastspiele in Budapest, Berlin, Dresden und Leipzig und 1862 in Madrid. Ihre großen Partien in einem weit gespannten Repertoire waren neben den bereits erwähnten Rollen die Rosina im »Barbier von Sevilla«, die Titelheldinnen in den Opern »Norma« von Bellini, »Lucia di Lammermoor« und »Lucrezia Borgia« von Donizetti und die Gilda in »Rigoletto«. Nach Aufgabe ihrer Karriere im Jahre 1869 lebte sie als Pädagogin in Paris, wo sie 1905 starb. Die Accademia di Santa Cecilia Rom wie die Akademie von Venedig ernannten sie zu ihrem Mitglied, das Konservatorium von Bologna übertrug ihr eine Ehrenprofessur. Sie war mit dem Baron Grégoire de Stankovicz († 1862) verheiratet. Ihr Familienname kommt auch in der Schreibweise La Grange vor.
25.7. Richard TRYTHALL: 85. Geburtstag
Er studierte Komposition bei David Van Vactor an der University of Tennessee (B.M. 1961) und bei Roger Sessions und Earl Kim an der Princeton University (M.F.A. 1963) sowie bei Leon Kirchner in Tanglewood und 1963/64 bei Bopris Blacher an der Hochschule für Musik Berlin. Er war u. a. Fulbright- und Guggenheim-Stipendiat, 1964 erhielt er den Rome Prize der American Academy in Rome. 1969 wurde er mit dem Kranichsteiner Musikpreis (Klavier) ausgezeichnet. Er war 1972/73 an der State University of New York at Buffalo und 1976 an der University of California tätig. Seit 1966 war er Lehrer an der St. Stephen’s School in Rom, 1974 wurde er „Music Liaison“ der American Academy in Rome. Er starb 2022 in Rom. Er war mit einer Italienerin verheiratet und hatte eine Tochter.
25.7. Vera SCHLOSSER: 95. Geburtstag
Sie verbrachte in Karlsbad ihre Jugend, erhielt ihren ersten Gesangunterricht, doch wurde ihre Familie dann gegen Ende des Zweiten Weltkriegs nach Regensburg verschlagen. 1947-53 war sie als Choristin und als Elevin am dortigen Stadttheater beschäftigt, wurde aber zunächst nur in kleinen Partien eingesetzt. 1951 sang sie im Chor der Bayreuther Festspiele. Ihren ersten großen Erfolg hatte sie in Regensburg, als sie eine andere Sängerin als Desdemona in Verdis »Otello« ersetzte und dabei eine herausragende Leistung zeigte. 1953 wurde sie als lyrischer Sopran an das Staatstheater von Wiesbaden verpflichtet. 1957 kam sie von dort an das Stadttheater (Opernhaus) von Zürich, an dem sie bis 1969 eine erfolgreiche Karriere hatte. 1963 gastierte sie an der Mailänder Scala als Wellgunde und als Gerhilde im Nibelungenring. Auch an den Staatsopern von München, Hamburg und Stuttgart, am Teatro Comunale Bologna und an der Oper von Rom als Gast aufgetreten. 1960 und 1961 gastierte sie am Teatro San Carlos Lissabon als Jenufa von Janácek bzw. als Eva in »Die Meistersinger von Nürnberg«. Sie sang zahlreiche Partien aus dem lyrisch-dramatischen Repertoire. Sie sang am Opernhaus von Zürich 1963 in der Uraufführung der Oper »Die Errettung Thebens« von Rudolf Kelterborn die Braut des Menoikeus, auch in der Schweizer szenischen Erstaufführung der Händel-Oper »Deidamia« die Titelrolle (1958) und in der von Frank Martins »Mystère de la Nativité« die Partien der Eva und der Maria (1961). Zugleich bedeutende Konzertsopranistin. Sie wohnte später in Feldbach im Kanton Zürich. Sie starb 2018 in Rapperswil.
Schallplatten: Auf Decca wirkt sie als eine der Walküren in Wagners »Walküre« mit.
25.7. Arjan BLANKEN: 100. Geburtstag
Biographie des niederländischen Tenors auf Englisch:
http://www.bach-cantatas.com/Bio/Blanken-Arjan.htm
25.7. Caroline FINALY: 175. Geburtstag
Sie zeigte bereits ganz jung eine große Begabung als Sängerin wie als Schauspielerin. Sie studierte bei Carl Maria Wolf in Wien und debütierte 1868 am Theater an der Wien in Wien als Olga in Offenbachs »Großherzogin von Gerolstein«. Bis 1872 gehörte sie dem Theater an der Wien an; 1872-74 war sie Mitglied des Strampfer-Theaters in Wien und trat dann wieder bis zu ihrem Rücktritt von der Bühne 1883 am Theater an der Wien auf. In der Saison 1876-77 war sie am Wiener Carl-Theater zu hören. Sie war eine große Operettensängerin und hat eine Vielzahl wichtiger Uraufführungen am Theater an der Wien mitgemacht; hier sang sie in den ersten Aufführungen der Johann Strauß-Operetten »Cagliostro in Wien« (27.2.1875 die Emilia) und »Der lustige Krieg« (25.11.1881 die Violetta) und in Millöckers »Der Bettelstudent« (6.2.1882 die Laura); am 9.10.1883 sang sie hier die Annina in der Wiener Erstaufführung von »Eine Nacht in Venedig« (sechs Tage nach der Uraufführung am Berliner Friedrich Wilhelmstädtischen Theater). In der Uraufführung der Operette »Prinz Methusalem« von Johann Strauß erschien sie am Carl-Theater (3.1.1877 als Pulcinella). Am Theater an der Wien hörte man sie auch 1880 in der Uraufführung der Millöcker-Operette »Apajune der Wassermann«, 1883 in der von Franz von Suppés »Die Afrikareise«. Die vom Wiener Publikum vergötterte Sängerin gab auch Gastspiele, vor allem am Friedrich Wilhelmstädtischen Theater in Berlin. Nach ihrer Heirat mit dem Kaufmann Géza Pulitzer und ihrem Abschied vom Theater lebte sie seit 1883 in Triest, wo sie 1934 starb.
26.7. Marco Antonio SALDAÑA: 90. Geburtstag
Biographie des mexikanischen Baritons auf Spanisch: https://rme.rilm.org/article?id=dmx03712&v=1.0&rs=dmx03712
26.7. René VERDIÈRE: 125. Geburtstag
1917 meldete er sich freiwillig als Soldat für den Kriegsdienst. Nach Kriegsende erfolgte sein Gesangstudium zunächst an der Musikschule von Calais, dann am Conservatoire National in Paris. 1926 Debüt an der Grand Opéra Paris als Max im »Freischütz«. Seitdem hatte er sowohl an diesem Opernhaus wie auch seit 1930 an der Opéra-Comique eine große Karriere. Hier wirkte er u.a. 1935 in der Uraufführung der Oper »Gargantua« von Antoine Mariotte mit. Gastspiele gestalteten sich, namentlich an der Covent Garden Oper London wie am Opernhaus von Monte Carlo, aber auch an vielen anderen wichtigen Bühnen erfolgreich. An der Covent Garden Oper ersetzte er 1936 René Maison als Julien in Charpentiers »Louise«. Er spezialisierte sich im Lauf seiner Karriere vor allem auf die heldischen Rollen des französischen Repertoires und auf Wagner-Heroen. 1940 wurde er als Soldat eingezogen und konnte erst wieder 1945 seine Karriere an der Opéra-Comique aufnehmen; später sang er dann auch wieder an der Grand Opéra. 1948-49 Gastspiel an der Oper von Monte Carlo als Dimitrij in »Boris Godunow«. 1953 gestaltete er an der Grand Opéra in der glanzvollen Premiere der Barockoper »Les Indes galantes« von Rameau die Partie des Adario. 1954 gab er seine Bühnenkarriere auf und war seitdem in Paris als Pädagoge tätig. Er starb 1981 in Paris.
Schallplatten: Odeon.
26.7. Serge KOUSSEVITZKY: 150. Geburtstag
Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen aus einer jüdischen Familie. Er wuchs in Wyschni Wolotschok auf, einem kleinen Ort in der Oblast Twer, ca. 250 km nordwestlich von Moskau. Seine Eltern waren Berufsmusiker. Sie unterrichteten ihn auf Geige, Violoncello und Klavier. Im Alter von 14 Jahren verließ er seinen Heimatort, um in Moskau Musik zu studieren. Durch die Heirat mit der Tochter eines reichen Teehändlers erhielt er die Möglichkeit, seinen Traum vom Dirigieren zu verwirklichen. Seit ca. 1905 lebte er in Berlin und gab am 23. Januar 1908 mit den Berliner Philharmonikern sein Debüt als Dirigent. Zur Aufführung kam u. a. das 2. Klavierkonzert von Rachmaninoff, der bei dieser Aufführung selbst spielte. 1909 gründete Koussevitzky den Musikverlag Editions Russes de Musique und veröffentlichte Werke von Strawinsky, Rachmaninoff, Prokofjew, Medtner und Skrjabin. Im Jahr 1910 mietete er zum ersten Mal ein Dampfschiff und spielte mit einem von ihm zusammengestellten und finanzierten Orchester an 19 Orten entlang der Wolga. Zwei weitere Tourneen folgten 1912 und 1914. Nach dem Krieg und der Revolution leitete Koussevitzky für drei Jahre das Staatliche Symphonieorchester in Petrograd (heute: St. Petersburg), reiste aber Anfang der 1920er Jahre endgültig aus der Sowjetunion aus. Über Berlin kam er nach Paris, wo er 1921 die Konzertreihe Concerts Symphoniques Koussevitzky gründete. Auch hier widmete er sich vor allem den russischen Komponisten. Ein Meilenstein der Musikgeschichte war die Uraufführung der orchestrierten Fassung von Modest Mussorgskys Klavierzyklus Bilder einer Ausstellung, die Maurice Ravel im Auftrag Koussevitzkys geschaffen hatte. Koussevitzky war 1924-49 Musikdirektor des Boston Symphony Orchestra. 1943 gab er Béla Bartók den Auftrag für eine „composition for orchestra“. Bartók komponierte darauf sein Konzert für Orchester, dessen Uraufführung durch das Boston Symphony Orchestra am 1. Dezember 1944 in der Symphony Hall Boston unter Koussevitzky ein enormer Erfolg war. 1937 gründete Koussevitzky das Tanglewood Music Festival, eine der herausragenden Musikveranstaltungen in den USA. 1951 lud er den jungen Dirigenten Lorin Maazel nach Tanglewood ein. Hier startete unter anderem Leonard Bernstein seine Karriere, zu dem Koussevitzky ein fast väterliches Verhältnis hatte.
Weil Koussevitzky ein Stipendium benötigte und ein solches nur noch für die Kontrabassklasse zur Verfügung stand, begann er ein Studium dieses Instruments. Sein Lehrer Josef Rambousek stammte aus Prag und war wie Franz Simandl oder Gustav Láska ein Schüler des Pädagogen Josef Hrabě. Koussevitzky wurde nach dem Studium im Orchester des Bolschoi-Theaters als Kontrabassist engagiert und trat schon als Virtuose auf. 1903 gab er sein Debüt in Deutschland. Seine Soloprogramme bestanden aus Originalkompositionen für Kontrabass, z. B. von Giovanni Bottesini und Gustav Láska, und Bearbeitungen anderer Instrumentalkonzerte für Kontrabass, u. a. Mozarts Fagottkonzert KV 191 und Max Bruchs Kol Nidrei op. 47. Koussevitzky komponierte einige Stücke für Kontrabass, die bis heute sehr populär sind. Dabei handelt es sich um Andante cantabile und Valse miniature op. 1, Berceuse und Chanson Triste op. 2, das Konzert fis-Moll op. 3 (orchestriert von Wolfgang Meyer-Tormin) und die Humoreske op. 4. Koussevitzky besaß viele wertvolle Instrumente, darunter Kontrabässe von Maggini, Guarneri und Amati. Für seine solistischen Auftritte benutzte er aber meist einen Kontrabass der Firma Glässel & Herbig aus dem sächsischen Markneukirchen. Viel bekannter ist heute sein Amati-Kontrabass. Das im Jahr 1611 gebaute Instrument war einst im Besitz von Domenico Dragonetti. Nach dem Tode Koussevitzkys gab seine Witwe, Olga, den Kontrabass an den amerikanischen Virtuosen Gary Karr weiter. Mit seiner zunehmenden Beschäftigung als Dirigent trat die Virtuosenkarriere in den Hintergrund. Kussewizki trat aber weiterhin mit dem Kontrabass auf, wenn auch in geringerem Maße. Er war der erste Kontrabassist, der eine Schallplatte aufnahm. Anfang der 1920er Jahre spielte er eigene Kompositionen sowie Werke von Gustav Láska und Henry Eccles ein. 1929 gab er in Boston sein letztes öffentliches Konzert als Kontrabass-Solist. 1934 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Er starb 1951 in Boston.
26.7. Julius RÜNGER: 150. Geburtstag
Er war der Sohn eines Musiklehrers, von dem er ersten Klavier- und Violinunterricht erhielt. Er setzte seine Ausbildung am Konservatorium von Prag und an der dortigen Hochschule für Kirchenmusik fort, wo er auch im Dirigieren ausgebildet wurde. Er war zunächst als Orchestermusiker tätig, bis der große Impresario Angelo Neumann seine Stimme entdeckte, die dann bei Vogel in Prag und bei Gianini in Mailand ausgebildet wurde. Er debütierte als Opernsänger 1895 am Stadttheater von Essen, sang anschließend 1896-98 am Stadttheater von Elberfeld und dann 1898-1903 am Stadttheater von Mainz, wo er 1899 den De Siriex in der deutschen Erstaufführung von Giordanos »Fedora« übernahm. 1903-05 war er am Stadttheater von Magdeburg, 1905-06 an der neu begründeten Komischen Oper Berlin engagiert. Anschließend unternahm er eine längere Tournee durch Australien, während der er u.a. 1907 den Wotan in der australischen Erstaufführung der »Walküre« in Melbourne vortrug. Auf der Rückkehr nach Europa trat er auch in den USA auf. 1908-09 war er an der Wiener Volksoper, 1909-11 an der Volksoper Berlin im Engagement, an der er auch als Regisseur wirkte. Danach betätigte er sich zunehmend als Dirigent und trat auch als Komponist (Opern, Lieder, Messen usw.) hervor. Zeitweilig lebte er in München, dann aber wieder in Berlin, wo er 1933 starb. Zu seinen Rollen auf der Bühne gehörten der Figaro in »Die Hochzeit des Figaro«, der Don Pizarro in »Fidelio«, der Kühleborn in Lortzings »Undine«, der Fliegende Holländer, der Telramund in »Lohengrin«, der Hans Sachs in »Die Meistersinger von Nürnberg«, der Titelheld in »Hans Heiling« von Marschner, der Hamlet in der gleichnamigen Oper von A. Thomas, der Mephisto in »Faust« von Gounod, die vier Dämonen in »Hoffmanns Erzählungen« und die Titelrolle in Rubinsteins »Dämon«.
27.7. Anna DE CAVALIERI: 100. Geburtstag
Die Künstlerin war Amerikanerin, ihr eigentlicher Name war Anne McKnight. Sie erhielt ihre Ausbildung in den USA, kam aber in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nach Italien und hatte an den dortigen großen Opernbühnen bedeutende Erfolge; 1953 sang sie am Teatro San Carlo Neapel die Titelrolle in »Turandot« von Busoni, 1956 die Titelpartie in Glucks »Alceste« und wirkte dort 1959 in der Uraufführung der Oper »Pantea« mit. 1954 sang sie an der Mailänder Scala die Rossana in »Cyrano de Bergerac« von Alfano, 1958 die Elena in »Mefistofele« von Boito. 1955 gastierte sie auch an der Oper von Rom in Alfanos »Cyrano de Bergerac«, 1960 als Titelheldin in »Lucrezia« von O. Respighi, 1955 bei den Festspielen in den römischen Thermen des Caracalla in der Titelrolle von Catalanis Oper »Loreley«, 1954 bei den Festspielen in der Arena von Verona als Aida und als Elena in »Mefistofele«, 1957 am Teatro Regio von Parma. 1960 gastierte sie in ihrer amerikanischen Heimat unter ihrem eigentlichen Namen Anne McKnight an der New York City Opera als Marschallin im »Rosenkavalier«. 1961 hörte man sie an der Oper von Rio de Janeiro als Turandot und als Tosca in den beiden Puccini-Opern gleichen Namens. Ihre größten Erfolge hatte sie jedoch in Italien. Dort sang sie 1960 an der Oper von Rom, 1962 in Turin, 1963 am Teatro Grande von Brescia die Mathilde in Rossinis »Wilhelm Tell«. Sie trat u.a. in Piacenza (1961 als Turandot von Puccini), Rovigo, Cremona (1964 als Fedora von Giordano) und noch 1968 in Padua (als Tosca) auf, 1962 am Théâtre de la Monnaie Brüssel, 1964 am Opernhaus von Toulouse als Norma. In Europa wie in Nordamerika hatte sie nicht zuletzt auch als Konzertsängerin eine bedeutende Karriere. Sie starb 2012 in Lugano (Schweiz).
Auf MMS singt sie die Titelrolle in Verdis »Aida« dazu sind Mitschnitte von integralen Opernaufführungen auf EJS vorhanden (»Il Pirata« von Bellini, »Nerone« von Boito, »Loreley« von Catalani), Mondo Musica (Titelrolle in Puccinis »Turandot«). Auf Melodram singt sie die Titelpartie in »Armide« von Gluck, auf Replica die Valentine in Meyerbeers »Hugenotten« (in italienischer Sprache, 1956), auf Cetra die Asteria in Mascagnis »Nerone«, auf MMS die Musetta in »La Bohème«, auf RCA (als Anne McKnight) in der Hohen Messe von J.S. Bach.
27.7. Otar TAKTAKISHVILI: 100. Geburtstag
Er begann seine musikalische Ausbildung 1938 an der Musikfachschule in Tiflis. 1942 wechselte er an das dortige Konservatorium, um bis 1947 Komposition zu studieren. Schon während seiner Studienzeit machte er sich als Komponist einen Namen. 1947 ging er zunächst zur Staatskapelle der Georgischen SSR, wo er bis 1952 als Dirigent und anschließend bis 1956 als Direktor wirkte. Inzwischen hatte sich Taktakischwili nicht nur als georgischer Nationalkomponist, sondern auch als bedeutender sowjetischer Komponist etabliert. 1959 wurde er als Dozent ans Konservatorium in Tiflis berufen und war 1962-65 dessen Direktor. Im Jahre 1966 wurde er Professor. Taktakischwili nahm Posten im georgischen und sowjetischen Komponistenverband wahr. 1965-84 war er georgischer Kulturminister. Immer wieder trat er als Dirigent vorwiegend eigener Werke international in Erscheinung. Taktakischwili erhielt zahlreiche Orden und Auszeichnungen; er war u.a. dreifacher Staatspreisträger und Träger des Leninordens. Er starb 1989 in Tiflis.
Grundlage von Taktakischwilis Schaffen ist die georgische Volksmusik, an welche er sich in Melodiebildung, Harmonik und Rhythmik anlehnt. Teilweise werden sogar Volksmusikinstrumente imitiert. Taktakischwili bewegt sich im Rahmen einer modal eingefärbten Tonalität, die durch abrupte Tonartwechsel gekennzeichnet ist. Seine Frühwerke zeichnen sich stellenweise durch großes Pathos aus und folgen den Richtlinien des sozialistischen Realismus. Ihre Tonsprache ist sehr traditionell und bewegt sich überwiegend auf dem Boden der Musik des 19. Jahrhunderts. Seine ab Mitte der 1970er Jahre komponierten Werke wirken dagegen introvertierter und harmonisch freier, bleiben aber eindeutig tonal. Besonders in seinen späteren Werken lassen sich auch neoklassizistische Züge erkennen. Zu Lebzeiten hatte er großen Erfolg; seine Oper Mindia galt z.B. als eine der wichtigsten georgischen Opern. Er wurde als georgischer Nationalkomponist gefeiert und besaß internationale Reputation. Heute ist seine Musik allerdings weitgehend unbekannt.
28.7. John RILEY-SCHOFIELD: 70. Geburtstag
Er studierte Gesang an der Huddersfield School of Music (1972-75), dann an der Royal Academy of Music London (1975-78); zu seinen Lehrern gehörten Raimund Herincx, Steven Sweetland und Peter Harrison. Er trat zunächst bei der English National Opera London auf, wo er 1982 den Marcello in »La Bohème« von Puccini und 1983 den Cascada in »Die lustige Witwe« von F. Lehár sang und auch als Graf in »Le nozze di Figaro« und als Alfred Ill im »Besuch der alten Dame« von G. von Einem zu hören war. Seit 1986 war er Mitglied des Theaters im Revier Gelsenkirchen. Hier hörte man ihn als Germont-père in »La Traviata«, als Escamillo in »Carmen«, als Faninal im »Rosenkavalier«, als Sprecher in der »Zauberflöte«, als Minister in »Fidelio«, als Nachtwächter in »Die Meistersinger von Nürnberg«, als Graf in »Capriccio« von R. Strauss, als Graf Robinson in Cimarosas »Il matrimonio segreto«, als Falke in der »Fledermaus«, als Danilo in »Die lustige Witwe«, als Wozzeck von A. Berg (1996) und 1987 als Mel in »The Knot Garden« von M. Tippett. Bei den Festspielen von Bregenz gastierte er 1988 als Hermann und als Schlemihl in »Hoffmanns Erzählungen«. 1993 trat er am Opernhaus von Wuppertal (1995 auch an der Staatsoper Dresden) in der deutschen Erstaufführung von Alfred Schnittkes »Leben mit einem Idioten« auf. 1997 trat er am Theater im Revier in Gelsenkirchen als Graf im »Wildschütz« von Lortzing auf, 1998 als Stephan in Lortzings Oper »Regina«, 1999 als Golaud in »Pelléas et Mélisande«. Weitere Bühnenrollen des Künstlers waren der Valentin in »Faust« von Gounod, der Papageno in der »Zauberflöte«, der Figaro im »Barbier von Sevilla«, der Astolfi in »Il Campiello« von Wolf- Ferrari und der Direktor in »Les Mamelles de Tirésias« von Poulenc. Gastspiele und Konzertauftritte in Köln und Mainz, in Wiesbaden, Brüssel und Amsterdam, in London und York, in Frankreich, Portugal und Österreich. Dabei brachte er auch im Konzertsaal ein umfassendes Repertoire zum Vortrag, Werke von J.S. Bach (Matthäuspassion, Johannespassion, H-Moll-Messe) und Händel (»Der Messias«, »Samson«, »Saul«), J. Brahms (»Ein deutsches Requiem«), Haydn (»Die Schöpfung«, »Die Jahreszeiten«), Mendelssohn (»Elias«), Mozart (Requiem und Messen), Gabriel Fauré (Requiem) und Carl Orff (»Carmina Burana«). Er starb 2005 in Edwardsburg (Michigan) bei einem Autounfall.
28.7. Wilhelm RICHTER: 85. Geburtstag
Er studierte Gesang an der Hochschule für Musik in Berlin. Nach seinem ersten festen Engagement am Staatstheater Mainz wurde er Ensemblemitglied der Deutschen Oper am Rhein. Zahlreiche Gastspiele führten ihn an verschiedene nationale und internationale Opernbühnen, wie etwa nach Hamburg, Barcelona, Venedig, Brüssel und Tokio. An der Deutschen Oper am Rhein, die ihn 1999 zum Kammersänger ernannte, sang er in den letzten Jahren u.a. Heinrich der Schreiber (Tannhäuser), Vater Mignon (Die Teufel von Loudun von Penderecki), Spalanzani (Les Contes d’Hoffmann), Dr. Cajus (Falstaff von Verdi) und Don Curzio (Le nozze di Figaro). Zuletzt kehrte er als der ganz alte Sträfling in Janáčeks Aus einem Totenhaus an das rheinische Opernhaus zurück. Er starb 2013 in Düsseldorf.
29.7. Awet TERTERJAN: 95. Geburtstag
Er wurde als Alfred Rubenowitsch Terterjan geboren, verwendete aber den Vornamen Awet als Künstlernamen. Sein Vater Ruben Terterjan war Mediziner, trat jedoch auch als Opernsänger auf. Auch die Mutter – gleichfalls keine Berufsmusikerin – konzertierte als Sängerin. 1948 begann Terterjan ein Studium an der Musikhochschule Baku, das er 1951 an der Romanos Melikian Musikhochschule fortsetzte. Ab 1952 studierte er am staatlichen Komitas Konservatorium in Jerewan bei Edward Mirsojan Komposition. 1960-63 war er Exekutiv-Sekretär des armenischen Komponistenverbandes und 1963-65 dessen Vizepräsident. 1970-74 war Terterjan Vorsitzender der Abteilung Musik im Kultusministerium von Armenien und gleichzeitig als Herausgeber tätig. 1985 wurde er Professor am Konservatorium von Jerewan, 1993/94 gab er Meisterklassen am Urals Konservatorium in Jekaterinburg. 1994 erhielt Terterjan das Brandenburg-Stipendium und arbeitete sechs Monate in Wiepersdorf. Für 1995 wurde ihm ein einjähriges DAAD-Stipendium in Berlin zugesprochen, das er jedoch nicht mehr wahrnehmen konnte. Er starb am 11. Dezember 1994 in Jekaterinburg. Sein Leichnam wurde am 19. Dezember 1994 im Pantheon in Jerewan eingeäschert.
Terterjan schrieb acht Sinfonien (zwischen 1969 und 1989), zwei Opern, ein Ballett, Kammermusik (darunter zwei Streichquartette), zahlreiche Vokalwerke sowie Filmmusik. Terterjans Musik ist durch Verzicht auf Themen oder motivische Arbeit in klassischem Sinne sowie Reduktion auf teilweise archaisch wirkende Formeln und Formen gekennzeichnet. Neben Einflüssen armenischer Volksmusik (mit Heranziehung nicht-temperiert gestimmter Volksmusik-Instrumente) werden auch progressive Elemente der „westlichen“ Musik (Dodekaphonie, Aleatorik, Tonbandzuspielungen) eingesetzt. Insgesamt stieß Terterjans Musik in der sowjetischen Ära auf wenig Gegenliebe. Die Uraufführung seiner 3. Sinfonie löste einen Skandal aus. In letzter Zeit finden vor allem die Sinfonien vermehrtes Interesse, auch in Deutschland. Die (posthume) Uraufführung der Oper Das Beben, 1984 in deutscher Sprache komponiert, 2003 unter Leitung von Ekkehard Klemm am Staatstheater am Gärtnerplatz in München wurde zum Sensationserfolg. Das Libretto von Gerta Stecher, vom Komponisten stark vereinfacht und reduziert, fußt auf der Erzählung Das Erdbeben in Chili von Heinrich von Kleist. Die Süddeutsche Zeitung schrieb: „Terterjan hat mit dem Beben einen Pflock in die gegenwärtige Debatte über die Überlebensfähigkeit des zeitgenössischen Musiktheaters geschlagen.“ In der FAZ hieß es: „Heinrich von Kleists dramatische Prosa nicht veropert – sondern zwingend in Musik ausgedrückt.“
29.7. Ludwig WEBER: 125. Geburtstag
Er wollte zuerst Volksschullehrer werden, studierte aber auch an der Wiener Kunstgewerbeschule bei dem Bühnenmaler Alfred Roller. Seine Stimme fiel zuerst im Chor der Wiener Oratorien-Vereinigung auf. Darauf Gesangstudium bei Alfred Boruttau. 1920 debütierte er an der Wiener Volksoper, der er fünf Jahre lang angehörte, als Fiorello im »Barbier von Sevilla«. 1925-27 war er als erster Bassist am Stadttheater von Wuppertal, 1927-32 am Opernhaus von Düsseldorf engagiert. 1930 gastierte er am Théâtre des Champs-Elysées in Paris in Wagner-Opern unter Franz von Hoesslin als Hunding und als Fafner im Nibelungenring. 1932-33 sang er am Opernhaus von Köln, er wurde dann 1933 Mitglied der Staatsoper von München, an der er bis 1945 blieb und u.a. 1934 an der Uraufführung der Oper »Lucedia« von Vittorio Giannini teilnahm. Sehr große Erfolge hatte er bei den Salzburger Festspielen. Hier sang er 1939 und 1946 den Commendatore in »Don Giovanni«, 1941 den Sarastro in der »Zauberflöte«, 1945 den Osmin in der »Entführung aus dem Serail«, 1946-47 den Bartolo in »Le nozze di Figaro«, dazu in vielen Konzerten (1945 Liederabend und Krönungsmesse von Mozart, 1945-46 Requiem von Mozart, 1947 Requiem von Verdi) und am 6.8.1947 in der Uraufführung von »Dantons Tod« von G. von Einem (den Saint-Just). 1945 folgte er einem Ruf an die Staatsoper von Wien, an der er bereits 1935 und 1938 als Landgraf in »Tannhäuser«, 1939 als Fasolt im »Rheingold« und als König Marke in »Tristan und Isolde« und 1944 als Hagen in »Götterdämmerung« gastiert hatte und wo seine Karriere bis 1963 ihren Höhepunkt erreichte. Hier sang er nun auch den Rocco in »Fidelio«, den Kezal in Smetanas »Die verkaufte Braut«, den Crespel in »Hoffmanns Erzählungen«, den Sparafucile in »Rigoletto«, den Veitinger im »Werbekleid« von Franz Salmhofer, den Ochs im »Rosenkavalier«, den Commendatore, den Osmin, den Hunding in der »Walküre«, den Ramfis in »Aida«, den Kaspar im »Freischütz«, den Daland in »Der fliegende Holländer«, den Saint-Just in »Dantons Tod« von G. von Einem, den Titelhelden in »Boris Godunow«, den Sarastro, den Mephisto in »Faust« von Gounod, den Timur in Puccinis »Turandot«, den Popen in »Iwan Tarassenko« von Salmhofer, den König Heinrich in »Lohengrin«, den Pogner wie den Kothner in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den 1. Nazarener in »Salome« von R. Strauss, den Peneios in »Daphne« von R. Strauss, den Fiesco in »Simon Boccanegra«, den Pater Guardian in »La forza del destino«, den Papst Pius in »Palestrina« von Hans Pfitzner, den Knecht Ruprecht im »Christelflein« von Pfitzner, den Barak in »Die Frau ohne Schatten« von R. Strauss, den Fafner in »Siegfried«, den Hirten in »Oedipus der Tyrann« von Carl Orff und den Kerkermeister in »Die Kluge« von Carl Orff. In der Eröffnungsvorstellung der wieder aufgebauten Wiener Staatsoper trat er am 5.11.1955 als Rocco auf. In den Jahren 1951-56, 1958 und 1960-63 gehörte er zum Bayreuther Festspiel-Ensemble, wie man ihn denn überhaupt als großen Wagner-Bassisten schätzte. In Bayreuth sang er den Gurnemanz (1951-56, 1961) und den Titurel (1955, 1961) in »Parsifal«, den Fasolt (1951-55, 1958) und den Hagen (1951) im Nibelungenring, den Pogner (1952) und den Kothner (1960-61) in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den König Marke (1952-53), das Bass-Solo in der 9. Sinfonie von Beethoven (1953-54), den König Heinrich (1954) und den Daland (1955-56). Gastspiele trugen ihm an der Mailänder Scala (1938-39, 1942, 1948 als König Marke, 1950 als Fasolt im »Rheingold«, als Hunding in der »Walküre«, als Fafner in »Siegfried« und als Hagen in »Götterdämmerung«, 1955 nochmals als Hunding), an der Covent Garden Oper London (1936-39 als Pogner, als Gurnemanz, als Hunding, als Hagen, als Daland, als König Marke, als Osmin und als Rocco, 1947, 1950 als Fasolt, als Hunding, als Hagen und als Boris Godunow, 1951 als Gurnemanz und als Pogner), an der Grand Opéra Paris (1948-50, 1953), am Teatro Colón von Buenos Aires, in Amsterdam und Brüssel große Erfolge ein; er wirkte auch beim Maggio Musicale von Florenz mit. Am 14.7.1938 sang er in München in der Uraufführung der Richard Strauss-Oper »Friedenstag«. Berühmt auch als Wozzeck. Dazu war er ein gefeierter Oratorien- und Liedersänger. Seit 1961 Professor am Salzburger Mozarteum, auch Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper. Machtvolle, dabei aber musikalisch schön gebildete Stimme. Er starb 1974 in Wien.
Zahlreiche Schallplatten der Marken Pathé (1930), Philips, Columbia (»Die Zauberflöte«), Vox (»Der fliegende Holländer«, »Der Rosenkavalier«), Acanta (»Aida«) und Decca (»Der Rosenkavalier«, »Salome«, »Der fliegende Holländer«, »Parsifal«). Auf Discocorp wurde eine »Don Giovanni«-Aufnahme von 1955 veröffentlicht, auf der gleichen Marke »Daphne« von R. Strauss (unter E. Kleiber aus dem Teatro Colón Buenos Aires, 1948), auf Preiser »Von deutscher Seele« von Hans Pfitzner (Wien 1945), auf Murray Hill Fafner in »Siegfried« (Scala, Mailand, 1950), auf Cetra Opera Live »Der fliegende Holländer« und »Tristan und Isolde« (Bayreuth 1955 bzw. 1952), auf Melodram Fasolt im »Rheingold« (Bayreuth, 1952) und »Fidelio« (Wien, 1955), auf Foyer (»Das Rheingold«, Bayreuth, 1953) auf Fonit-Cetra (»Die Walküre«, Scala 1950) und auf Testament Hagen in »Götterdämmerung« (Bayreuth 1951).
29.7. Eugenio TERZIANI: 200. Geburtstag
Informationen über den italienischen Komponisten auf Englisch: http://www.requiemsurvey.org/composers.php?id=2601
30.7. Räto TSCHUPP: 95. Geburtstag
Bekannt war er vor allem für seinen Einsatz für Schweizer Komponisten des 20. Jahrhunderts. Er leitete über hundert Erstaufführungen zeitgenössischer Werke, zahlreiche waren ihm gewidmet. 1957 gründete er das Kammerorchester Camerata Zürich, das bei der Entstehung des modernen Schweizer Kammermusikrepertoires eine wichtige Rolle spielte und bis zu seinem Tod von ihm geleitet wurde. 1976-88 war er Professor an der Hochschule für Musik Karlsruhe, wo er Dirigieren unterrichtete. Im Laufe seines Schaffens spielte er mit verschiedenen Orchestern und Chören einige Werke für diverse Plattenlabels ein, unter anderem Flötenkonzerte von Gluck und Cimarosa, eine Anthologie europäischer Musik nach der Französischen Revolution und Werke von Schweizer Komponisten wie Wladimir Vogel, Paul Müller-Zürich, Hermann Haller und Josef Haselbach. Räto Tschupp starb 2002 in Chur.
30.7. Jakob REES: 100. Geburtstag
Er begann seine Bühnenkarriere 1956 mit einem Engagement am Stadttheater von Oberhausen und wurde 1957 an das Nationaltheater Mannheim berufen. Bis zu seinem Abschied von der Bühne 1982 war er Mitglied dieses Hauses, an dem er in dieser langen Zeit in rund hundert verschiedenen Rollen und in über 3600 Vorstellungen auftrat. Bei seinem Abschied wurde er zum Ehrenmitglied des Theaters ernannt. Er sang in erster Linie Buffo- und Charakterrollen wie den Pedrillo in der »Entführung auf dem Serail«, den Monostatos in der »Zauberflöte«, den Dr. Cajus in Nicolais »Die lustigen Weiber von Windsor«, den David in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den Mime im Nibelungenring (seine Hauptrolle), den italienischen Sänger in »Capriccio« von R. Strauss, den Valzacchi im »Rosenkavalier«, den Wenzel in Smetanas »Die verkaufte Braut«, den Bardolfo in »Falstaff« von Verdi, den Goro in »Madame Butterfly« und die vier Dienerrollen in »Hoffmanns Erzählungen«. Er absolvierte auch Gastspiele im Ausland; so sang er den Mime an der Oper von Nizza (1970) und am Gran Teatre del Liceu in Barcelona (1975). Er starb 1995 in Friedrichsthal bei Usingen (Taunus).
Schallplatten: MMS (David in »Die Meistersinger von Nürnberg«).
30.7. Zhivka KLINKOVA: 100. Geburtstag
Biographie der bulgarischen Komponistin und Dirigentin auf Englisch: https://en.wikipedia.org/wiki/Zhivka_Klinkova
30.7. Gerald MOORE: 125. Geburtstag
Er erhielt seine Ausbildung in Toronto. Er begleitete einige wichtige Instrumentalisten wie Pablo Casals, wurde aber vor allem durch seine Arbeit mit Sängern bekannt. Unter anderem war er Klavierpartner von Janet Baker, Kathleen Ferrier, Dietrich Fischer-Dieskau, Hans Hotter, Alexander Kipnis, Victoria de los Angeles, Christa Ludwig und Elisabeth Schwarzkopf. Es gilt als sein Verdienst, den Status des Begleiters von der rein untergeordneten Rolle zu der eines gleichwertigen künstlerischen Partners gehoben zu haben. Dabei beeindruckte er die Sänger vor allem auch durch seine Fähigkeit, Lieder scheinbar mühelos je nach Bedarf von der Originaltonart nach oben oder unten zu transponieren (in Anpassung an die Tagesform und Stimmlage mancher Sänger). Außerdem hielt Moore Vorlesungen und schrieb über Musik, wie in seinen Memoiren Bin ich zu laut? (Am I Too Loud?). Diese literarische Tätigkeit setzte er auch nach seinem Abschiedskonzert 1967 fort, bei dem er Fischer-Dieskau, de los Angeles und Schwarzkopf zum letzten Mal öffentlich begleitete. 1970–72 wagte er, schon schwer krank, mit Dietrich Fischer-Dieskau das immense Unternehmen einer Gesamtaufnahme aller Schubert-Lieder. 1954 wurde Gerald Moore zum Commander des Order of the British Empire ernannt. Er starb 1987 in Penn (Buckinghamshire).
31.7. Steurt BEDFORD: 85. Geburtstag
Er gab nach seiner Ausbildung an der Royal Academy of Music und dem Orgelstudium am Worcester College in Oxford im Jahr 1967 sein Debüt als Dirigent bei der English Opera Group in London, mit der er Tourneen durch Europa und Nordamerika unternahm. Er dirigierte auch am Covent Garden Opera House und beim Aldeburgh Festival, zu dessen künstlerischem Direktor er 1973 berufen wurde.1975 wurde er einer der beiden künstlerischen Direktoren der English Music Theatre Corporation. Er starb im Februar 2021.
31.7. Don GARRARD: 95. Geburtstag
Er besuchte zur Ausbildung seiner Stimme nacheinander das Konservatorium von Vancouver, das Royal Conservatory of Music in Toronto und die Music Academy of the West in Santa Barbara (Kalifornien); schließlich Schüler von Luigi Borgonovo in Mailand. Erster Bühnenauftritt 1952 an der Oper von Vancouver als Sprecher in der »Zauberflöte«. Er wurde in Kanada bekannt, als er im Fernsehen als Don Giovanni auftrat. Seine größten Erfolge hatte der Künstler in England, wo er seinen Wohnsitz nahm und 1961 an die Sadler’s Wells Opera London engagiert wurde. Seit 1961 trat er hier in mehr als 500 Vorstellungen auf, u.a. als Sparafucile in »Rigoletto«, als Sarastro in der »Zauberflöte«, als Ashby in »La Fanciulla del West«, als Daland in »Der fliegende Holländer«, als Mephisto in »Faust« von Gounod, als Silva in Verdis »Ernani«, als Sir Walter Raleigh in »Gloriana« von B. Britten, als Commendatore in »Don Giovanni« und als Titelheld in Bartóks »Herzog Blaubarts Burg«. Er sang auch bei der Nachfolgerin der Sadler’s Wells Opera, der English National Opera, bei der Welsh Opera, bei der Scottish Opera Glasgow (den Lodovico in Verdis »Otello«, den Rivière in der englischen Premiere von Dallapiccolas »Volo di notte«, den Pimen sowie auch die Titelpartie in »Boris Godunow«, den Commendatore, den König Dodon in »Der goldene Hahn« von Rimski-Korsakow, den Minister in »Fidelio« und den Sarastro), an der Covent Garden Oper London (1970 den Ferrando im »Troubadour«, 1971 den Gremin in »Eugen Onegin«, 1981 Lindorf in »Hoffmanns Erzählungen«) wie auch bei den Festspielen von Aldeburgh und Edinburgh. Gastspiele an den Opern von Toronto und Ottawa, an der Hamburger Staatsoper (bereits 1968), in Santa Fé, Washington, Johannesburg und bei den Festspielen von Drottningholm. Am 13.6.1964 sang er bei den Festspielen von Aldeburgh in der Uraufführung von Benjamin Brittens »Curlew River« in der Kirche von Orford, 1962 bei der Sadler’s Wells Opera London in der englischen Erstaufführung von Pizzettis »L’Assassinio nella cattedrale« bei einem Gastspiel des Ensembles in Coventry. Bei den Festspielen von Glyndebourne wirkte er 1965 als Lord Rochefort in Donizettis »Anna Bolena«, 1966 als Zebul in Händels »Jephta«, 1973 als Pfarrer in der englischen Erstaufführung von G. von Einems »Der Besuch der alten Dame«, 1975 als Gremin, 1975 als Trulove in »The Rake’s Progress« von Strawinsky und 1976 als Arkel in »Pelléas et Mélisande« mit. 1988 gastierte er an der Oper von Toulouse als Großinquisitor in »Don Carlos« von Verdi. Er sang auf der Bühne das Repertoire für Bass von Händel bis zu Verdi, Wagner und modernen Komponisten. Auch als Konzertbassist in Erscheinung getreten. Er war als Pädagoge in Kapstadt in Südafrika tätig, wo er auch am Opernhaus als Sänger auftrat (u.a. 1994 als Rocco in »Fidelio«, 1995 als Sarastro, 1998 als Crespel in »Hoffmanns Erzählungen«). Er starb 2011 in Johannesburg (Südafrika).
Schallplatten der Marken Columbia und HMV. Auf CBS singt er den Trulove in Strawinskys »The Rake’s Progress«.
Weitere Informationen auf der ihm gewidmeten Homepage: http://dongarrardbass.wordpress.com/
31.7. Gejza ZELENAY: 100. Geburtstag
Er studierte Gesang am Konservatorium von Bratislava (Preßburg) bei Frau Zuravlevá (1947-49), dann bei Enrico Manni in Kosice (1949-52) und nochmals in Bratislava bei J. Godin (1958-60). 1949-58 war er am Theater von Kosice (Kaschau) engagiert, 1958-68 am Nationaltheater von Bratislava. Hier sang er in den Uraufführungen der Opern »Svátopluk« von Eugen Suchon (10.3.1960) und »Mr. Scrooge« von Ján Cikker (1963 den Titelhelden). Seit 1968 kam er dann am Opernhaus von Zürich zu einer erfolgreichen Bühnenkarriere. Er gastierte an der Komischen Oper Berlin, am Nationaltheater Prag, an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg, am Nationaltheater Mannheim, am Staatstheater Karlsruhe, an den Opernhäusern von Lodz, Poznan (Posen) und Wroclaw (Breslau), am Pfalztheater Kaiserslautern und mit dem Zürcher Ensemble in Dresden, Helsinki und beim Festival von Lausanne. Aus seinem umfangreichen Bühnenrepertoire seien nur der Osmin in der »Entführung aus dem Serail«, der Leporello wie der Commendatore in »Don Giovanni«, der Sarastro in der »Zauberflöte«, der Basilio im »Barbier von Sevilla«, der Mustafà in Rossinis »L’Italiana in Algeri«, der Zaccaria in Verdis »Nabucco«, der Pater Guardian in »La forza del destino«, der Ramfis in »Aida«, der Mephisto in »Faust« von Gounod, der Pimen in »Boris Godunow«, der Gremin in »Eugen Onegin«, der Kezal in Smetanas »Die verkaufte Braut«, die vier Dämonen in »Hoffmanns Erzählungen«, der Förster in Janáceks »Das schlaue Füchslein«, der Lothario in »Mignon« von A. Thomas und der Wassermann in »Rusalka« von A. Dvorák genannt. Er wirkte am Opernhaus von Zürich in den Uraufführungen der Opern »Ein Engel kommt nach Babylon« von Rudolf Kelterborn (1977 als 1. Arbeiter) und »Der Kirschgarten« vom gleichen Komponisten (1984 als Stationsvorsteher) mit, außerdem in der Spielzeit 1970-71 in den Schweizer Erstaufführungen von Donizettis »Roberto Devereux« (als Sir Raleigh) und »Bomarzo« von A. Ginastera (als Gian Corrado Orsini). Auch als Konzert- und Rundfunksänger kam er zu einer erfolgreichen Karriere. Er starb 2008 in Zürich.
31.7. Tini SENDERS: 150. Geburtstag
Sie war (unter ihrem eigentlichen Namen Ernestine Senders) während einer Anzahl von Jahren als Chorsängerin am Wiener Carl-Theater beschäftigt. Der Direktor dieses Hauses Jauner übertrug ihr 1897 eine kleine Rolle in der Komödie »Ledige Leute« von J. Dörmann. Dabei zeigte sie ein ganz ungewöhnliches darstellerisches Talent, und nun begann sie eine große Karriere in Operetten, Singspielen, musikalischen Possen, Volksstücken und Komödien. 1899 sang sie die kleine Rolle der Anna in der Uraufführung der Johann Strauß-Operette »Wiener Blut«. Man bewunderte vor allem ihren Vortrag von Wiener Liedern und von komisch-frechen Couplets. 1900-1901 nahm sie an einer Gastspiel-Tournee des Carl-Theaters durch Russland teil. Sie ging dann an das Wiener Orpheum und war 1902-03 am Bunten Theater Berlin und am Berliner Metropol-Theater anzutreffen. In der langen Zeit von 1904 bis 1932 gehörte sie dem Ensemble des berühmten Wiener Burgtheaters an, zu dessen Ehrenmitglied sie ernannt wurde. Sie starb 1941 in Wien.
Schallplatten: G & T (sieben Couplet-Aufnahmen, Wien, 1902).
CD-Buch JULES MASSENET: WERTHER – Version Bariton – Tassis Christoyannis und Véronique Gens in den Hauptrollen; Bru Zane
CD-Buch JULES MASSENET: WERTHER – Version Bariton – Tassis Christoyannis und Véronique Gens in den Hauptrollen; Bru Zane
Veröffentlichung: 24.5.2024
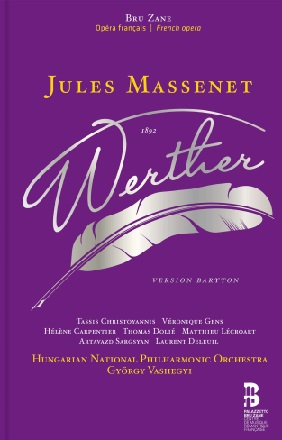
In den meisten Fällen wird die Titelpartie von Massenets schwärmerischer Oper „Werther“ von einem Tenor gesungen. Da gibt es auf Tonträgern die Qual der Wahl. Von der ersten Einspielung 1931 mit Ninon Vallin und Georges Thill über große Stimmen wie Gedda, Kraus, Domingo, Carreras, Vargas, Alagna, Kaufmann, Florez bis zu russisch- bzw. italienisch sprachigen Exoten mit Kozlovksi resp. F. Tagliavini/Gencer reicht das Spektrum. Das sind nur einige Beispiele aus einem über 20 Titeln großen Katalog an verfügbaren Gesamtaufnahmen.
Als Bariton ist mir auf DVD Thomas Hampson bekannt, der live im Pariser Théâtre du Châtelet im April 2004 mit Susan Graham als Charlotte unter der musikalischen Leitung von Michel Plasson den Versuch der Verlebendigung dieser alternativen Version wagte. Es ist ein rarer Fall geblieben, bis György Vashegyi in der Béla Bartók Konzerthalle in Budapest im Februar 2023 einen neuerlichen Vorstoß unternahm.
Eine Bariton-Variante wurde zwar von Massenet selbst autorisiert, als der italienische Bariton Mattia Battistini ihn darum bat, aber nicht vom Komponisten selbst fertig wurde. Wie Alexandre Dratwicki vom Palazzetto Bru Zane im Vorwort festhält, waren für die vorliegende Einspielung zwei Parameter essentiell: das Wort und die Stimmfarben. Ohne berühmten Interpreten nahe treten zu wollen, unterstreicht Dratwicki die Tatsache, dass diese so wortzentrierte Oper keine „linguistische Deformation“ verträgt, wie sie der Internationalisierung der Besetzungen samt ihrer oftmals vorrangig vokalen Opulenz geschuldet sei.
Wenn ein hoher Bariton wie Tassis Christoyannis in der Titelpartie zur Verfügung steht, der noch dazu mit der diffizilen voix mixte spielerisch umgehen kann, ergeben sich tatsächlich ungewöhnliche, interessante und glaubhafte Valeurs einer vielschichtigen emotionalen Sprachausdeutung, ohne auf exquisiten Wohllaut verzichten zu müssen. Dazu gesellt sich als Kontrast eine Charlotte, die nach Vorbild der Crespin oder der Gheorghiu von einem Sopran gesungen wird. Véronique Gens mag vom Vibrato her zwar als eine reifere Charlotte gelten, aber angenehmerweise strapaziert sie nicht das Brustregister. Die im französisch barocken Tragödienfach zu Weltruhm gelangte Sängerin passt mit ihrem dramatischen Gepränge wunderbar zum lyrisch verzückten Werther des Christoyannis. Für Sophie hat man Hélène Carpentier, eine gestandene Susanna oder Micaëla, gewählt. Die Rolle wurde so nicht mit einem federleichten, sondern einem veritablen lyrischen Sopran besetzt. Schmidt wurde hier nicht einem typischen Charaktertenor, sondern einem hohen Tenor (alternative Noten entstammen dem Klavierauszug) anvertraut (Artavazd Sargsyan), Albert traditionellerweise einem Bariton (Thomas Dolié).
Einen enormen Reiz der Einspielung macht die süffige musikalische Leitung von György Vashegyi aus, der mit dem Nationalen ungarischen philharmonischen Orchester einen herrlich transparenten, betörend vibrierenden Klang mit fesselnden dramatischen Höhepunkten vorlegt.
Ich finde, diese Version der feinen Klinge hat ihre besonderen Meriten. Dank der Meisterschaft der beiden Hauptinterpreten ist es eine Aufnahme für Gourmets geworden, die die sprachlichen und klanglichen Details einer ausgefeilten vokalen Personenzeichnung zu schätzen wissen. Eine schöne Ergänzung des Katalogs für alle, die einmal den Werther von einem hervorragenden, eher lyrisch timbrierten Bariton gehört haben wollen.
Dr. Ingobert Waltenberger
KS Olivera Miljakovic zum 90. Geburtstag – 24.4.2024
KS Olivera Miljakovic zum 90. Geburtstag

Als ich noch als Halbwüchsiger Olivera Miljakovic Mitte der Siebzigerjahre als Papagena das erste Mal in der Wiener Staatsoper erlebt habe, habe ich mich auf Anhieb in sie verliebt. Mit ihrer herzlichen Art, mit der sie ihre Partien auszustatten wusste, machte sie es dem Publikum nicht schwer sie zu lieben. Dies war eigentlich auch ihr Markenzeichen, sie sang nicht nur mit ihrer bezaubernden Sopranstimme, sondern vor allem mit ihrem Herzen. Ihre musikalischen Qualitäten waren genauso wichtig wie ihre unbeschreibliche Gesangskultur, die in der Leichtigkeit und Souveränität ihrer Stimme in jeder Situation zum Ausdruck kam, dazu gesellte sich ihre Schönheit und ihr außergewöhnliches schauspielerisches Talent.
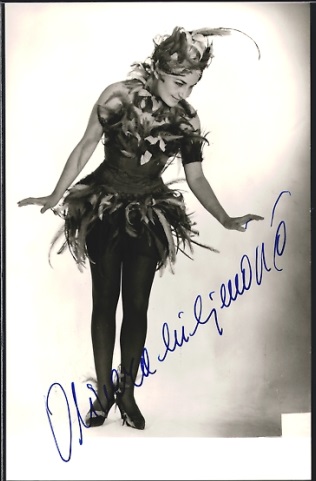
Olivera Miljakovic als Papagena.
Eigentlich wollte sie ja Pianistin werden, studierte dann Kunstgeschichte und ließ sich von Freunden dann doch noch zum Gesangsstudium überreden. Die berühmte italienische Primadonna Gina Cigna gab ihr den letzten Schliff, bevor sie ihre Karriere zunächst in Belgrad startete. Sie träumte immer davon einmal eine Aufführung an der Wiener Staatsoper besuchen zu dürfen. Dass sie einmal hier singen würde, das hätte sie wohl zu diesem Zeitpunkt nicht einmal zu träumen gewagt. Die Altistin Biserka Cvejic, die bereits seit 1960 an der Wiener Staatsoper engagiert war, riet ihr doch mal in Wien vorzusingen. So reiste Olivera Miljakovic nach Wien, sang Herbert von Karajan vor und wurde von diesem sofort engagiert.
Im Oktober 1962 gab sie dann (im Redoutensaal) ihr Debüt als Despina in „Cosi fan tutte“. Dann ging alles ziemlich schnell, die erste Vorstellung im Haus am Ring war der Oscar im „Maskenball“ (mit Leyla Gencer, Biserka Cvejic, Giuseppe Zampieri und Aldo Protti als Partnern), und nach dem Cherubino im Redoutensaal folgten bereits die ersten Premieren: der Siebel in „Faust“ (damals noch unter dem Namen „Margarethe“) unter Georges Prêtre und die Damigella in Monteverdis „Die Krönung der Poppea“ unter Herbert von Karajan. 32 Jahre blieb sie ein treues Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, an der sie in mehr als 770 Vorstellungen aufgetreten ist.
Herbert von Karajan holte sie dann auch zu den Salzburger Festspielen, wo sie unter seiner Leitung den Fjodor in „Boris Godunow“, die Frasquita in „Carmen“ und die Zerlina in „Don Giovanni“ sowie unter Karl Böhm die Susanna in „Le nozze di Figaro“ und die Echo in „Ariadne auf Naxos“ gesungen hat. Außerdem sah man sie dort auch als Serpina in Pergolesis „La Serva Padrona“. Karl Böhm holte sie dann auch an die Deutsche Oper Berlin und zu den Bayreuther Festspielen (als Hirtenknabe in „Tannhäuser“). Im Mittelpunkt ihres Repertoires standen vor allem Mozart-Partien (Ilia, Blondchen, Cherubino, Susanna, Zerlina, Despina, Papagena) und Richard Strauss (Sophie, Zdenka), aber auch die Marzelline in „Fidelio“, das Ännchen im „Freischütz“, der Ighino in „Palestrina“ und die Nannetta in „Falstaff“ von Verdi.
Eine ihrer Lieblingspartien war der Jano in „Jenufa“. Als sie in der Ära Maazel plötzlich nicht mehr den Jano sondern die Karolka in derselben Oper singen sollte, war sie zunächst sehr enttäuscht. Doch mit ihrer Professionalität und immerwährenden Begeisterung wandte sie sich dieser neuen Aufgabe zu und gestaltete die Rolle dermaßen sympathisch, dass man zum ersten Mal verstand, warum Stewa lieber sie heiraten möchte. Auch ihre warmherzige Schwester Genoveva in „Schwester Angelica“ wird einem immer in Erinnerung bleiben.
So glücklich, wie ihr Engagement an der Staatsoper begann, so glücklich ging es auch zu Ende. Als Carlos Kleiber 1994 für drei Vorstellungen des „Rosenkavalier“ noch einmal an die Staatsoper zurückkehrte, stand die für die Rolle der Leitmetzerin vorgesehene Sängerin bei Probenbeginn noch nicht zur Verfügung. Olivera Miljakovic schleppte sich mit Krücken (ich weiß nicht mehr ob in Folge eines Unfalls oder einer Operation) in die Staatsoper, um die Proben zu übernehmen. Carlos Kleiber war von ihr begeistert und bestand darauf, dass sie nicht nur in den drei Vorstellungen an der Staatsoper sondern auch in den Aufführungen im Rahmen eines Japan-Gastspiels in der nächsten Spielzeit singen sollte. So kam es, dass Olivera Miljakovic, zu diesem Zeitpunkt bereits in Pension, ihre letzten Staatsopernabende im fernen Japan absolvierte.
Bereits während ihrer aktiven Laufbahn begann sie Gesang zu unterrichten und sie tat dies mit Begeisterung, zunächst im Opernstudio der Wiener Staatsoper, dann auch privat. Zusätzlich gab sie Meisterklassen auf der ganzen Welt. Als Olivera Miljakovic im Musikverein in einem Konzert anlässlich ihres 50-jährigen Bühnenjubiläums noch einmal die Rosenarie der Susanna sang, klang ihre Stimme immer noch unglaublich jung und frisch. Sie hat sich diese Jugendlichkeit nicht nur in ihrer Stimme bewahrt. Die Unterrichtstätigkeit, die sie bis heute ausübt, hält sie jung und hat ihr geholfen so manchen Schicksalsschlag zu bewältigen.
Liebe Olivera, alles Gute zum Geburtstag und danke für so viele unvergessliche Abende.
Walter Nowotny
BERLIN/ Deutsche Oper: ANNA BOLENA -Premiere
BERLIN / Deutsche Oper ANNA BOLENA, Premiere, 15.12.2023
Unter einem Unstern: Übernahme der Produktion des Opernhauses Zürich in der Regie von David Alden

Federica lombardi. Foto: Bettina Stöß
Angesagte Sensationen finden in der Regel nicht statt. Allerdings hatten die Erwartungen an die nun Berliner „Anna Bolena“ mehr verhießen als einen langweiligen Opernabend mit einer völlig überforderten Titelinterpretin in einer auf Personenregie weitgehend verzichtenden Produktion.
Die Tragedia lirica in zwei Akten „Anna Bolena“, 35. Oper Donizettis, ist Historiendrama, romantische Oper, Belcantovehikel und – da kommen wir nicht darum herum – Zugpferd für eine dramatische Sopranistin, die dieses Fach in allen Verästelungen von Diktion, Phrasierung, Verzierungen und Legato beherrscht und das Publikum mit Charisma und blitzenden Spitzentönen vom Hocker reißt. Gar nicht zufällig war es das Verdienst von Callas, Gencer & Co, dass diese bis 1957 völlig vergessene Oper wieder ins Bewusstsein des Publikums wie der Fachpresse rückte. Das Schicksal der abgehalfterten Ehefrau und Königin, die, weil sie der nächsten Anwärterin auf das Bett des Heinrich VIII. den Weg verstellt, vom Gericht kurzerhand wegen vorgeschobenen Ehebruchs zum Tod verurteilt wird, inspirierte Donizetti zu neuen Höhenflügen an so etwas wie dramaturgischer Wahrhaftigkeit. Dabei ist es unerlässlich, dass die Titelrolle vor Tragik und bis zum Wahnsinn wütender Auflehnung gegen das Schicksal trieft, die Stimme als Wunderkasten von den ständig wechselnden Befindlichkeiten der Heroine in pastos aufgetragenen Farben mit ständig changierenden Schattierungen erzählt und die finale vokale Zirkusnummer „Coppia iniqua estrema vendetta“ in aller vokalen Entäußerung fetzt, was das Zeug hält.
Federica Lombardi, die sich in diesem heiklen Fach versucht, ist ein tolle Mozart-Sängerin, beispielsweise eine vom kühlen instrumentalen Ton her ideale Figaro Gräfin. Ihr in der Substanz lyrischer Sopran wartet mit fein gesponnenen Legatobögen auf, kann Piano und auf gepflegte Art und Weise weite Phrasen gestalten. Auf der Sollseite stehen ein kaum belastbares unteres Register, eine wenig verständliche Diktion und mangelnde Wort-Tonverzahnung sowie eine fragil spitze, nicht durchschlagskräftige Höhe. Zudem reicht das Volumen ihres Soprans nicht, um sich im Riesenhaus der Deutschen Oper Berlin gegen Chor und Orchester im dramatischen Schluss erster Akt und im zweiten Akt beispielsweise im Duett gegen die mächtig auftrumpfende Giovanna der Vasilisa Berzhanskaya zu behaupten – wenngleich „Dio che mi vedi in core“ noch die überzeugendste Szene des Abends bleiben wird.
Da nützt es nichts, dass Lombardi „Oh! dove mai ne andarono“ und „Piangete voi“ in nobel verschattetes Rembrandtdunkel taucht, wenn am Schluss der Oper beim stimmlichen Offenbarungseid der Stretta zweimal die Höhe total versagt. Lombardi bleibt auch von der Darstellung her allzu statisch und wirkt zwischendurch wie ferngesteuert. Passion und lodernde Gefühle der Titelheldin, auf die wartet man an diesem Abend vergeblich. Die Schlussfolgerung lautet: Lombardi ist in diesem Fach gehörig fehlbesetzt.
Damit des stimmlichen Ungemachs nicht genug. Was für ein Pech, dass ausgerechnet der stilistisch im Belcanto so sattelfesteste und strahlend höhensichere René Barbera als Lord Riccardo Percy unter einer schweren Erkältung litt, die immer wieder in Hustenanfälle ausartete. Er ließ sich vor der Vorstellung als indisponiert, aber auf dem Weg der Besserung, ansagen. Zudem verdient es alle Bewunderung, wie dieser hoch professionelle Sänger mit einer felsensicheren Gesangstechnik und laserscharfen Projektion trotz aller krankheitsbedingten Einschränkungen beispielhaft vorführte, wie Belcanto funktioniert.

Federica Lombardi, Riccardo Fassi. Foto: Bettina Stöss
Der junge spielfreudige Bassbariton Riccardo Fassi als Enrico VIII. lieh seinen wohlklingenden, jedoch klein dimensionierten Bassbariton diesem hormongesteuerten, brutalen Machokönig. Statur und Gefährlichkeit der Figur blieben aber, auch wegen einzelner Regiegags, die ihn als einen Clown der Macht denunzierten, weitgehend auf der Strecke.
Die mit Abstand beste gesangliche Leistung des Abends bot die russische Mezzosopranistin Vasilisa Berzhanskaya als Annas Hofdame und Gegenspielerin um die Gunst des Königs Giovanna Seymour. Sie verfügt über einen in allen Lagen gleichermaßen anspringenden, hell getönten, robusten Mezzo, der keine Grenzen in Stimmumfang und Ausdauer zu kennen scheint. Sie kann zudem da punkten, wo es Federica Lombardi zu fehlen scheint: eine komplett aus dem Wort schöpfende hochdramatische Gestaltung der Rezitative, unbändige Leidenschaft und Squillo. Die Spitzentöne platziert sie sicher und mit stählerner Kante.

Riccardo Fassi, Vasilia Berzhanskaya. Foto: Bettina Stöss
Karis Tucker als unter Folter Anna belastender Page Smeton verfügt über einen aparten Mezzo. Das Hin und Hergerissensein in seinen Gefühlen für seine Chefin gestaltet die Sängerin überzeugend. Warum die Regie aber den jungen Springinsfeld als Musiker und dauernotenschreibenden Komponisten charakterisieren will, bleibt ein Rätsel. In kleineren Rollen waren Padraic Rowan (Lord Rochefort) und Chance Jonas-O’Toole zu hören.
Gehörigen Anteil daran, warum der Abend nicht zündete und kaum je ein Funke übersprang, trug Dirigent Enrique Mazzola. Er trimmte das Orchester der Deutschen Oper auf gleichförmig leise Töne, ließ es in unendlichen Melodien schwelgen und lyrisch differenziert aufspielen. Dramatische Höhepunkte wusste Mazzola hingegen nicht zu nutzen, Spannung und Drive fehlten weitgehend. Der Chor agierte aufgabenadäquat, stand aber wie in einer konzertanten Aufführung bis auf den psychedelischen Schluss und bisweilen guckfensterplatziert kommentierend am Rand des Geschehens.
Im steinern kahlwändigen Einheitsbühnenbild mit fallweise herabgelassener Holzpaneelwand (Ausstattung Gideon Davey) und soften Horrorvideos von Rubi Voigt (aus Wolken sich formende fletschende Hunde, Totenköpfe) plustert David Alden die Aktion mit ironischem Beiwerk (Schirme, metikulös rasentrimmende Gärtner, schwarzlederne Pupplays) unnötig auf. Dagegen fehlt eine Personenregie, die den Namen verdient. Die Beziehung der Figuren zueinander findet kaum eine szenische Entsprechung. Als isoliert kaum verständliche Zutat aus Zürich, wo Donizettis gesamte Tudor-Trilogie zur Aufführung kam (Premiere am Opernhaus Zürich mit Diana Damrau und Karine Deshayes, in den weiblichen Hauptrollen war am 5. Dezember 2021) hat die Regie die Figur der kleinen Elisabeth (Mirabelle Heymann) übernommen. Sie soll die Klammer zu „Roberto Devereux“ bilden, weil Anna Bolenas Tochter später Elisabetta I. und damit die tragische Heldin in Donizettis Liebesdrama sein wird. So geistert sie ohne dramaturgischen Nutzen durch die Szene.
Fazit: Ein Opernabend, der viel versprach und wenig bot. Laue Buhs und lauer Applaus. Schade!
Fotos (c) Bettina Stöß
Dr. Ingobert Waltenberger
IN MEMORIAM-GEBURTSTAGE IM OKTOBER 2023
IN MEMORIAM-Geburtstage im Oktober 2023
Berücksichtigt wurden runde und halbrunde Geburtstage.
Zusammenstellung derListe: Walter Nowotny
1.10. Michail TSCHERGOFF: 95. Geburtstag
Er studierte zunächst an der Universität von Sofia Pädagogik und Philosophie und ließ dann seine Stimme durch die Pädagogen Ilia Jossifow und Iwan Popow in Sofia ausbilden. 1954-60 gehörte er dem Staatlichen a-capella-Chor »Swetoslaw Obretenow« an. 1961 begann er seine Bühnentätigkeit mit einem Engagement an der Volksoper von Vraza, wo er bis 1963 blieb (Debüt 1961 als Nemorino in »L‘Elisir d’amore«). 1963-65 trat er am Musiktheater Stefan Makedonski in Sofia auf und begann dann eine Tätigkeit an Bühnen in der DDR. 1966-68 war er am Theater von Rostock engagiert, wo er u.a. als Max im »Freischütz«, als Alvaro in Verdis »Macht des Schicksals«, als Dimitrij in »Boris Godunow« und als Pedro in »Tiefland« von d’Albert erfolgreich auftrat. 1968-70 war er Mitglied des Theaters von Görlitz, 1970-71 des Theaters von Brandenburg, dann des Theaters von Stralsund. Als Höhepunkt in seinem sehr vielgestaltigen Bühnenrepertoire erwies sich jetzt vor allem die Titelpartie in Verdis »Otello«, die er auch 1971 bei einem Gastspiel an der Nationaloper von Warschau vortrug. 1971 gastierte er am Schlesischen Theater von Bytom (Beuthen) als Des Grieux in Puccinis »Manon Lescaut«, als Canio im »Bajazzo« und als Otello. 1973 wurde er als erster Tenor an das Staatstheater von Schwerin berufen, an dem er zwanzig Jahre hindurch wirkte. Gastspiele führten ihn an das Nationaltheater Weimar (1988 als Otello), an die Theater von Greifswald, Halberstadt, Neustrelitz und an das Opernhaus von Frankfurt a.M. (1986). Konzerte und Liederabende brachten in Berlin, in weiteren deutschen Städten, in Tallinn (Reval) und 1985 bei einer Bulgarien-Tournee Erfolge. Das Repertoire des Künstlers für die Opernbühne hatte seine weiteren Höhepunkte in Partien wie dem Calaf in »Turandot« von Puccini, dem Don José in »Carmen«, dem Florestan in »Fidelio«, dem Tannhäuser, dem Pinkerton in »Madame Butterfly«, dem Siegmund in der »Walküre«, dem Turiddu in »Cavalleria rusticana«, dem Rodolfo in »La Bohème« und dem Erik in »Der fliegende Holländer«. Seit 1990 trat er in einigen Bariton-Partien (Rigoletto, Renato im »Maskenball« von Verdi) auf. 1999 hörte man ihn am Staatstheater Schwerin als Oberst in »Die Gespenstersonate« von A. Reimann. Er starb im Dezember 2010.
1.10. Karl Franz RANKL: 125. Geburtstag
Er war ein Sohn des Landwirts Franz Rankl und der Rosina Stubner. Er heiratete 1928 Adele Jahoda (1903–63). Rankl studierte 1918-21 bei Arnold Schönberg und Anton von Webern in Wien. Zunächst Kapellmeister an der dortigen Volksoper, war er 1925-27 Operndirektor am Stadttheater Reichenberg. 1927/28 Dirigent am Stadttheater Königsberg, 1928-31 Assistent Otto Klemperers und Kapellmeister an der Kroll-Oper in Berlin, 1931/32 Generalmusikdirektor des Stadttheaters in Wiesbaden und 1933–37 Opernchef am Landestheater in Graz. 1937/38 war er am Neuen Deutschen Theater in Prag tätig, wo er 1938 die Uraufführung von Kreneks Zwölfton-Oper Karl V. leitete. Rankl floh mit Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Großbritannien und war 1946–51 musikalischer Direktor der Covent Garden Opera. 1952-57 leitete er das Schottische Nationalorchester in Glasgow und Edinburgh und war 1958-60 musikalischer Direktor der Elizabethan Opera Company in Sydney. Er starb 1968 in Sankt Gilgen bei Salzburg. Rankl komponierte unter anderem acht Symphonien, das Oratorium Der Mensch und die Oper Deirdre of the Sorrows, die als Auftragswerk für das Festival of Britain 1951 entstand, aber bis heute nicht uraufgeführt worden ist.
2.10. Guy CHAUVET: 90. Geburtstag
Als Knabe sang er im Kathedralchor seiner Geburtsstadt Montluçon bei Tarbes. Ausbildung bei Bernard Baillour in Tarbes. Seit 1952 erregte er Aufsehen bei mehreren Gesangwettbewerben. 1953 gewann er als jüngster Bewerber den Concours von Cannes. Nach seinem Militärdienst wurde er 1955 erster Preisträger beim Gesangwettbewerb von Toulouse, 1957 gewann er den Preis »Voix d’Or«, mit dem ein Engagement an die Grand Opéra Paris verbunden war. Dort debütierte er 1959 als 1. Geharnischter in der »Zauberflöte« und hatte sogleich einen glänzenden Erfolg. Er blieb bis 1983 als gefeierter erster Tenor Mitglied dieses Hauses und wurde als Titelheld in »Faust« von Gounod, als Florestan in »Fidelio«, als Cavaradossi in »Tosca«, als Enée in »Les Troyens« von Berlioz, als Jason in Cherubinis »Medée«, als Werther in der Oper gleichen Namens von Massenet, als Turiddu in »Cavalleria rusticana«, als Fernand in »La Favorite« von Donizetti, als Samson in »Samson et Dalila« von Saint-Saëns, als Laça in Janáceks »Jenufa«, als Don José in »Carmen«, als Otello von Verdi
und in vielen anderen Partien bekannt. Am Grand Théâtre Genf hörte man ihn 1960-74 als Cavaradossi, als Dimitri in »Boris Godunow«, als Radames in »Aida«, als Samson und als Énée. 1961 wirkte er beim Holland Festival mit, im gleichen Jahr Gastspiel am Teatro Colón von Buenos Aires, wo er nochmals 1964 auftrat. 1963 debütierte er an der Covent Garden Oper London als Cavaradossi und gab an der Oper von Chicago sein US-Debüt als Faust von Gounod. An der Oper von San Francisco gastierte er 1968-83 als Énée, als Radames, als Don José, als Lohengrin und als Samson. 1969 sang er am Coliseum Theatre London in der (konzertanten) englischen Premiere der Oper »Padmâvati« von A. Roussel. Am Théâtre de la Monnaie in Brüssel gastierte er als Don José, als Siegmund in der »Walküre« und als Parsifal, an der Opéra du Rhin Straßburg als Verdis Otello und als Ratan-Sen in »Padmâvati« von Roussel, in Lyon als Lohengrin und als Kratos in »Prométhée« von Gabriel Fauré. 1971 alternierte er bei den Festspielen von Verona mit Carlo Bergonzi in der Partie des Radames bei der Hundertjahrfeier von Verdis »Aida«. An der Mailänder Scala hörte man ihn 1971 als Samson, 1972 als Don José und als Radames. 1973 gastierte er am Opernhaus von Marseille als Tambourmajor in »Wozzeck« von A. Berg. Als Lohengrin gastierte er in Berlin und in Osaka. Er gastierte an der Oper von Rio de Janeiro als Otello und an der Wiener Staatsoper als Énée (1976-77 in insgesamt 7 Vorstellungen). An der Metropolitan Oper New York debütierte er 1977 als Samson und sang dort bis 1981 in insgesamt 47 Vorstellungen auch den Don José, den Radames und den Jean in »Le Prophète« von Meyerbeer. In Monte Carlo, am Teatro San Carlos Lissabon, in Dublin und bei einer Tournee durch Israel war er gleichfalls sehr erfolgreich. 1985 nahm er von der Bühne Abschied und wurde Professor an der École Nationale du Musique in Tarbes wie am Conservatoire National de Paris. Er starb 2007 in Espoey.
Zahlreiche Schallplattenaufnahmen, vor allem auf Véga (Querschnitte durch »Hérodiade« und »Werther« von Massenet, »Cavalleria rusticana«, Szenen und Arien aus »Les Troyens« von Berlioz). Auf BJR vollständige Oper »Sigurd« von Reyer, auch auf HMV (Kurzfassung von »Les Troyens« mit Régine Crespin).
3.10. Karl HELM: 85. Geburtstag
Jüngerer Bruder des Bass-Baritons Hans Helm (* 1934), der an der Wiener Staatsoper wirkte. Er studierte wie sein Bruder bei Else Zeidler in Dresden und bei Franz Reuter-Wolf in München. Bühnendebüt 1968 am Stadttheater von Bern (Schweiz) als Don Alfonso in »Così fan tutte«. Seit 1971 war er für mehr als 25 Jahre Mitglied der Staatsoper München, an der er 1970 als Rocco in »Fidelio« erstmals gastiert hatte. Dort wirkte er auch 1978 in der Uraufführung der Oper »Lear« von A. Reimann (als König von Frankreich) mit. Er ist auch an den Opernhäusern von Basel und Genf (1968-71 als Mose in Rossinis »Mose in Egitto«, als Bote in »Antigonae« von C. Orff und als Lazare Carnot in Jan Cikkers »Das Spiel von Liebe und Tod«), an der Grand Opéra Paris, an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg, an den Staatsopern von Hamburg und Stuttgart und am Staatstheater Karlsruhe aufgetreten. 1978 gastierte er beim Festival von Perugia. 1987 Gastspiel an der Staatsoper Berlin in »La Cenerentola« von Rossini. Sein Repertoire enthielt eine Vielzahl seriöser wie Buffo-Rollen für Bass: den Arkel in »Pelléas et Mélisande«, den König Philipp in Verdis »Don Carlos«, den Zaccaria in »Nabucco«, den Fra Melitone in »La forza del destino«, den Warlaam in »Boris Godunow«, den Fasolt im »Rheingold«, den Falstaff in Nicolais »Die lustigen Weiber von Windsor«, den Dulcamara in »L‘Elisir d’Amore«, den Kothner in »Die Meistersinger von Nürnberg« und den Geronte in »Manon Lescaut« von Puccini. Noch 1997 sang er in München den Pfleger des Orest in »Elektra« von R. Strauss und den Nachtwächter in »Die Meistersinger von Nürnberg«, 1998 in der Uraufführung der Oper »Was ihr wollt« von Manfred Trojahn den Antonio. Neben seinem Wirken auf der Bühne auch im Konzertsaal hervorgetreten. Er starb im August 2012.
Schallplatten: Orfeo (»Die Feen« von R. Wagner), DGG (»Lear« von A. Reimann), EMI (»Friedenstag« von R. Strauss).
3.10. Hubert HOFMANN: 90. Geburtstag
Er war ein Schüler des berühmten Bassisten Ludwig Hofmann, dessen Namen er annahm. 1957 Debüt am Landestheater Salzburg als Monterone in Verdis »Rigoletto«. Bis 1959 in Salzburg, 1959-61 am Stadttheater Bielefeld und 1961-63 am Stadttheater Mainz engagiert. 1962-66 war er Mitglied der Städtischen Oper (Deutsche Oper) Berlin und gleichzeitig 1963-66 des Opernhauses von Graz. 1967-72 sang er an der Staatsoper von Hamburg und am Opernhaus Zürich, 1972-82 an der Staatsoper von Stuttgart. 1963-68 gastierte er an der Wiener Staatsoper als Wotan im »Rheingold« und in der »Walküre« (in insgesamt vier Vorstellungen). 1964 trat er bei den Festspielen von Bayreuth als Wanderer in »Siegfried« und als Biterolf in »Tannhäuser« auf, 1968 als Wotan in der »Walküre« an der Oper von San Francisco. 1969 und 1971 gastierte er an der Covent Garden Oper London als Hans Sachs. Weitere Gastspiele, vor allem in seinen Glanzrollen, dem Wotan im Nibelungenring und dem Hans Sachs in »Die Meistersinger von Nürnberg«, 1967 an der Königlichen Oper Kopenhagen, 1970 und 1973 am Teatro Fenice Venedig, 1971-72 an der Grand Opéra Paris, 1971-72 auch an der Oper von Chicago, 1977 an der Oper von Rom. 1963 wirkte er in Graz in der österreichischen Premiere der Oper »Der feurige Engel« (»L’Ange de feu«) von Prokofjew in der Partie des Ruprecht mit; bei dem Gastspiel der Hamburger Staatsoper anlässlich der Weltausstellung von Montreal 1967 kreierte er für Kanada den Titelhelden in »Mathis der Maler« von Hindemith. Aus seinem Bühnenrepertoire sind noch der Amfortas in »Parsifal«, der Titelheld in »Der fliegende Holländer«, der Pater Guardian in »La forza del destino« von Verdi, der Amonasro in »Aida«, der Don Pizarro in »Fidelio«, der Kaspar im »Freischütz«, der Orest in »Elektra« von R. Strauss und der Fürst Igor in der gleichnamigen Oper von Borodin zu erwähnen. 1982 gab er seine Karriere wegen Erkrankung auf. Er starb 1988 in Hüttenberg im Allgäu.
Schallplatten: HMV-Electrola (Monterone in »Rigoletto« in einer deutschsprachigen Aufnahme der Oper), Mondo Musica (Amfortas in »Parsifal«, Teatro Fenice Venedig 1978).
3.10. Irene SALEMKA: 95. Geburtstag
Sie begann das Gesangstudium bei Ernesto Bardini und Hermann Geiger-Torel in Toronto. 1955 trat sie erstmals auf der Bühne auf, und zwar sang sie an der Oper von Montreal die Juliette in »Roméo et Juliette« von Gounod. Weitere Studien bei Hans Löwlein in Frankfurt a.M. Ihre großen Erfolge kamen mit ihrem Auftreten an deutschsprachigen Bühnen zustande. 1956-57 war sie am Stadttheater von Basel verpflichtet, 1957-64 gehörte sie dem Opernhaus von Frankfurt a.M. an und trat als Gast an den Staatsopern von Stuttgart und München, an den Opernhäusern von Köln, Essen, Hannover und Wuppertal auf. Sie gastierte an der Niederländischen Oper Amsterdam, an der Covent Garden Oper London (1961 als Helena in »A Midsummer Night’s Dream« von B. Britten), an der Wiener Volksoper, in Washington, New Orleans und beim Edinburgh Festival (1961 als Helena in »A Midsummer Night’s Dream« von B. Britten anlässlich eines Gastspiels der Londoner Covent Garden Oper). Im englischen Fernsehen BBC erschien sie als Marguerite in Gounods »Faust«. Sie sang auf der Bühne Partien aus dem lyrischen wie dem Koloraturfach, im Konzertsaal ebenfalls eine Vielfalt von Vokalwerken. Sie trat auch in musikalischen Tonfilmen auf; so sang sie in dem Film »Die lustige Witwe« die Hanna Glawari als Partnerin von Johannes Heesters. Sie starb 2017 in Collingwood (Ontario).
Schallplatten: Donna Elvira in einem »Don Giovanni«-Querschnitt bei DGG.
3.10. Stanisław SKROWACZEWSKI: 100. Geburtstag
Er erlernte als Kind Geige und Klavier. Im Alter von elf Jahren debütierte er als Pianist und machte sich schnell einen Namen. Mit dreizehn dirigierte er erstmals ein Orchester. Eine im Zweiten Weltkrieg erlittene Handverletzung beendete seine Pianistenkarriere. Nach dem Krieg wurde Skrowaczewski 1946 Musikdirektor der Breslauer Philharmonie. Dann folgten Chefposten in Warschau, Katowice und Krakau. Schließlich wurde er Chefdirigent des Warschauer Nationalorchesters. Nach seiner Ausbildung an der Musikakademie Krakau in Polen setzte Skrowaczewski seine Kompositionsstudien in Paris bei Nadia Boulanger fort. Im Jahre 1956 gewann er den Santa Cecilia Wettbewerb für Dirigenten. Auf Einladung von George Szell dirigierte Skrowaczewski das renommierte Cleveland Orchestra. Gastdirigate bei anderen amerikanischen Orchestern wie etwa dem New York Philharmonic folgten. 1960 wurde er zum Musikdirektor des Minneapolis Symphony Orchestra ernannt. Dieses prägte Skrowaczewski maßgeblich bis zum Jahre 1979; als herausragend gilt seine Einspielung von Ravels Bolero aus dem Jahre 1975, die 2003 noch einmal in technisch überarbeiteter Version auf Super-Audio-CD veröffentlicht wurde. Seit dieser Zeit war er Ehrendirigent des Orchesters. 1984-91 war Skrowaczewski Chefdirigent des Hallé Orchestra. Als Gastdirigent erhielt er regelmäßig Einladungen nach Nord- und Südamerika, Australien, Japan und in zahlreiche Städte Europas. Seit dem Jahre 1994 war Skrowaczewski Erster Gastdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters (RSO) Saarbrücken beziehungsweise der heutigen Deutschen Radio Philharmonie. Mit dem RSO Saarbrücken spielte er sämtliche Sinfonien Anton Bruckners ein und erhielt dafür im Jahre 2002 den Cannes Classical Award. Im Frühjahr 2007 wurde die Einspielung aller Beethoven-Sinfonien, die den Diapason d‘or erhielt, abgeschlossen. Außerdem veröffentlichte er Gesamtaufnahmen der Sinfonien von Robert Schumann mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester (RSO) Saarbrücken und von Johannes Brahms mit der Deutschen Radio Philharmonie. Unter anderem spielte er auch mit Ewa Kupiec als Solistin und dem Rundfunk-Sinfonieorchester (RSO) Saarbrücken die beiden Klavierkonzerte von Frédéric Chopin auf CD ein. Mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester (RSO) Saarbrücken beziehungsweise der heutigen Deutschen Radio Philharmonie nahm er auch eigene Werke auf CD auf wie die Fantasie per flauto ed orchestra „Il piffero della notte“ mit Roswitha Staege als Solistin, das Kammerkonzert (Ritornelli poi ritornelli) (Chamber Concerto), das Konzert für Klarinette und Orchester mit Richard Stoltzman als Solisten, Music at night, die Passacaglia immaginaria und die Symphony in memory of Ken Dayton. Skrowaczewski starb 2017 im Alter von 93 Jahren im Methodist Hospital in St. Louis Park, Minnesota.
Skrowaczewski, der bereits im Kindesalter mit dem Komponieren begonnen hatte, wurde für seine Komposition Passacaglia Immaginaria für den Pulitzerpreis im Jahre 1997 nominiert, ebenso wie für das von ihm komponierte Konzert für Orchester im Jahre 1999. Für seine Arbeit als Musiker erhielt Skrowaczewski unter anderem die höchste polnische Auszeichnung, den Orden vom Weißen Adler und die Goldmedaille der Mahler-Bruckner-Gesellschaft. Am 6. November 2015 wurde Skrowaczewski nach einem Konzert mit der Deutschen Radio Philharmonie in Saarbrücken zum Ehrendirigenten des Orchesters ernannt.
3.10. Ellen BECK: 150. Geburtstag
Sie gab bereits 1891 ein erstes Konzert in Kopenhagen, wurde dann aber durch Algot Lange in Kopenhagen und durch Deveillier in Paris weiter ausgebildet. 1898 kam es zu ihrem professionellen Konzertdebüt in der dänischen Metropole, 1901 zu ihrem Bühnendebüt an der Königlichen Oper Kopenhagen in der Partie der Frau Ingeborg in »Drot og Marsk« von Heise. Sie konnte sich jedoch nicht zu einer eigentlichen Bühnenkarriere entschließen und gab diese nach einigen Versuchen an der Kopenhagener Oper bald wieder auf. Bekannt wurde die Künstlerin vor allem durch ausgedehnte Konzerttourneen, die sie in die Hauptstädte der skandinavischen Staaten, nach England, Deutschland, Irland Frankreich, Russland und in die Schweiz führten. Neben Opernarien brachte sie ein breit gefächertes Repertoire von Kunstliedern wie von skandinavischen Volksweisen zum Vortrag. Seit 1921 war sie in Kopenhagen als gesuchte Gesanglehrerin tätig. 1916 wurde sie vom dänischen König mit dem Orden »Ingenio et arti« ausgezeichnet. Sie starb 1953 in Kalundborg.
Die Sängerin hat eine Vielzahl von Schallplattenaufnahmen hinterlassen, die ältesten auf G & T (Kopenhagen, 1903-05); es schlossen sich Aufnahmen auf den Marken Zonophone (1906), HMV, Pathé-Platten und -Zylinder an.
5.10. Vincenzo BATTISTA (italienischer Komponist): 200. Geburtstag
6.10. Udo ZIMMERMANN: 80. Geburtstag
Er war 1954-62 Mitglied im Dresdner Kreuzchor unter Rudolf Mauersberger, welcher erste Kompositionen betreute und mit dem Chor aufführte. Nach dem Abitur studierte er an der Dresdner Musikhochschule bei Johannes Paul Thilman Komposition, außerdem Dirigieren (bei Rudolf Neuhaus) und Gesang. Er wurde 1968 Meisterschüler bei Günther Kochan an der Deutschen Akademie der Künste Berlin und arbeitete zwei Jahre als Assistent des Musiktheaterregisseurs Walter Felsenstein. 1970 wurde er Dramaturg für zeitgenössisches Musiktheater an der Staatsoper Dresden, wo er bis 1985 wirkte. Ab 1976 war er Dozent und ab 1979 Professor für Komposition an der Dresdner Musikhochschule; zu seinen Schülern gehörten Annette Schlünz, Caspar René Hirschfeld, Friedhelm Hans Hartmann und Jan Trieder. 1974 gründete Zimmermann das Dresdner „Studio Neue Musik“, aus dem 1986 in Dresden-Loschwitz das Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik hervorging, das sich als Forschungszentrum und Ausrichter von Konzerten und Festivals (Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik) einen internationalen Ruf in der Szene der Neuen Musik erworben hat. 2004 überführte er es in das Europäische Zentrum der Künste Hellerau, das er bis 2008 als Intendant leitete. 1985-90 leitete Zimmermann die Werkstatt für zeitgenössisches Musiktheater an der Oper Bonn. 1990-2001 war er Intendant der Oper Leipzig; auch hier galt sein Engagement besonders dem Musiktheater des 20. Jahrhunderts, zahlreiche Uraufführungen u. a. von Karheinz Stockhausen, Dieter Schnebel und Jörg Hechet fanden in dieser Zeit statt, das Opernhaus wurde mehrfach ausgezeichnet. Die Hälfte seiner Neuproduktionen waren moderne Stücke und Uraufführungen, die mit namhaften Persönlichkeiten des Regietheaters – so zum Beispiel Ruth Berghaus, Peter Konwitschny, George Tabori – zum Erfolg beitrugen. 1997-2011 hatte er die künstlerische Leitung der Reihe musica viva des Bayerischen Rundfunks inne und brachte hier in den 14 Jahren seines Wirkens 175 Werke zur Uraufführung. 2001-03 war er Generalintendant der Deutschen Oper Berlin. 2004-08 entwickelte er als Gründungsintendant des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau u. a. in Zusammenarbeit mit dem Choreografen William Forsythe das historische Festspielhaus Hellerau zu einem wichtigen Standort für die zeitgenössischen Künste. 1993 und 1995 war Zimmermann Composer in Residence bei den Salzburger Festspielen. Als Dirigent gastierte er ab 1979 u. a. bei den Berliner Philharmonikern, Wiener Symphonikern, beim Gewandhausorchester, Symphonieochester des Bayerischen Rundfunks, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, NDR Sinfonieorchester, Tonhalle-Orchester Zürich und bei der Staatskapelle Dresden. Zudem wurde er an den Opernhäusern Wien, Hamburg, München und Bonn tätig. 1983 wurde er zum Ordentlichen Mitglied der Akademie der Künste der DDR berufen. 1985-89 war er Vorstandsmitglied des Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR. Zimmermann war Mitglied der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg, deren Sektion Musik er 2003-08 als Direktor vorstand, der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, der Freien Akademie der Künste zu Leipzig (Präsident 1992-97), der Sächsischen Akademie der Künste (Präsident 2008-11), der Freien Akademie der Künste Hamburg und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. 1996-2001 war er Präsident des Sächsischen Kultursenats. 2008 wurde er zum Officier des Ordre des Arts et des Lettres ernannt. Ab 2009 war Zimmermann mit Saskia Leistner verheiratet. Seiner ersten Ehe (1967–70) mit Kristina Mann entstammt die Schauspielerin Claudia Michelsen; seiner zweiten Ehe (1970–2007) mit Elzbieta Holtorp entstammen zwei Söhne. Er lebte in Dresden und starb im Oktober 2021.
Zimmermanns Hauptaugenmerk galt dem Musiktheater, er schrieb mehrere Opern, von denen die Weiße Rose (1986) über die Geschwister Scholl internationalen Erfolg hatte; mit fast 200 Produktionen seit ihrer Uraufführung ist sie eine der meistgespielten zeitgenössischen Opern. Die Ästhetik der Stille übernimmt hier den Ausdruck des Abstrakten und fordert die Bewusstwerdung und Rückbesinnung des Individuums auf sich selbst, gegen das Verschweigen der NS-Zeit und als Appell für eine weltoffene Gesellschaft der Zukunft. Weitere Werke dieser Gattung sind u. a. Levins Mühle (nach dem Roman von Johannes Bobrowski), Der Schuh und die fliegende Prinzessin (nach einem Märchen von Peter Hacks) und Die wundersame Schustersfrau (nach Federico García Lorca). Er schrieb außerdem Kammermusik sowie Vokal- und Orchesterwerke. Stilistisch rechnet man ihn zur Neuen Musik; seine musikalische Ausdrucksbreite war vielfältig und orientierte sich an einer jeweiligen plastischen Umsetzung der kompositorischen Aufgabe. Nach einer zwölfjährigen Schaffenspause aufgrund seiner umfangreichen Aufgaben als Intendant war er erst ab 2009 wieder kompositorisch aktiv, u. a. mit zwei Solokonzerten für den Cellisten Jan Vogler (2009) und die Geigerin Elena Denisova (2013).
7.10. Klaus BERTRAM: 90. Geburtstag
Er begann seine Bühnenlaufbahn 1959 am Staatstheater Karlsruhe, schloss dann aber bald einen Gastvertrag mit der Staatsoper Stuttgart, deren Mitglied er in der langen Zeit von 1961 bis 1985 war. 1966 wirkte er an diesem Haus in der Uraufführung der Oper » Siebzehn Tage und vier Minuten« von Werner Egk mit. Gastspiele führten ihn an die größeren deutschen Opernbühnen und ins Ausland. Sein Repertoire umfasste Partien wie den Rocco in »Fidelio«, den Daland (gelegentlich auch den Titelhelden) in »Der fliegende Holländer«, den Scherasmin in »Oberon« von Weber, den Waldner in »Arabella« von R. Strauss, den Boris Godunow, den Selim in Rossinis »Il Turco in Italia«, den Walter in Verdis »Luisa Miller«, den Inigo in »L’Heure espagnole« von M. Ravel und den Dreieinigkeitsmoses in »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny« von Weill. Er war zeitweilig als Rundfunkmoderator tätig und hatte auch als Konzertsänger eine erfolgreiche Karriere. Er starb 1995 in Stuttgart.
Schallplatten: DGG (Colline in Gesamtaufnahme »La Bohème«, Opern-Querschnitte, u.a. Ferrando im »Troubadour«).
7.10. Franziska WACHMANN: 100. Geburtstag
Nach einer Ausbildung als Balletttänzerin war sie 1939-42 als Tänzerin am Theater von Graz engagiert. Sie studierte daneben jedoch Gesang an der Musikhochschule von Graz und debütierte 1942 als Sängerin am Stadttheater von Baden bei Wien. 1943-44 sang sie am Theater von Brünn (Brno) und nahm 1946 am Theater von Graz ihre Sängerkarriere wieder auf. Von dort wechselte sie für die Spielzeit 1949-50 an das Stadttheater von Innsbruck, sang anschließend am Staatstheater von Wiesbaden und gehörte seit 1952 für dreißig Jahre bis 1982 der Staatsoper Stuttgart an. Im Mittelpunkt ihres Repertoires für die Bühne standen Soubrettenpartien in Opern wie in Operetten, darunter die Eurydike in Offenbachs »Orpheus in der Unterwelt« (ihre Antrittsrolle in Stuttgart), die Adele in der »Fledermaus«, die Arsena im »Zigeunerbaron«, die Laura in Millöckers »Der Bettelstudent«, die Christel in Zellers »Vogelhändler«, die Hanna Glawari in Lehárs »Die lustige Witwe«, die Angèle in Lehárs »Der Graf von Luxemburg«, die Mi im »Land des Lächelns«, die Papagena in der »Zauberflöte«, die Despina in »Così fan tutte«, der Cherubino in »Le nozze di Figaro«, die Esmeralda in Smetanas »Die verkaufte Braut«, die Lola in »Cavalleria rusticana« und die Musetta in »La Bohème«. In einem späteren Abschnitt ihrer Karriere wandte sie sich dem lyrischen Stimmfach zu und sang jetzt die Micaela in »Carmen«, die Mimi in »La Bohème« und die Rosalinde in der »Fledermaus«. 1959 sang sie im Rahmen eines Gesamtgastspieles der Stuttgarter Staatsoper an der Wiener Staatsoper eines der Blumenmädchen in »Parsifal«. 1966 wirkte sie in Stuttgart in der Uraufführung der Oper »Siebzehn Tage und vier Minuten« von W. Egk in der Rolle der Astäa mit. Sie trat als Gast am Theater am Gärtnerplatz in München, an der Wiener Volksoper, an der Grand Opéra Paris (1954 als Blumenmädchen in »Parsifal«) und bei den Festspielen von Bregenz (1958 als Esmeralda und als Hanna Glawari) auf. In der Spielzeit 1959-60 gastierte sie am Opernhaus von Zürich als Gräfin in der Johann-Strauß-Operette »Wiener Blut«. 1982 verabschiedete sie sich als Mutter in »Hänsel und Gretel« von ihrem Stuttgarter Publikum. Sie war verheiratet mit dem Regisseur Werner Dobbertin. Sie starb im Jahr 2005.
Schallplatten: Polydor (Operettenszenen), Columbia (»Im Weißen Rössl« von R. Benatzky), Ariola.
7.10. Alfred WALLENSTEIN: 125. Geburtstag
Der Nachfahre Albrecht von Wallensteins wuchs in Los Angeles auf, wo er das Cellospiel erlernte. Als Fünfzehnjähriger trat er als „The Wonder Boy Cellist“ auf. 1917-18 war er Cellist beim San Francisco Symphony Orchestra unter Alfred Hertz. 1919-22 studierte er bei Julius Klengel in Leipzig. Bis 1929 war er erster Cellist des Chicago Symphony Orchestra, daneben unterrichtete er 1927-29 am Chicago Musical College und spielte auch Rundfunkaufnahmen ein. 1929-36 war er erster Cellist des New York Philharmonic Orchestra unter Arturo Toscanini, auf dessen Anregung er ab 1931 auch zu dirigieren begann. Er arbeitete für die Radiostation WOR, deren musikalischer Leiter er 1935-45 war. Hier führte er unter anderem sämtliche Kantaten Johann Sebastian Bachs und alle 26 Klavierkonzerte Mozarts auf. 1942 wurde er für seine Pionierleistungen beim Rundfunk mit dem Peabody Award ausgezeichnet. 1943-56 war er Chefdirigent des Los Angeles Philharmonic Orchestra. Mit diesem Orchester und mit dem Hollywood Bowl Orchestra führte er europäische Werke von Bachs Weihnachtsoratorium über Beethovens Missa solemnis bis zu Mahlers 2. Sinfonie auf, aber auch die großen Werke zeitgenössischer amerikanischer Komponisten wie Samuel Barber, Aaron Copland, Henry Cowell, Paul Creston, David Diamond, Morton Gould und Virgil Thomson. Später wirkte Wallenstein als Gastdirigent bei Festivals und Orchestern in den USA und Europa. Er war auch ein gefragter Dirigent für Schallplattenaufnahmen namhafter Solisten. So spielte er mit dem Pianisten Artur Rubinstein Klavierkonzerte von Mozart, Chopin, Liszt, Grieg, Saint-Saens und Szymanowski ein. Mit dem Geiger Jascha Heifetz entstanden u.a. Aufnahmen der Violinkonzerte von J.S. Bach, Korngold und Castelnuovo-Tedesco. 1958-61 leitete er das Caramoor Festival, 1962-64 betreute er ein Programm für angehende Dirigenten der Ford-Stiftung am Peabody Conservatory, 1968-71 unterrichtete er an der Juilliard School of Music. Seinen letzten Auftritt als Dirigent hatte er einundachtzigjährig 1979 mit dem Orchester der Schule. Er starb 1983 in New York City.
7.10. Eugène DUFRICHE: 175. Geburtstag
Er erhielt seine Ausbildung zum Sänger am traditionsreichen Conservatoire National de Paris und debütierte dort sogleich 1874 an der Opéra-Comique als Jäger in der 100. Aufführung von Meyerbeers Oper »Dinorah«. 1875 sang er an der Opéra-Comique den Zuniga in der Uraufführung der Oper »Carmen« von Bizet (3.3.1875). 1882 verließ er dieses Haus jedoch und begann nun eine umfangreiche Gastspieltätigkeit. 1882 trat er erstmals an der Covent Garden Oper London auf, an der er dann von 1890 bis 1905 fast alljährlich anzutreffen war. Dabei sang er dort Partien wie den Valentin in »Faust« von Gounod, den Telramund in »Lohengrin«, den Jago in Verdis »Otello«, den Escamillo in »Carmen«, den Rigoletto und den Alfio in »Cavalleria rusticana« (1892). 1892 wirkte er an der Covent Garden Oper in der Uraufführung der Oper »Elaine« von Bemberg (die Nellie Melba gewidmet war) mit, 1892 in der Erstaufführung von Massenets »Manon«, 1892 in der von »L‘Amico Fritz« von Mascagni, 1905 in der Premiere von Puccinis »Madame Butterfly«. 1883 gastierte er an der Oper von Monte Carlo, im gleichen Jahr auch an der Hofoper von St. Petersburg, 1885 am Teatro dell’Opera Buenos Aires. In der Saison 1887-88 sang er an der Mailänder Scala den Nelusco in Meyerbeers »Afrikanerin« und den Salomon in der »Königin von Saba« von Goldmark. Er wirkte am Teatro Real Madrid an jenem 8.12.1889 als Zurga in »Les pêcheurs de perles« von Bizet mit, als es auf offener Bühne zum plötzlichen Verlust der Stimme des großen spanischen Tenors Julian Gayarre kam, der zu dessen tragischem Ende führte. 1891 und 1895 (als Alfio und als Albert in »Werther« von Massenet) war er am Teatro San Carlo Neapel, in der Saison 1891-92 an der Grand Opéra Paris als Alphonse in »La Favorite« von Donizetti, als Telramund und als Amonasro in »Aida« zu hören. 1891 sang er am Teatro San Carlo Neapel in der Uraufführung der Oper »Spartaco« von Pietro Platania, 1894 am Teatro Argentina in Rom den Amonasro. In der Spielzeit 1893-94 debütierte er an der New Yorker Metropolitan Oper als Alfio in »Cavalleria rusticana«; er sang dort 1898-1908 Partien wie den Enrico in »Lucia di Lammermoor«, den Kothner in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den Heerrufer in »Lohengrin« und den Grafen in »Le nozze di Figaro«, dann zunehmend Charakterrollen wie den Dr. Bartolo im »Barbier von Sevilla«, den Wagner in »Faust« von Gounod, den Yamadori in »Madame Butterfly«, den Benoît in »La Bohème«, den Dancairo in »Carmen«, den Angelotti in »Tosca«, insgesamt 68 Partien in 11 Spielzeiten. Ende der neunziger Jahre trat er an verschiedenen großen italienischen Opernhäusern, so in Genua und Turin und auch in Madrid als Gast auf. Weitere Partien aus seinem Repertoire für die Bühne: der Titelheld in »Le nozze di Figaro«, der Mercutio in »Roméo et Juliette« von Gounod, der Bellamy in »Les Dragons de Villars« (»Das Glöckchen des Eremiten«) von Maillart, der Lothario in »Mignon« von A. Thomas, der Jupiter in Gounods »Philémon et Baucis« und der Lescaut in Massenets Oper »Manon«.
8.10. Hans WILBRINK: 90. Geburtstag
Sein Vater war ein bekannter holländischer Journalist. Er studierte Gesang und Musik (Kirchenmusik und Dirigieren) am Konservatorium von Utrecht und war dann Schüler von Felix Hupka in Amsterdam. 1955 gewann er den Gesangwettbewerb des Westdeutschen Rundfunks ARD in München und hatte erste Erfolge in seiner holländischen Heimat, einmal als Konzertsänger (1956 Solist in Beethovens 9. Sinfonie in Amsterdam), dann als Pelléas in »Pelléas et Mélisande« auf der Bühne. 1958 wirkte er in Amsterdam in der Uraufführung der Oper »François Villon« von Sem Dresden mit. 1959 ging er nach Deutschland und war dann in den folgenden sieben Jahren bis 1966 Mitglied des Opernhauses von Frankfurt a.M. In den Jahren 1959-61 bestand gleichzeitig ein Gastvertrag mit der Städtischen Oper Berlin. 1966 folgte er einem Ruf an die Staatsoper von München, an der er eine erfolgreiche Karriere entwickelte, die länger als 30 Jahre dauerte. Er wirkte in einer Vielzahl von Opern- Uraufführungen mit, so bereits 1962 in Frankfurt in »Alkestiade« von Louise Talma, 1964 in der von G. Wimbergers »Dame Kobold«, im gleichen Jahr dort auch in »Das Foto des Kolonels« von H. Searle, 1969 in München in »Aucassin und Nicolette« von G. Bialas, 1976 in »Die Versuchung« von J. Tal. 1978 nahm er an der Bayerischen Staatsoper München an der Uraufführung der Oper »Lear« von A. Reimann teil, 1986 an der von »Belshazar« von V.D. Kirchner. Am Prinzregentheater München nahm er am 8.4.1997 an der Uraufführung der Oper »Helle Nächte« von Moritz Eggert teil. Er trat gern in Werken der zeitgenössischen Opernliteratur auf, so als Titelheld in H.W. Henzes »Prinz von Homburg« und als Stolzius in »Die Soldaten« von B.A. Zimmermann. Dabei enthielt sein Bühnenrepertoire jedoch eine Vielzahl von Partien, darunter den Figaro in »Le nozze di Figaro«, den Guglielmo in »Così fan tutte«, den Papageno in der »Zauberflöte«, den Scherasmin in »Oberon« von Weber, den Malatesta in »Don Pasquale«, den Olivier in »Capriccio« wie den Morbio in »Die schweigsame Frau« von R. Strauss, den Mr. Gedge in »Albert Herring« wie den Oberon in »A Midsummer Night’s Dream« von B. Britten. Gastspiele führten den Sänger u.a. an die Staatsoper von Wien (1973 als Olivier), nach Paris (1962 mit dem Ensemble der Frankfurter Oper), an das Opernhaus von Köln (1965) und zu den Festspielen von Glyndebourne, wo er 1963 seine Glanzrolle, den Pelléas, sang. Auch als Konzert- und Oratoriensolist genoss er hohes Ansehen. Er starb 2003 in München.
Schallplatten: Christophorus-Verlag (Messen von Schubert), Music and Arts (9. Sinfonie von Beethoven unter Klemperer, Mitschnitt von 1956), DGG (»La Cenerentola« von Rossini; »Lear« von A. Reimann, München 1978), Schwann (»Gloria« von J.S. Bach), EMI (»Die Meistersinger von Nürnberg«), TIS (9. Sinfonie von Beethoven), BBC Rec. (War Requiem von B. Britten).
8.10. Emilio BARBIERI: 175. Geburtstag
Er arbeitete zunächst im Unternehmen seines Vaters, das medizinische Instrumente herstellte. Es kam schließlich zur Ausbildung seiner Stimme durch den Pädagogen Tito Sterbini in Pisa. 1875 debütierte er in der Arena Federici in Pisa als Don Carlo in Verdis »Ernani«. Er hatte bald eine sehr erfolgreiche Karriere an den führenden Opernhäusern der italienischen Halbinsel. So hörte man ihn am Teatro Carlo Felice Genua (1879 als Rigoletto, als Macbeth in Verdis gleichnamiger Oper und als Cacico in »Il Guarany« von Carlos Gomes), am Teatro Regio Parma (1882-83, u.a. als Titelheld in »Belisario« von Donizetti und in Halévys »La Reine de Chypre«), in Messina, am Teatro Argentina Rom (1888) und am Teatro Costanzi Rom. An diesem Opernhaus sang er 1885 in der Uraufführung der Oper »Hermosa« von Branca, 1894 in »Carmen« und in Verdis »Falstaff«. Am Teatro Comunale Bologna sang er 1887, am Teatro Pagliano Florenz 1893 den Telramund in »Lohengrin«. Besonders beliebt war er in seiner Heimatstadt Pisa, wo er immer wieder am Teatro Politeama auftrat und im Oktober 1898, wenige Monate vor seinem Tod, seine letzte Partie, den Germont-père in »La Traviata«, sang. Er starb 1899 in Pisa, Er war verheiratet mit der Sopranistin Elvira Barbieri-Angeli († 1924), die ähnlich wie ihr Gatte eine ganz italienische Karriere in den letzten zwanzig Jahren des 19. Jahrhunderts hatte. Ein Sohn, Amleto Barbieri (1883-1957), wurde wie sein Vater ein angesehener Bariton.
8.10. Wilhelm Friedrich SEEBACH: 225. Geburtstag
Er begann ganz jung seine Bühnenlaufbahn und kam um 1830 nach Köln. Hier konnte er in zahlreichen Buffo-Opern, in Singspielen, musikalischen Possen und Vaudevilles bis zu seinem Tod 1868 das Publikum begeistern. Als seine große Rolle auf der Bühne galt der Figaro in Rossinis »Barbier von Sevilla«, dazu sang und spielte er eine bunte Vielfalt von Partien sehr verschiedener Art, in denen seine Begabung als Sänger wie als urwüchsiger komischer Darsteller ihm eine ununterbrochene Kette von Erfolgen brachten. Seine Karriere dauerte praktisch bis zu seinem Tod. Der Künstler war verheiratet mit der Schauspielerin Theona Blumauer. Er hatte zwei Töchter, die beide eine große Bühnenkarriere entwickelten: Marie Seebach (1830-95), die zu den größten deutschen Schauspielerinnen des 19. Jahrhunderts zählt, und Wilhelmine Seebach (* 4.6.1832 Riga, † 19.5.1911 Berlin). Letztere studierte Gesang bei dem Pädagogen Dorn am Kölner Konservatorium und kam, noch ganz jung, als Soubrette an das Hamburger Stadttheater, wo sie als Ännchen im »Freischütz« debütierte. Sie sang dort und bei ihrem folgenden Engagement in Königsberg (Ostpreußen) Sopranpartien wie den Benjamin in »Joseph« von Méhul, den Pagen Urbain in den »Hugenotten« von Meyerbeer, die Jenny in »La dame blanche« von Boieldieu und die Zerlina in »Don Giovanni«. Sie kam wieder nach Hamburg zurück, studierte nochmals bei Frau Glasbrenner, und wandte sich dann dem Drama und der Tragödie zu. Sie wirkte darauf als Schauspielerin in Mannheim, während drei Spielzeiten in Köln, am Hoftheater von Coburg, an den Hoftheatern von Schwerin und Meiningen, in Breslau und Dessau. 1884-94 war sie wieder in Königsberg anzutreffen. Sie gab ihre Karriere auf, um ihre schwer erkrankte, berühmte Schwester Marie Seebach zu betreuen und widmete sich nach deren Tod der Leitung der von dieser ins Leben gerufenen Sozialwerke für Bühnenangehörige, besonders dem Marie Seebach-Stift in Weimar.
8.10. Franz SEYDELMANN: 275. Geburtstag
Er war ein Sohn des Hofsängers der Dresdner Hofkapelle Franz Ignaz Seydelmann, der als deren Mitglied um 1764 (mit einem Jahresgehalt von 252 Talern) verzeichnet ist. Nachdem sich früh seine Begabung für die Musik gezeigt hatte, wurde Franz Seydelmann durch den polnischen Hofkapellmeister Joseph Weber und durch den Dirigenten und Komponisten Johann Gottlieb Naumann ausgebildet. Mit letzterem und mit dem Komponisten Joseph Schuster, mit dem er zeitlebens befreundet blieb, reiste er 1765 nach Italien. Er blieb dort bis 1768, bildete sich in der Komposition wie im Gesangsfach weiter und trat als Tenor auf. Er war während seiner gesamten Karriere immer wieder als Sänger zu hören. Nach Dresden zurückgekehrt, wurde er 1772 zum Kurfürstlichen Kirchen- und Kammermusik-Komponisten ernannt und dirigierte abwechselnd mit Naumann und Schuster Opern wie Konzerte der Hofkapelle. 1787 wurde er zum ersten Kapellmeister ernannt. Bis 1805 dirigierte er dann vor allem Opernaufführungen in der sächsischen Residenz. Er wurde als Komponist allseitig geschätzt und brachte eine Anzahl von Opern (in italienischer Sprache) in Dresden zur Uraufführung, darunter »Capriccio carretto« (1774), »La Villanella di Misnia« (1784), »Il Most ro« (1786), »Il Turco in Italia« (1788), »Amore per oro« (1790) und »La serva scaltra« (1792). Außerdem komponierte er Oratorien, Konzertarien, Messen und Klavierwerke, seit 1792 jedoch nur noch religiöse Musik. Er starb 1806 in Dresden.
Lit: R. Cahn-Speyer: »Franz Seydelmann als dramatischer Komponist« (Leipzig, 1909).
9.10. Einojuhani RAUTAVAARA: 95. Geburtstag
Er war der Sohn eines Opernsängers und kam so schon von Geburt an mit Musik in Berührung. Beide Eltern starben früh, der Junge wurde von einer Tante großgezogen. Er studierte in Turku Klavier und nach dem Abitur in Helsinki an der Jean-Sibelius-Akademie Musikwissenschaft und Komposition bei Aarre Merikanto. Jean Sibelius ließ Rautavaara 1955 ein Stipendium zukommen, das die Koussevitsky-Stiftung dem neunzigjährigen Sibelius zuerkannt hatte. Rautavaara konnte so an der Juilliard School of Music in New York bei Vincent Persichetti und am Tanglewood Music Center bei Roger Sessions und Aaron Copland studieren. Er graduierte 1957, danach folgte ein Privatstudium der Zwölftontechnik bei Wladimir Vogel in Ascona. Nach diversen Tätigkeiten als Lehrer an der Jean-Sibelius-Akademie, als Bibliothekar und Archivist beim Philharmonischen Orchester in Helsinki und als Rektor am Käpylä Music Institute in Helsinki wurde er 1976 als Professor für Komposition an die Jean-Sibelius-Akademie berufen und wirkte dort bis 1990. Für sein kompositorisches Schaffen erhielt er zahlreiche in- und ausländische Auszeichnungen und Preise, u. a. den Wihuri-Sibelius-Preis und die „Pro Finlandia“-Medaille.
Das Harenberg Komponistenlexikon nennt Rautavaara „eine komplexe und widersprüchliche Erscheinung“. Rautavaara begann in den 1950er Jahren neoklassisch in der Nachfolge Anton Bruckners, komponierte dann in den 1960er Jahren seriell, schlug 1969 im ersten Klavierkonzert neoromantische Töne an. Eine Reihe von Stücken der 1970er Jahre, so vor allem Cantus Arcticus, das berühmte Konzert für Orchester und Bandaufnahmen von Vogelstimmen, muten mystisch an. Seit den 1980ern Jahren verbindet Rautavaara postmodern alle Stilarten der Musik, die er beherrscht. Das Reihenverfahren der Zwölftontechnik verbindet er mit Dreiklang-Elementen. Die romantisch-mystische Seite seines Schaffens führt Rautavaara auf zwei Kindheitserlebnisse zurück: Einen häufigen Traum, in dem er wie der biblische Urvater Jakob mit einem Engel kämpfte, und eine griechisch-orthodoxe Bischofsweihe, der er mit seinen Eltern beiwohnte. Das in seinen Werken immer wieder behandelte Thema des Engels hat seinen Ursprung außerdem in seiner Beschäftigung mit den Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke, deren „Erste Elegie“ er auch für achtstimmigen gemischten Chor vertont hat. Rautavaara geht davon aus, dass seine Kompositionen bereits in „einer anderen Realität existieren“ und es seine Aufgabe sei, sie von der einen in die andere Welt zu bringen: „Ich glaube fest daran, dass Kompositionen einen eigenen Willen besitzen.“ Rautavaara ist zwar vor allem für seine sinfonischen Werke und seine Konzerte bekannt geworden, war aber neben Aulis Sallinen auch der produktivste finnische Opernkomponist der Gegenwart. Meist schreib er seine Libretti selber und verarbeitete in ihren wie in seinen Instrumentalwerken mystisch-romantische Themen: in Thomas sein Klostererlebnis, in Vincent das Künstlerdrama Vincent van Goghs, in Das Sonnenhaus Vergangenheitskult und Todesnähe, in Aleksis Kivi erneut ein Künstlerdrama, das Aleksis Kivis, des ersten in Finnisch dichtenden modernen Schriftstellers. Seine letzte Oper behandelte die charismatische Figur Rasputin. Rautavaara starb 2016 in Helsinki.
10.10. Leyla GENCER: 95. Geburtstag
Ausbildung am Konservatorium von Ankara durch Elvira de Hidalgo, die auch die Lehrerin von Maria Callas gewesen war. Die Künstlerin debütierte 1950 an der Oper von Ankara als Santuzza in »Cavalleria rusticana«. Nach weiteren Studien bei Giannina Arangi-Lombardi und Apollo Granforte begann sie 1953 als Madame Butterfly am Teatro San Carlo von Neapel ihre Tätigkeit in Italien. Sie hatte dort eine erfolgreiche Karriere und sang u.a. 1956 am Teatro Verdi Triest die Agathe im »Freischütz«. 1956-58 gastierte sie an der San Francisco Opera als Titelheldin in den Opern »Francesca da Rimini« von Zandonai, »La Traviata« und »Lucia di Lammermoor«, als Liù in Puccinis »Turandot«, als Elisabeth in Verdis »Don Carlos«, als Manon von Massenet, als Gilda in »Rigoletto« und 1967 noch einmal in der Titelrolle von Ponchiellis »La Gioconda«. 1957 sang sie in der Kathedrale von Mailand bei den Begräbnisfeierlichkeiten für den großen Dirigenten Arturo Toscanini. Am 26.1.1957 debütierte sie als Madame Lidoine in der Uraufführung der Oper »Dialogues des Carmélites« von Poulenc an der Mailänder Scala, an der sie dann auch 1957, 1961 und 1965 die Leonora in »La forza del destino«, am 1.3.1958 die Prima Corifea in der Uraufführung der Oper »Assassinio nella cattedrale« von Pizzetti, 1958 die Margherita in »Mefistofele« von Boito, 1960 die Paolina in »Poliuto« von Donizetti, 1961, 1963 und 1970 die Elisabeth in Verdis »Don Carlos«, 1961 die Lisa in »Pique Dame« von Tschaikowsky, 1963 und 1966 die Aida, 1964 die Lady Macbeth in Verdis »Macbeth«, 1965 die Norma von Bellini, 1966 die Amelia in »Simon Boccanegra«, 1967 die Ottavio in Monteverdis »L’Incoronazione di Poppea«, 1968 die Elettra in Mozarts »Idomeneo«, 1970 die Titelrolle in Donizettis »Lucrezia Borgia« und die Elena in Verdis »I Vespri Siciliani«, 1972 die Titelrolle in Glucks »Alceste«, 1973 die Amelia in Verdis »Un ballo in maschera«, 1976-79 alljährlich in Konzerten und 1979 die Lady Billows in »Albert Herring« von B. Britten sang. Seit 1959 gastierte sie fast alljährlich beim Maggio Musicale von Florenz. Hier hatte sie einen ihrer größten Erfolge in Verdis »La Battaglia di Legnano«, 1966 als Alceste in der gleichnamigen Oper von Gluck. 1959 sang sie bei den Festspielen von Spoleto die Renata in Prokofjews »L‘Ange de feu«. 1957-62 Gastspiele an der Wiener Staatsoper (als Traviata, als Tosca, als Elisabeth in »Don Carlos« und als Amelia in Verdis »Un ballo in maschera«); bei den Festspielen von Salzburg 1961 als Amelia in »Simon Boccanegra« von Verdi zu Gast. 1962-63 und 1965-68 sang sie bei den Festspielen von Verona die Titelrolle in »Norma«, die Aida und die Amelia in Verdis »Un ballo in maschera«. An der Londoner Covent Garden Oper trat sie 1962 als Donna Anna in »Don Giovanni« auf. Bei den Festspielen von Glyndebourne hörte man sie 1962-63 als Gräfin in »Le nozze di Figaro« und 1965 als Titelheldin in »Anna Bolena« von Donizetti, 1969 und 1972 beim Edinburgh Festival als Maria Stuarda und als Elisabetta Regina d’Inghilterra in den gleichnamigen Opern von Donizetti bzw. Rossini. 1968 gastierte sie am Teatro Fenice Venedig als Medea in der Oper gleichen Namens von Cherubini, 1969 am Teatro Massimo Palermo als Giulia in »La Vestale« von Spontini, die sie auch 1971 an der Oper von Rom sang. 1972 gestaltete sie am Teatro San Carlo Neapel die Titelpartie in der Premiere der vergessenen Oper »Caterina Cornaro« von Donizetti. Sie ist darüber hinaus an der Staatsoper von München, am Bolschoi Theater Moskau, an den Opern von Leningrad, Stockholm, Oslo, Warschau, am Teatro Colón Buenos Aires, in Brüssel und Rio de Janeiro gastweise aufgetreten. In besonderer Weise erwarb sich die vielseitig begabte Primadonna Verdienste um die Wiederbelebung in Vergessenheit geratener Belcanto-Opern aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wobei sie sich auf der Bühne auch als große Darstellerin erwies. Sie lebte nach Abschluss ihrer Karriere in Mailand und war u.a. Präsidentin des Festivals von Istanbul und in den Jahren 1983-89 künstlerische Direktorin der Organisation ASLICO, die in Norditalien Opernaufführungen mit Nachwuchssängern veranstaltete. 1989 wurde sie zur Türkischen Staatskünstlerin ernannt, 1990 verlieh die Universität von Istanbul ihr die Ehrendoktorwürde. Seit 1997 war sie als Lehrerin und im Koordinationsstab der Accademia della Scala in Mailand tätig. Sie starb 2008 in Mailand. – Dramatische Sopranstimme, die aber zugleich die Kunst des Koloraturgesangs virtuos beherrschte und über einen fein nuancierten Vortrag verfügte.
Lit: R. Celletti: Leyla Gencer (in »Opera«, 1972); E. Cella: »Leyla Gencer« (Venedig/Wien, 1986).
Einige Aufnahmen auf Cetra. Mitschnitte von Opernaufführungen auf ANNA-Records (»Il Trovatore«), Robin Hood-Records (»Attila« von Verdi), MRF (»I Lombardi« von Verdi, »Caterina Cornaro« von Donizetti, »Saffo« von G. Pacini, »Belisario« von Donizetti, »La Vestale« von Spontini), Foyer (»I Puritani« von Bellini), Replica (»Werther«), Cetra Opera Live (»I due Foscari« von Verdi), Morgan (»Francesca da Rimini« von Zandonai), Movimento Musica (»Simon Boccanegra« von Verdi), Bongiovanni (»Falena« von Smareglia), TIS (»Roberto Devereux«, »Lucrezia Borgia« und »Maria Stuarda« von Donizetti), RAI-Nuova Era (»Anna Bolena« von Donizetti), Mondo Musica (»Macbeth« von Verdi, »La Gioconda«, »Fedora« von Giordano, Aufnahmen aus dem Teatro Fenice Venedig); Video-Aufnahmen auf Hardy-Video (»Werther« von Massenet und »Il Trovatore«), Hanley-Video (»Aida«, Verona 1966).
10.10. Judit SÁNDOR: 100. Geburtstag
Die ungarische Sängerin schloss ihr Gesangstudium 1948 an der Franz-Liszt- Musikhochschule Budapest ab. Sie war Schülerin der Pädagogen Erzsi Gervay, Ilona Durigo, Margit Walter und Imre Molnár. Sie wurde sogleich als Stipendiatin an die Nationaloper Budapest engagiert und 1949 als reguläres Mitglied in das Ensemble aufgenommen, wo sie als Cherubino in »Le nozze di Figaro« debütierte. In ihrer langen Karriere an diesem führenden ungarischen Opernhaus sang sie an erster Stelle Partien wie die Gräfin in »Le nozze di Figaro«, die Dorabella in »Così fan tutte«, die Sieglinde in der »Walküre«, die Fricka im Ring-Zyklus, die Magdalena in »Die Meistersinger von Nürnberg«, die Donna Elvira in »Don Giovanni«, die Leonore in »Fidelio«, den Octavian im »Rosenkavalier«, den Nicklausse in »Hoffmanns Erzählungen«, den Hänsel in »Hänsel und Gretel« und die Örzse in »Háry János« von Zoltán Kodály. Ihre eigentliche Glanzrolle war die Mélisande in »Pelléas et Mélisande« von Debussy (1963). Sie wirkte in Budapest in Uraufführungen mehrerer ungarischer Opern mit (»Der Zauberschrank« von Farkas, 1952; »Kádár Kata« von Horusitzky, 1957; »Bluthochzeit« von Szokolay, 1964). Allseitig bekannt wurde sie auch als Oratorien- und Liedersängerin. Sie gab Liederabende mit vielseitigen Programmen in Ungarn, in Prag, Paris, Wien, Rom und Berlin und im Rahmen einer Russland-Tournee. 1953 wurde sie mit dem Franz Liszt-Preis ausgezeichnet, 1963 erfolgte ihre Ernennung zur Verdienten Künstlerin der Ungarischen Volksrepublik. 1978 beendete sie ihre Karriere. Sie starb 2008 in Budapest.
Schallplatten: Hungaroton (Opern- und Lied-Recital).
11.10. Russell OBERLIN: 95. Geburtstag
Seine Ausbildung erfolgte in Cleveland, Chautauqua (New York) und an der Juilliard-Musikschule in New York. 1951 fand sein Konzertdebüt in New York statt, anschließend sang er 1953-59 mit der New Yorker Pro Musica Antiqua-Group zusammen, die er mit dem Dirigenten Noah Greenberg gegründet hatte. Ziel dieser Gruppe, von der auch zahlreiche Schallplatten aufgenommen wurden, war an erster Stelle die Wiederaufführung mittelalterlicher Vokal- und Instrumentalmusik in möglichst authentischer Form. Seine Karriere als Countertenor, eine früher sehr beliebte, dann aber in Vergessenheit geratene Kunst des Falsettgesangs für hohe Tenorstimmen, war sehr erfolgreich. Wie Alfred Deller für England, so entdeckte er diese Kunst für Amerika neu. 1956 sang er in New York in einer konzertanten Aufführung der Händel-Oper »Giulio Cesare« die Titelpartie in der Altlage mit Leontyne Price als Partnerin. Er trat mit berühmten Orchestern wie den New Yorker Philharmonikern und dem National Symphony Orchestra auf und gastierte bei den Festspielen von Vancouver, Caramoor, Edinburgh und beim American Shakespeare Festival. Gelegentlich erschien er auch auf der Opernbühne, bei der American Opera Society, beim Edinburgh Festival (1961 als Oberon in »A Midsummer Night’s Dream« von Benjamin Britten im Rahmen eines Gastspiels der Londoner Covent Garden Oper) und in Vancouver, doch blieb der Konzert- und zumal der Oratoriengesang seine eigentliche Domäne. Im Fernsehen wirkte er in Amerika wie in England in Opernsendungen mit; an der Londoner Covent Garden Oper sang er 1961 in »A Midsummer Night’s Dream« von Benjamin Britten die Partie des Oberon. Diese Rolle sang er auch in der amerikanischen Erstaufführung dieser Oper 1961 an der San Francisco Opera. Seit 1966 wirkte er als Professor am Hunter College der City University of New York. Er starb 2016 in New York City.
Schallplatten: Zahlreiche Aufnahmen bei Philips (u.a. vollständiger »Messias« von Händel); weitere Aufnahmen auf den Marken Decca, Columbia, Urania, Lyrophon (Troubadour Songs, English Medieval Polyphony, English Medieval Songs, French Ars Antiqua, Dowland Songs), Counterpoint, darunter auch Arien-Platten.
11.10. Saulius SONDECKIS: 95. Geburtstag
Sein Vater war Jackus Sondeckis (1893–1989), Bürgermeister von Šiauliai. Seine Mutter Rozalija Sondeckienė (1897–1952) lehrte am Jungengymnasium Šiauliai. 1935-44 lernte Saulius Sondeckis am Julius-Janonis-Gymnasium Šiauliai, 1946-47 an der Mittelschule in Vilnius. 1947-52 absolvierte er ein Diplomstudium an der Litauischen Musik- und Theaterakademie bei dem Geiger Aleksandras Livontas. 1952-59 lehrte Sondeckis am Juozas-Tallat-Kelpsa-Konservatorium Vilnius, ab 1955 an der Nationalen Mikalojus-Konstantinas-Ciurlionis-Kunstschule und ab 1957 am LSSR-Konservatorium. 1957-60 absolvierte er im Fernstudium die Aspirantur am Konservatorium in Moskau. 1960 gründete er das Litauische Kammerorchester in Vilnius und leitete es bis 2004. Ab 1977 lehrte er als Professor am Litauischen Konservatorium und 1959-87 leitete er den Lehrstuhl für Streichinstrumente des Konservatoriums in Vilnius. Ab 1989 leitete er das Orchester Camerata Sankt Petersburg und ab 2005 das Kammerorchester Kremerata Baltica. Ab 2004 war er Gastdirigent des Kammerorchesters Moskauer Virtuosen. Sondeckis war Mitglied der Herbert-von-Karajan-Stiftung und Jury-Mitglied zahlreicher Musikwettbewerbe in Litauen sowie im Ausland (Salzburg, Moskau und Parma). Er war Dirigent beim Schleswig-Holstein-Musik Festival. 2010 wurde das Konservatorium Šiauliai nach Sondeckis Namen umbenannt. Ab 2004 war Sondeckis Mitglied der Partei Lietuvos socialdemokratu partija. Er starb im Februar 2016. Sein Grab befindet sich im Friedhof Antakalnis, Vilnius. Saulius Sondeckis war zweimal verheiratet. 1963 wurde er geschieden und hatte den Sohn Saulius Sondeckis junior (* 1954). Er ist ehemaliger Direktor des Fernsehsenders LRT televizija Unternehmer in der litauischen Hauptstadt Vilnius. 1967 wurde Saulius Sondeckis mit Cellistin und Professorin Silvija Sondeckienė (* 1942) verheiratet. Beide Söhne sind Musiker und leben im Ausland. Vytautas Sondeckis (* 1972) ist stellvertretender Solo-Cellist beim NDR-Sinfonieorchester. Paulius Sondeckis ist Geiger und lebt in Österreich.
12.10. Gabriella DÉRY: 90. Geburtstag
Ihre Lehrerin war Erszebét Hoor Tempis in Budapest. Sie debütierte 1958 an der Ungarischen Nationaloper Budapest als Elisabeth in »Hunyadi László« von Erkel. Länger als zwanzig Jahre gehörte die Künstlerin diesem Ensemble an, wo man sie als Interpretin dramatischer Sopranpartien schätzte: als Aida, als Tosca, als Turandot in der gleichnamigen Puccini-Oper, als Titelheldin in Janáceks »Katja Kabanowa«, als Donna Anna wie als Donna Elvira in »Don Giovanni«, als Salome von R. Strauss, als Titelheldin in Goldmarks »Die Königin von Saba« und als Jaroslawna in »Fürst Igor« von Borodin. Sie gastierte am Bolschoi Theater in Moskau, an den Nationalopern von Belgrad und Sofia, an der Berliner Staatsoper, in Leipzig, in Helsinki, auf Kuba und bei den Festspielen von Wiesbaden. 1971 wurde sie zur Verdienten Künstlerin der Ungarischen Volksrepublik ernannt. Sie starb 2014 in Budapest.
Schallplatten der Marke Hungaroton, darunter die vollständigen Opern »La Traviata«, »Der Troubadour« und »Aida«.
12.10. Jerzy SEMKOW: 95. Geburtstag
Er studierte zuerst 1946-51 bei Artur Malawski am Krakauer Konservatorium und ging 1951-53 bei Jewgeni Mrawinski an der Leningrader Philharmonie in die „Lehre“. Er studierte weiterhin Dirigieren bei Tullio Serafin in Rom und Bruno Walter in Wien. 1956 war er Assistent bei Mrawinski und der Leningrader Philharmonie und 1956-58 dirigierte er am Bolschoi-Theater in Moskau. Danach dirigierte er an der Polnischen Oper in Warschau, wo er 1958-61 dirigierte (und in der Spielzeit 1958-59 auch deren künstlerischer Leiter war) und wurde schließlich künstlerischer Direktor und erster Dirigent am Königlichen Opernhaus in Kopenhagen. Dazwischen nahm er zahlreiche Verpflichtungen als Gastdirigent in ganz Europa wahr und unternahm mit dem London Philharmonic Orchestra eine Japantournee. 1968 gab er mit dem Boston Symphony Orchestra sein amerikanisches Debüt und trat anschließend mit namhaften amerikanischen Orchestern auf, darunter mit dem Cleveland Symphony Orchestra (1970-71). 1975-79 war er musikalischer Direktor und erster Dirigent des St. Louis Symphony Orchestra, danach 1979-82 künstlerischer Direktor des Orchestra Sinfonica di Roma della Radiotelevisione Italiana. 1985-93 war er künstlerischer Direktor und erster Dirigent des Rochester Philharmonic Orchestra. Er unterrichtete auch an der Universität von Colorado, an der Yale University sowie an der Manhattan School of Music in New York. Er lebte in Paris und besaß auch die französische Staatsbürgerschaft. Er trat zuletzt nur noch selten auf, so einmal im Jahr an der Warschauer Philharmonie. Im Jahr 2000 wurde er mit dem französischen Orden des Arts et des Lettres ausgezeichnet. Einen Ehrendoktortitel erhielt er von der Frédéric-Copin-Musikuniversität in Warschau (2005). Er starb 2014 in der Nähe von Lausanne.
12.10. Alwina VALLERIA: 175. Geburtstag
Die Künstlerin, die mit ihrem wirklichen Namen Alwina Schoening hieß, kam zur Ausbildung nach London und wurde dort 1867 an der Royal Academy of Music Schülerin von Luigi Arditi und Wallworth (Gesang) sowie von W.H. Holmes (Klavierspiel). 1871 gab sie ihr erstes Konzert in London. Es kam darauf zu einem sofortigen Engagement an die Hofoper von St. Petersburg. 1871 debütierte sie als Opernsängerin in St. Petersburg in der Titelpartie der Oper »Linda di Chamounix« von Donizetti. 1872 gastierte sie in Deutschland und sang noch im gleichen Jahr an der Mailänder Scala. 1873 trat sie an der Mailänder Scala als Isabella in »Robert le Diable« von Meyerbeer und als Page Oscar in Verdis »Un ballo in maschera« auf. 1875-76 war sie dort als Gilda in »Rigoletto« und als Martha von Flotow anzutreffen. 1873 hatte sie am Drury Lane Theatre in London großen Erfolg, als sie dort die Martha in der gleichnamigen Oper von Flotow sang. 1877-78 und 1879-82 war sie an der Londoner Covent Garden Oper engagiert. Sie wirkte am 22.6.1878 am Her Majesty’s Theatre London in der englischen Erstaufführung von »Carmen« in der Partie der Micaela mit, wobei Minnie Hauk, Italo Campanini und Giuseppe del Puente ihre Partner waren. Als erste Sängerin sang sie in London die Elisabeth in »Tannhäuser« in englischer Sprache. 1882 trat sie an der Covent Garden Oper in der Uraufführung der Oper »Velléda« von Charles Lenepveu auf. 1883 sang sie als Mitglied der Carl Rosa Company am Drury Lane Theatre London die Titelpartie in der Uraufführung der Oper »Colomba« von Alexander Mackenzie, 1885 am gleichen Haus die Titelrolle in »Nadeshda« von Arthur Goring Thomas. 1878 war sie an der Academy of Music in New York zu Gast, wo sie die Micaela auch in der US-Erstaufführung von »Carmen« sang und 1879 als Marguerite in Gounods »Faust« brillierte. 1882 sang sie erstmals eine Oratorienpartie, und zwar in Manchester in Händels »Messias«. Seitdem hatte sie auch auf diesem Gebiet große Erfolge. Am 26.10.1883 sang sie als erste Amerikanerin an der neu eröffneten Metropolitan Oper New York, und zwar in der dritten Vorstellung an diesem Haus überhaupt, die Leonore in Verdis »Troubadour«. An der Metropolitan Oper trat sie in deren Eröffnungssaison 1883-84 in Partien wie der Philine in »Mignon« von A. Thomas, der Bertha in »Le Prophète« von Meyerbeer, der Isabella in »Robert le Diable« und der Micaela in »Carmen«, insgesamt in 14 Vorstellungen, auf. 1886 gab sie bereits ihre Bühnenkarriere auf. 1888 hörte man sie in London nochmals in einem Konzert. Sie starb 1925 in Nizza.
13.10. Enzo DARA: 85. Geburtstag
Er wurde zuerst Journalist, dann Ausbildung zum Sänger durch Bruno Sutti in Mantua. Bühnendebüt 1960 am Theater von Fano als Bartolo in Rossinis »Barbier von Sevilla«. 1966 hörte man ihn in Reggio Emilia als Dulcamara in Donizettis »L‘Elisir d’Amore«. An der Piccolo Scala in Mailand sang er 1968 den Fabrizio in Rossinis »La Pietra del Paragone«, 1970-71 den Nardo in Mozarts »La finta giardiniera«, 1971 den Sigismondo in Donizettis »Il giovedí grasso«, 1973 den Tobia Mill in Rossinis »La cambiale di matrimonio« und 1979-80 den Geronimo in Cimarosas »Il matrimonio segreto«. Beim Spoleto Festival von 1969 sang er den Mustafà in Rossinis »L‘Italiana in Algeri«. Es folgte eine schnelle Karriere an den großen italienischen Opernhäusern, vor allem an der Mailänder Scala, an der er 1971 als Antrittsrolle den Dulcamara sang. An der Scala sah man ihn 1971, 1976, 1981 und 1983-84 als Bartolo im »Barbier von Sevilla«, 1972 als Marchese de Boisfleury in Donizettis »Linda di Chamounix«, 1973-74 und 1982 als Dandini in »La Cenerentola«, 1973, 1975 und 1983 als Taddeo in »L‘Italiana in Algeri«, 1974 als Zauberer Tschelio in Prokofjews »L’Amour des trois oranges«, 1975 und 2001 als Don Magnifico in »La Cenerentola« sowie 1985 als Barone di Trombonok in »Il Viaggio a Reims« von Rossini. Weitere Auftritte an der Oper von Rom, in Venedig, Palermo, Parma, Neapel, Bologna und Genua. Gastspiele in Frankreich und Deutschland, aber auch am Bolschoi Theater Moskau, in Brüssel und Zagreb. 1976 gastierte er mit dem Ensemble der Mailänder Scala an der Covent Garden Oper London als Dandini. 1984 wirkte er beim Rossini Festival von Pesaro in der spektakulären Wiederaufführung von Rossinis »Il Viaggio a Reims« mit; 1986 trat er bei den gleichen Festspielen als Geronio in Rossinis »Il Turco in Italia«, 1988 in dessen »Il Signor Bruschino« auf. 1981-90 gastierte er an der Wiener Staatsoper in insgesamt 53 Vorstellungen als Dandini, als Bartolo im »Barbier von Sevilla«, als Taddeo und als Barone di Trombonok. 1985 Gastspiel an der Covent Garden Oper London als Bartolo im »Barbier von Sevilla«, 1987 als Dulcamara. 1982 kam es zu seinem Debüt an der Metropolitan Oper New York, abermals in seiner Glanzrolle, dem Bartolo im »Barbier von Sevilla«; bis 1995 hatte er dort in insgesamt 59 Vorstellungen auch als Dulcamara einen besonderen Erfolg. 1990 am Teatro Fenice Venedig als Don Pasquale, am Teatro Zarzuela Madrid als Geronio zu Gast, 1993 am Teatro Donizetti in Bergamo (wo er auch als Regisseur tätig war) in »Betly« von Donizetti. In der Saison 1993-94 hörte man ihn an der Münchner Staatsoper und 1995 an der Oper von Houston/Texas als Don Magnifico, 1996 am Teatro Regio Parma als Simone in »I quattro rusteghi« von Wolf-Ferrari, bei den Festspielen in der Arena von Verona einmal mehr als Bartolo. Am Grand Théâtre Genf trat er 1997 als Don Magnifico und 2000 als Bartolo im »Barbier von Sevilla« auf, 1998 an der Hamburger Staatsoper als Don Magnifico. 2000 trat er an der Oper von Rom als Mesner in »Tosca« (anlässlich der 100-Jahrfeier der Uraufführung dieser Oper) auf, im gleichen Jahr am Teatro Colón Buenos Aires als Geronio, an der Münchner Staatsoper als Don Magnifico. Der Künstler verlegte sich in der Hauptsache auf die klassischen Bassbuffo-Partien des italienischen Belcanto-Repertoires, wobei ihm sein temperamentvolles darstellerisches Talent eine glänzende Gestaltung dieser Rollen sicherte. Er starb 2017 in Mantua.
Schallplatten: DGG (»L’Italiana in Algeri«, Bartolo im »Barbier von Sevilla« von Rossini, auch als Video), Bellaphon (»L’Italiana in Algeri«), Fonit-Cetra (»Le Maschere« von Mascagni, »La buona figliuola« von Piccinni, »L’Ajo nell‘ imbarazzo« von Donizetti), Nuova Era (»Don Pasquale«, außerdem in dem Pasticcio »L’Ape musicale«), Bongiovanni (»Amor rende sagace« von Cimarosa, »Il mondo della luna« von Paisiello), Memories (»Il matrimonio segreto« von Cimarosa), CBS (»Il Turco in Italia« und »La Cenerentola« von Rossini, »Il Campanello« von Donizetti), Frequenz (»Il Barbiere di Siviglia« von Paisiello), Sony (»Il Viaggio a Reims«); DGG-Video (»L’Elisir d’amore«), Decca-Video (»La Cenerentola«).
14.10. Goran SIMIC: 70. Geburtstag
Er studierte Fagottspiel und Gesang an den Musikhochschulen von Belgrad und Sarajewo. 1978 begann er seine Bühnentätigkeit am Opernhaus von Sarajewo, dessen Mitglied er bis 1984 blieb. Er gewann Preise bei Gesangwettbewerben in Busseto (1981), Moskau (Tschaikowsky-Concours, 1982) und Philadelphia (Concours Pavarotti, 1985). Seit November 1984 war er bis zu seinem Tod im November 2008 Mitglied der Staatsoper Wien (Debüt als einer der Wächter in »Die Frau ohne Schatten« von R. Strauss), an der er in zahlreichen Partien erfolgreich auftrat. Hier sang er u.a. den Grafen Warting in Verdis »Un ballo in maschera«, den Colline in »La Bohème«, den Sparafucile in »Rigoletto«, den Basilio im »Barbier von Sevilla«, den Commendatore in »Don Giovanni«, den Titurel in »Parsifal«, den Pimen in »Boris Godunow«. den Timur in »Turandot« von Puccini, den Wurm in »Luisa Miller«, den Raimondo in »Lucia di Lammermoor«, den Talbot in »Maria Stuarda« von Donizetti, den Ferrando im »Troubadour«, den Jorg in »Stiffelio« von Verdi, den Madruscht in »Palestrina« von H. Pfitzner und den Fürsten Gremin in »Eugen Onegin«. Insgesamt stand er in 55 verschiedenen Partien 1.095 Mal auf der Bühne der Wiener Staatsoper, zuletzt – nur wenige Wochen vor seinem Tod – als Surin in »Pique Dame« von Tschaikowsky. Operngastspiele in Italien und Deutschland, in Russland, Jugoslawien, in den USA wie in Japan trugen seinen Namen in alle Welt. Bei den Salzburger Osterfestspielen gastierte er 1986 als einer der flandrischen Deputierten in Verdis »Don Carlos«, 1994 als Hauptmann und als Nikititsch in »Boris Godunow« sowie 1995 als Pfleger des Orest in »Elektra« von R. Strauss.
Bei den Salzburger Festspielen wirkte er 1989 als Pfleger des Orest, 1989-90 als Graf Horn in Verdis »Un ballo in maschera«, 1993 als 2. Geharnischter in der »Zauberflöte« sowie 1994 und 1997 als Hauptmann und als Nikititsch in »Boris Godunow« mit. Von seinen weiteren Bühnenpartien seien der Pater Guardian in Verdis »La forza del destino«, der Ramfis in »Aida«, der Großinquisitor in »Don Carlos«, der Kezal in Smetanas »Die verkaufte Braut«, der Kontschak wie der Galitzky in »Fürst Igor« von Borodin genannt. Als Konzert- und namentlich als Oratoriensolist trat er in Österreich, in Deutschland, Italien und Jugoslawien in Erscheinung; er wirkte in mehreren Radio- und Fernsehsendungen mit.
Schallplatten: DGG (»Un ballo in maschera« von Verdi unter H. von Karajan, »Der Barbier von Sevilla«, »Chowanschtschina« unter C. Abbado, »Elektra« von R. Strauss), Melodiya; Virgin-Video (»Elektra« von R. Strauss), Pioneer-Video (»La Gioconda« von Ponchielli).
14.10. José SERRANO: 150. Geburtstag
Ersten Musikunterricht erhielt er vom Vater, der die Musikkapelle von Sueca leitete. Bereits mit 12 Jahren spielte er Violine und Gitarre. Dann begann José Serrano Simeón – wie sein vollständiger Name lautete – ein systematisches Musikstudium mit Schwerpunkt Komposition und Klavier am Konservatorium von Valencia bei Salvator Giner. Nach Beendigung des Studiums verlegte er seinen Wohnsitz nach Madrid, einem Zentrum musikalischer Vielfalt, ohne sich dort richtig wohlzufühlen. Wirtschaftlich nicht abgesichert, schlug er sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. Die Wende brachte die Bekanntschaft mit dem berühmten Manuel Fernández Caballero. José assistierte dem fast erblindeten Künstler, sein Alterswerk „Gigantes y Cabezudos“ fertigzustellen. Im Jahre 1898 gelangte es zur Aufführung. Anfang des neuen Jahrhunderts begann José Serranos Karriere als Komponist. Die Librettischmiede der Brüder Joaquin und Serafin Álvarez Quintero überließ ihm einen wirksamen Einakter zum Vertonen. Es war das Stück „El motete“. Der Bann war gebrochen. Das Brüderpaar versorgte den Komponisten mit einem weiteren Einakter. Zur Vertonung kam 1903 „Die Maurenkönigin“ und erlebte die Uraufführung in Madrid. Carlos Arniches, auf satirische Possen aus dem Alltag spezialisiert, lieferte den Stoff zur Zarzuela „Das Leid der Liebenden“, realisiert 1905. „Alma de Dios“, eines seiner beliebtesten Stücke, hatte 1907 Premiere. Serranos Werke tendieren zum einfachen Volkstheater und sind aufgeladen mit dramatischer Emotion. Seine Melodien verwendeten die Ausdruckswerte heimischer Folklore mit maurischem Einschlag und lehnten sich auch an die heimische Zigeunermusik an. Er wusste um seine begrenzten technischen Fähigkeiten und hielt seine Harmonien und Instrumentierungen bewusst einfach. Seine starke Seite ist der theatralische Instinkt, die Herzen der Menschen zu rühren. Den Verismo-Einschlag hatte er bei Puccini abgeschaut. Serrano gilt als Nachfolger von Federico Chueca. Von Manuel de Falla wurde der geniale Meister bewundert. Fast alle seine Werke (bis etwa 1910) sind Einakter – etwa 50 an der Zahl! Danach wurden die Bühnenwerke abendfüllend. Sein letztes Opus sollte die Oper „La venta de los gatos“ werden. Der Tod ließ es nicht mehr zu. José Serrano starb 1941 mit 67 Jahren in Madrid.
15.10. Günther RAMIN: 125. Geburtstag
Er wurde als Sohn eines Superintendenten in Karlsruhe geboren. 1900 zog die Familie Ramin nach Groß-Lichterfelde bei Berlin und 1903 nach Schkeuditz zwischen Halle und Leipzig. Ab 1910 besuchte er zunächst die Latina August Hermann Francke. Im selben Jahr wurde er in den Thomanerchor unter Thomaskantor Gustav Schreck aufgenommen und besuchte ab da die Thomasschule zu Leipzig. Danach studierte er auf Anraten des damaligen Thomasorganisten Karl Straube 1914-17 am Konservatorium der Musik in Leipzig, wobei er sich zunächst auf das Klavierspiel konzentrierte. Sein Lehrer war Robert Teichmüller. Später kamen Orgelunterricht bei Karl Straube, den er auch in der Thomaskirche vertrat, und Kompositionsstudien bei Stephan Krehl dazu. 1917-18 nahm er als Einjährig-Freiwilliger am Ersten Weltkrieg in Frankreich teil. 1919 (Wahl) bzw. 1923/24 (Amtsübertragung/Anstellungsvertrag) wurde Ramin als Nachfolger des zum Thomaskantor ernannten Straube Thomasorganist an der Leipziger Thomaskirche. Im Jahr 1920 wurde er auch Gewandhausorganist und unterrichtete als Orgellehrer am Kirchenmusikalischen Institut des Konservatoriums. 1932, kurz nach seiner Ernennung zum Professor, erhielt er einen Ruf an die Berliner Musikhochschule, gab diese Professur aber bald wieder auf. 1922-35 war er auch Chordirigent des Leipziger Lehrergesangsvereins. 1929-35 war er zudem Dirigent des Leipziger Sinfonieorchesters. Ebenso wie sein Lehrer Straube engagierte er sich in der deutschen Orgelbewegung. Angeregt wurde er durch Hans Henny Jahnn und die Entdeckung der Arp-Schnitger-Orgel in St. Jacobi zu Hamburg. So veröffentlichte er 1929 seine Gedanken zur Klärung des Orgelproblems. Ab 1933 war er Mitherausgeber der Zeitschrift Musik und Kirche, die der Orgelbewegung nahesteht und seit 1929 im Bärenreiter-Verlag erscheint. Ramin reiste als Orgelvirtuose durch Europa und gastierte auch in den USA (1933, 1934) und in Südamerika (1954). Seine internationalen Erfolge weckten Begehrlichkeiten bei den Nationalsozialisten, die ihn für ihre Zwecke zu instrumentalisieren versuchten. So spielte er 1935 auf der Hochzeit von Hermann Göring und weihte 1936 die große Walckerorgel auf dem Reichsparteitag in Nürnberg ein. 1943 wurde er zum Leiter des Reichs-Bruckner-Chors in Linz bestellt. Die ersten Konzerte unter Ramins Leitung fanden in Leipzig statt. Im April 1944 legte Ramin dieses Chorleiteramt nieder. Er stand als einer von zwei Organisten auf der sogenannten Gottbegnadeten-Liste von Goebbels aus dem Jahr 1944, die Künstler vor dem Kriegsdienst schützte. 1933-38 und erneut 1945-51 leitete Ramin auch den GewandhausChor, 1935 wurde er Leiter des Berliner Philharmonischen Chors, dieses Amt musste er kriegsbedingt 1943 aufgeben. Am 18. Oktober 1939 wurde Ramin (wieder als Nachfolger von Straube) zum Thomaskantor in Leipzig berufen, was er von 1940 an bis zu seinem Tode blieb. 1943-44 leitete er den neu gegründeten Reichs-Brucknerchor der Reichsrundfunkgesellschaft Leipzig, der sich aus Mitgliedern der aufgelösten Rundfunkchöre zusammensetzte. Sein Vertrag war befristet, da Ramin nicht bereit war, die Leitung des Thomanerchors aufzugeben und mit dem Reichs-Brucknerchor nach Linz ans St. Florians Stift überzusiedeln. Ramin legte großen Wert darauf, einen gemischten Chor zu leiten, da dieser Chorklang seinem Klangideal näher kam als der eines Knabenchores allein. So gestaltete er häufig als Thomaskantor Aufführungen von Thomanerchor und Gewandhauschor zusammen. Die Zusammenarbeit mit dem Gewandhauschor gab er offiziell wegen Überlastung ab. Voraus gingen aber Auseinandersetzungen zwischen dem Gewandhauskapellmeister und ihm um die künstlerischen Belange des Chores. Mit dem Amtswechsel des Thomaskantors von Straube auf Ramin wurde 1940 die Tätigkeit des Thomanerchors in der Leipziger Nikolaikirche eingestellt. Dieser tritt seitdem hauptsächlich in der Thomaskirche auf. Ziel des Kantoratswechsels war es, den Thomanerchor unter anderem durch die Gründung des Musischen Gymnasiums Leipzig 1941 stärker weltlichen Aufgaben zuzuführen, zu dessen künstlerischem Leiter Ramin ernannt wurde. Da er seine Vorstellungen nicht durchsetzen konnte und er mit Widersprüchen zu kämpfen hatte, reichte er im Dezember 1942 seinen Rücktritt ein. Das Ziel der Nationalsozialisten, das Thomaskantorat mit der künstlerischen Leitung des Musischen Gymnasiums Leipzig zu koppeln, wurde wieder aufgegeben. Nach 1945 gelang es Ramin, dem Thomanerchor durch zahlreiche Konzertreisen schnell wieder zu einem hohen internationalen Ansehen zu verhelfen. Er sah sich als Thomaskantor vor allem dem Werk seines großen Vorgängers Johann Sebastian Bach verpflichtet. Ramin war Präsident des Bach-Ausschusses der DDR, Geschäftsführender Vorstand der Neuen Bachgesellschaft, künstlerischer Leiter des Bachwettbewerbes 1950 sowie Leiter der Bachfeste in Leipzig 1950, 1953 und 1955. Außerdem war er Vorstandsmitglied der Internationalen Bachgesellschaft. 1950 wurde Ramin zum Ehrendoktor der Universität Leipzig ernannt. Im gleichen Jahr erhielt er den Nationalpreis 2. Klasse der DDR für seine Verdienste beim Bachfest Leipzig. Günther Ramins Schülerkreis war groß, ein Teil davon wurde später auch bekannt wie etwa Hugo Distler, Paul-Heinz Dittrich, Albrecht Haupt, Diethard Hellmann, Hanns-Martin Schneidt, Carl Seemann, Karl Richter, Helmut Walcha, Günter Metz und Ruth Zechlin. Ramin starb 1956 in Leipzig an den Folgen eines Schlaganfalls. Sein Amtsnachfolger wurde Kurt Thomas. Ramin wurde auf dem Leipziger Südfriedhof beigesetzt (II. Abteilung). Sein Grabmal schuf Alfred Späte. Der Thomasorganist Johannes Lang ist ein Urenkel von Günther Ramin, Langs Großvater, Dr. Dieter Ramin, kam in Leipzig zur Welt. Commerzienrat Gustav Jung war Günther Ramins Onkel zweiten Grades.
16.10. Vittorio NEGRI: 100. Geburtstag
Er schloss seine Ausbildung am Mailänder Konservatorium in Komposition und Dirigieren 1946 ab. Seine Laufbahn als Dirigent begann er am Salzburger Mozarteum unter Bernhard Paumgartner, in der Folge wirkte er als Gastdirigent am Orchester des Teatro alla Scala in Mailand, am Orchestre National de France in Paris, der Dresdner Staatskapelle und dem Boston Symphony Orchestra; daneben trat er auf zahlreichen renommierten Festivals auf. Er starb im April 1998.
16.10. Lisa BISCHOFF: 125. Geburtstag
Sie war zuerst seit 1918 als Schauspielerin am Stadttheater von Göttingen tätig, studierte während dieser Zeit dort Gesang und trat dann seit 1921 in Göttingen als Sängerin auf. Nachdem sie bis 1935 in Göttingen engagiert gewesen war, sang sie 1935-36 bei der Deutschen Landesbühne (einem wandernden Ensemble), 1936-37 am Stadttheater von Ulm und dann 1937-60 an der Staatsoper von Hamburg. Sie übernahm vor allem Soubrettenpartien und lyrische Rollen wie die Zerlina in »Don Giovanni«, die Marzelline in »Fidelio«, die Papagena in der »Zauberflöte«, das Ännchen im »Freischütz« und die Marie in »Zar und Zimmermann« von Lortzing. Bis 1964 war sie noch als Gast in Hamburg zu hören und nahm in diesem Jahr als Marzelline in »Fidelio« endgültig ihren Bühnenabschied. Zu Beginn ihrer Karriere ist sie auch unter dem Namen Lisa Bischoff-Trott aufgetreten. Sie starb 1993 in Hamburg.
Schallplatten: Acanta (4. Magd in einer »Elektra«- Gesamtaufnahme aus Hamburg von 1943).
18.10. Alfredo GIACOMOTTI: 90. Geburtstag
Schüler des Mailänder Konservatoriums, wo Cesare Chiesa und Carmen Melis seine Lehrer waren. Er debütierte 1954 bei einer kleinen italienischen Operntruppe als Colline in Puccinis »La Bohème«. Im Lauf seiner Karriere sang er an vielen führenden italienischen Opernbühnen, darunter seit 1957 an der Mailänder Scala (Debüt in einer kleinen Partie in der Uraufführung der Oper »Dialogues des Carmélites« von Fr. Poulenc; bis 1993 hier in unzähligen Rollen aufgetreten), am Teatro Fenice von Venedig, am Teatro Massimo von Palermo, an den Opernhäusern von Genua und Bologna, bei den Festspielen in der Arena von Verona (1965 und 1985) und beim Maggio Musicale Fiorentino. Er trat an den Staatsopern von Wien (1980 als Lorenzo in »I Capuleti e i Montecchi« von Bellini), München und Stuttgart, am Moskauer Bolschoi Theater, in Köln und Basel erfolgreich auf und wirkte bei den Bregenzer Festspielen mit (1968 als Pistola in Verdis »Falstaff«, 1971 als Korporal in Donizettis »La fille du régiment«, 1972 als Alessio in Bellinis »La Sonnambula« und 1976 als Prospero Salsapariglia in »Viva la Mamma« von Donizetti). 1975 wirkte er am Teatro Comunale Bologna in der Uraufführung der Oper »Massimiliano Robespierre« von Giacomo Manzoni mit. Er sang noch 1995 am Teatro Carlo Felice Genua den Pistola. Neben dem Standardrepertoire der italienischen Oper war er auch als Interpret moderner Werke (Strawinsky, Benjamin Britten, Bennett, Alban Berg, Prokofjew) erfolgreich; geschätzter Konzertbassist. Er starb im September 2007.
Schallplatten: Vox (»La fida Ninfa« von Vivaldi), DGG (Querschnitt »La Traviata«, komplette Opern »Rigoletto« und »Macbeth« von Verdi), HMV (»Ernani« und »Otello« von Verdi), CBS (Verdi-Arien), MRF (»Cyrano de Bergerac« von Alfano), RCA (»Don Pasquale«).
19.10. Aleksandar ĐOKIĆ: 90. Geburtstag
Gesangstudium an der Musikakademie von Belgrad und am Conservatorio Benedetto Marcello in Venedig. 1959 wurde er an die Belgrader Nationaloper berufen und ist deren Mitglied in einer jahrzehntelangen Karriere geblieben. Er sang hier die großen klassischen Bass-Partien wie den König Philipp in Verdis »Don Carlos«, den Zaccaria in »Nabucco«, den Bartolo wie den Basilio in Rossinis »Barbier von Sevilla«, den Dulcamara in Donizettis »L‘Elisir d’amore«, den Sarastro in der »Zauberflöte« und den Sancho Panza in »Don Quichotte« von Massenet. Mit dem Ensemble der Belgrader Nationaloper gastierte er 1964 auch an der Wiener Staatsoper (als Strelitze in »Chowanschtschina« von Mussorgsky und als dicker Engländer in Prokofjews »Der Spieler«). Er starb 2019 in Belgrad. Der auch als Konzertsolist bekannte Künstler war mit der Sopranistin Olga Đokić (* 22.1.1936 Nis) verheiratet, die seit 1966 ebenfalls an der Nationaloper von Belgrad wirkte und dort u.a. als Gilda in »Rigoletto«, als Violetta in »La Traviata« und als Nedda im »Bajazzo« auftrat.
Von beiden Sängern sind Schallplattenaufnahmen auf der jugoslawischen Marke Jugoton vorhanden.
19.10. Eberhard KATZ: 95. Geburtstag
Er wurde zunächst Bierbrauermeister. Nachdem man seine Stimme entdeckt hatte, erfolgte deren Ausbildung durch Clemens Glettenberg und Josef Metternich in Köln. Sein Bühnendebüt fand 1963 an der Oper von Köln als Erik in »Der fliegende Holländer« statt. Seitdem gehörte er für viele Jahre zu den führenden Ensemblemitgliedern dieses Hauses. Er gastierte mit dem Kölner Ensemble an der Sadler’s Wells Opera London. Er gastierte erfolgreich an der Deutschen Oper Berlin, an den Opernhäusern von Essen, Frankfurt a.M., Wuppertal und Nürnberg, an den Staatsopern von München und Stuttgart, an den Staatstheatern von Wiesbaden und Hannover, vor allem aber an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg. Er trat als Gast auch an den Operntheatern von Lyon, Nizza und Rouen, in Paris und Rom und an der Wiener Volksoper auf. Kraftvolle, heldische Tenorstimme, deren Glanzrollen neben den Wagner-Heroen der Florestan in »Fidelio« der Pedro in »Tiefland« von d’Albert, der Max im »Freischütz«, der Turiddu in »Cavalleria rusticana« und der Herodes in »Salome« von Richard Strauss waren. Die letztgenannte Partie sang er 1979 in Köln mit Gwyneth Jones in der Titelrolle. Er übernahm in einem zweiten Abschnitt seiner Karriere viele Charakterpartien, darunter den Wirt im »Rosenkavalier«, den er u.a. auch bei den Festspielen von Aix-en-Provence (1987), am Théâtre de la Monnaie Brüssel (1986) und an der Staatsoper Hamburg vortrug. Er blieb bis 1997 ein hochgeschätztes Mitglied des Kölner Opernhauses, wo er sich als Zirkusdirektor in Smetanas »Die verkaufte Braut« von seinem Publikum verabschiedete. Auch als Konzertsänger erfolgreich aufgetreten. Er starb im Jahr 2002.
Schallplatten: DGG (vollständige Oper »Cardillac« von P. Hindemith).
20.10. Carol WYATT: 80. Geburtstag
Sie begann das Gesangstudium an der Baylor University in Waco (Texas) bei Tina Piazza, nachdem sie zuvor als Lehrerin an einer Elementarschule tätig gewesen war. Sie schloss ihre Ausbildung bei T. Jappelli in Mailand ab und debütierte 1969 am Teatro Massimo von Palermo als Amneris in »Aida«. Ihre Karriere spielte sich in der Hauptsache in Deutschland ab, wo sie zuerst Mitglied der Staatsoper von Hamburg, dann der Deutschen Oper Berlin war. 1978 gastierte sie an der Wiener Staatsoper als Eboli in Verdis »Don Carlos«. Weitere Gastspiele führten die Künstlerin an die Opernhäuser von Frankfurt a.M., Köln (1982-83 als Maddalena in »Andrea Chénier«, als Azucena im »Troubadour« und als Eboli), Karlsruhe und Dortmund, an die Stuttgarter Staatsoper (1983 als Santuzza in »Cavalleria rusticana«), an die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg und an das Opernhaus von Zürich. 1990 hörte man sie an der Staatsoper von Hamburg als Marcellina in »Le nozze di Figaro«. Sie trat auch beim Spoleto Festival, am Grand Théâtre Genf (1977 als Marcellina), am Opernhaus von Graz und an der Oper von Cincinnati auf. Bei der Opera North Leeds sang sie u.a. 1982 die Charlotte in »Werther« von Massenet. Ihr Stimmumfang erlaubte ihr neben der Gestaltung des Mezzosopran-Repertoires auch das Singen mehrerer dramatischer Sopranpartien. So zählten zu ihren Glanzrollen die Dorabella in »Così fan tutte«, der Sesto in »La clemenza di Tito« von Mozart, die Marina in »Boris Godunow«, die Eglantine in »Euryanthe« von Weber und die Giulietta in »Hoffmanns Erzählungen. Auch als Konzertsängerin hatte sie eine erfolgreiche Karriere. Sie starb am 1.4.2023 in Lumberton (Texas).
Schallplatten: DGG (»Die Freunde von Salamanka« von Schubert), Telefunken (Bach-Kantaten).
Weitere Informationen auf ihrer Homepage: http://www.songofjoyministries.com/
20.10. Robert CRAFT: 100. Geburtstag
Er war ab 1948 und bis zu dessen Tod Sekretär und Assistent von Igor Strawinsky, dem er seit den 1960er Jahren zahlreiche Veröffentlichungen widmete. Er galt als eine Art „Eckermann“ Strawinskys. Craft, der sich bereits früh für die Zweite Wiener Schule interessierte und einsetzte – auch gegenüber seinem ursprünglich mit Arnold Schönberg verfeindeten Mentor – gilt dirigentisch als Spezialist der klassischen Moderne, nahm jedoch auch Werke von Gesualdo, Monteverdi und Johann Sebastian Bach auf. Er starb 2015 in Gulf Stream (Florida).
21.10. Georgi SELEZNEV: 85. Geburtstag
Er studierte zuerst am Konservatorium von Tblissi bei T.G. Savinowa, dann 1961-65 am Konservatorium von Leningrad bei Wassilij Lukanin. 1965-67 war er Solist des Staats- Ensembles M.I. Glinka in Leningrad. 1965 wurde er Preisträger beim nationalen russischen Gesangwettbewerb Michail Glinka in Moskau, 1966 beim Concours von Monaco, 1967 beim Wettbewerb »Prager Frühling«. 1967-71 übte er eine Lehrtätigkeit am Konservatorium von Leningrad aus, 1975-79 am Kunst-Institut in Leningrad. Er war 1971-76 am Maly Theater von Leningrad, 1977-93 am Bolschoi Theater Moskau im Engagement. Am Bolschoi Theater sang er u.a. den Basilio im »Barbier von Sevilla«, den Mephisto in »Faust« von Gounod, den König Philipp in Verdis »Don Carlos«, den Tonio im »Bajazzo«, den Scarpia in »Tosca«, den Wotan im »Rheingold«, den Blaubart in »Herzog Blaubarts Burg« von B. Bartók, den Iwan Susanin in »Ein Leben für den Zaren« von Glinka, den Boris Godunow wie den Pimen in »Boris Godunow«, den Dosifej wie den Schaklowity in »Chowanschtschina« von Mussorgsky, den Sobakin in der »Zarenbraut« und den Salieri in »Mozart und Salieri« von Rimski-Korsakow, den Gremin in »Eugen Onegin«, den Kotschubej in »Mazeppa«, den Tomsky in »Pique Dame« und den König René in »Jolanthe« von Tschaikowsky, den Mendoza in »Die Verlobung im Kloster« und den Kutusow in »Krieg und Frieden« von Prokofjew, den Boris in »Lady Macbeth von Mzensk« von Schostakowitsch, den Iwan Timofejewitsch in »Oktober« von Muradeli, den Mann mit dem Bart in »Die toten Seelen« von Schtschedrin und den Zvambaj in »Der Raub des Mondes« von Taktakischwili. Er wurde international bekannt, als er mit dem Bolschoi-Ensemble an Theatern in Westeuropa wie in den USA gastierte. 1985 gab er ein Solo-Gastspiel am Teatro Verdi Triest, und zwar als Kontschak und als Galitzky in »Fürst Igor« von Borodin, am gleichen Haus sang er auch den Dosifej. In einer Opernsendung des italienischen Rundfunks RAI hörte man ihn am 10.10.1980 in der Uraufführung (der ergänzten) Oper von Mussorgsky »Salammbô« als Matho, zusammen mit dem Concertgebouw-Orchest Amsterdam im Verdi-Requiem. In Detroit (sein US-Debüt 1989), bei der Pacific Opera und bei der Michigan Opera trat er als Oroveso in »Norma«, zusammen mit der australischen Primadonna Joan Sutherland, auf, bei den Festspielen von Wiesbaden als Pimen, den er dann auch 1993 an der Opéra du Rhin Straßburg und am Opernhaus von Bordeaux vortrug. 1994 gastierte er wieder in Bordeaux als Timur in Puccinis »Turandot«. 1996 hörte man ihn am Bolschoi Theater Moskau als Dosifej. Er trat im Konzertsaal in Kantaten von J.S. Bach, in den Requiem-Messen von Mozart und Verdi, in Sinfonien von Schostakowitsch und in den Liedern nach Michelangelo vom gleichen Komponisten sowie in vielen weiteren Werken, vor allem in Liedern, auf. 1977 erhielt er den Titel eines Verdienten Künstlers der UdSSR. Er starb 2007 in St. Petersburg.
Schallplatten: RCA (»Salammbô« von Mussorgsky), Olympia (Oroveso in »Norma«), Ricordi (»Jolanthe« von Tschaikowsky).
21.10. John ALEXANDER: 100. Geburtstag
Er studierte Gesang und Musikwissenschaft am Cincinnati Conservatory und an der dortigen Universität. Er war auch Schüler des bekannten Baritons Robert Weede. 1952 debütierte er in Cincinnati als Titelheld in »Faust« von Gounod. In den folgenden Jahren trat er an den Opernhäusern von Baltimore, Philadelphia, Houston/Texas und San Francisco (1967-87 als Julien in »Louise« von Charpentier, als Rodolfo in »La Bohème«, als Pollione in »Norma« und als Hoffmann in »Hoffmanns Erzählungen« von Offenbach) auf; 1957 sang er an der City Opera New York den Alfredo in »La Traviata«; er verkörperte dort auch 1958 den Henry in der amerikanischen Erstaufführung der Richard Strauss-Oper »Die schweigsame Frau«. Auch als Konzert- und Oratoriensänger kam er zu einer bedeutenden Karriere. 1961 wurde er an die Metropolitan Oper New York berufen (Debüt als Ferrando in »Così fan tutte«). Dort hatte er eine lange, über 25jährige Karriere; bis 1987 sang er hier in insgesamt 379 Vorstellungen noch den Titelhelden in »Hoffmanns Erzählungen«, den Alfredo, den Narraboth in »Salome« von R. Strauss, den Eisenstein in der »Fledermaus«, den Pinkerton in »Madame Butterfly«, den Dimitrij in »Boris Godunow«, den Rodolfo in »La Bohème«, den Elvino in Bellinis »La Sonnambula«, den Tamino in der »Zauberflöte«, den Herzog in »Rigoletto«, den Cassio in Verdis »Otello«, den Kodanda in »The Last Savage« von Menotti, den Faust von Gounod, den Des Grieux sowohl in »Manon« von Massenet als auch in Puccinis »Manon Lescaut«, den italienische Sänger im »Rosenkavalier«, den Edgardo in »Lucia di Lammermoor«, den Anatol in »Vanessa« von S. Barber, den Cavaradossi in »Tosca«, den Lyonel in »Martha« von Flotow, den Rodolfo in »Luisa Miller«, den Walther von Stolzing in »Die Meistersinger von Nürnberg«, den Pollione, den Tonio in Donizettis »La fille du régiment«, den Roland in »Esclarmonde« von Massenet, den Lohengrin, den Maurizio in »Adriana Lecouvreur« von Cilea, den Fernando in Donizettis »La Favorita«, den Lenski in »Eugen Onegin«, den Belmonte in der »Entführung aus dem Serail«, den Riccardo in Verdis »Un ballo in maschera«, den Arbace in Mozarts »Idomeneo«, den Goffredo in Händels »Rinaldo«, den Titelhelden in Mozarts »La clemenza di Tito«, den Bacchus in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss und den Titelhelden in Verdis »Don Carlos«. An der Wiener Volksoper gastierte er 1967 als Paul in Korngolds »Die tote Stadt«, an der Staatsoper Wien 1968 als Rodolfo in Puccinis »La Bohème«. 1970 an der Covent Garden Oper London als Pollione aufgetreten. 1973 sang er an der Oper von Boston die Titelpartie in der ersten kompletten Bühnenaufführung von Verdis »Don Carlos« in der Pariser Urfassung in Nordamerika. 1986 hörte man ihn in Cincinnati als italienischen Sänger im »Rosenkavalier«. Gastauftritte auch an der Städtischen Oper Berlin und an der Staatsoper München. Er starb 1990 in New York.
Schallplatten: Obwohl er von Hause aus eher eine lyrische Tenorstimme besaß, sang er auf Decca den Pollione in »Norma«, dann als Partner von Joan Sutherland den Percy in Donizettis »Anna Bolena« (eine seiner Glanzrollen), auf CBS das Tenorsolo in Beethovens 9.Sinfonie, auf Orfeo in einer Gesamtaufnahme von Wagners Jugendoper »Die Feen«; VAI-Video (»Roberto Devereux« von Donizetti mit Beverly Sills als Partnerin).
21.10. Władysław MIERZWIŃSKI: 175. Geburtstag
Biographie des polnischen Tenors auf Polnisch: https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Mierzwi%C5%84ski
21.10. Emilio ARRIETA: 200. Geburtstag
Nach dem frühen Tod der Eltern hielt er sich zunächst bei einer älteren Schwester in Madrid auf und erhielt hier erste musikalische Unterweisungen. In den folgenden Jahren lebte er abwechselnd in Madrid und Mailand, wo er am dortigen Konservatorium bei Nicola Vaccai Komposition studierte. Er wandte sich zunächst der Opernkomposition zu, womit er sowohl in Spanien als auch in Italien einige Erfolge erzielen konnte. Im Jahre 1852 erlebte er in Madrid den außerordentlichen Erfolg der „großen“ Zarzuela Jugar con fuego des Komponisten Francisco Asenjo Barbieri und fasste den Entschluss, sich ebenfalls dieser Gattung zuzuwenden. Seine Karriere nahm nun einen sehr erfolgreichen Verlauf. Er wurde zunächst als Lehrer für Komposition an das Madrider Konservatorium berufen und übernahm im Jahre 1868 auch dessen Leitung. Die Liste der Schüler seiner Kompositionsklassen enthält viele bekannte Namen. Arrieta war ein äußerst produktiver Komponist; insbesondere nachdem er sich der Zarzuela zugewandt hatte, schuf er jedes Jahr mehrere dieser Werke, von denen einige auch nach seinem Ableben noch zum festen Repertoire spanischer Bühnen gehören. Daneben – und neben den Opern aus seiner frühen Schaffenszeit – haben andere Kompositionen nur den Charakter von Gelegenheitswerken. Bei all dem ist deutlich der Einfluss seiner italienischen Ausbildung zu hören, wenngleich er auch Elemente der spanischen Volksmusik in seinen Bühnenwerken verarbeitete. Er starb 1894 in Madrid.
22.10. Paul ZUKOFSKY: 80. Geburtstag
Der Sohn des objektivistischen Dichters Louis Zukofsky erregte um 1950 als Wunderkind Aufsehen und studierte bei Ivan Galamian. 1969 entstand seine in Amerika viel beachtete Schallplattenaufnahme der 24 Capricen op. 1 von Niccolò Paganini (von Galamian als beste Wiedergabe dieser außerordentlich schwierigen Stückes gelobt). 1972 folgte die Einspielung der sechs Sonaten und Partiten für Violine solo von Johann Sebastian Bach. Zukofsky konzentrierte sich ansonsten vorwiegend auf zeitgenössische Musik und spielte zahlreiche Uraufführungen neuer Werke. John Cage schrieb für ihn seine Freeman Etudes. In den USA wurde Zukofsky gelegentlich mit dem kanadischen Pianisten Glenn Gould verglichen, dem er in der Eigenwilligkeit seiner Persönlichkeit ähnelte. In Europa blieb er dagegen so gut wie unbekannt. Seine außergewöhnliche Fähigkeit, selbst schwierigste Werke schnell zu erlernen, und sein rigoros analytisches Musikverständnis prädestinierten ihn zum Interpreten neuer Musik. Seine Kompromisslosigkeit hatte jedoch ein gespanntes Verhältnis zu den maßgeblichen Kräften des Musikbetriebs zur Folge und versperrte ihm den Zugang zu einem breiteren Publikum. Bereits gegen Ende der 1970er Jahre stellte Zukofsky seine Tätigkeit als Geiger weitgehend ein. Er zog daraufhin nach Island, wo er ein Jugendorchester gründete, mit dem er Aufsehen erregende Aufführungen anspruchsvollster Werke realisierte (u. a. Sinfonien von Anton Bruckner und Gustav Mahler). Meinungsverschiedenheiten mit dem Stiftungsvorstand des Orchesters veranlassten ihn 1993 jedoch hier zum Rückzug. 1978-87 leitete Zukofsky zugleich das Colonial Symphony Orchestra in New Jersey. Als Gastdirigent verschiedener Orchester trat er vorwiegend mit Werken des 20. Jahrhunderts auf. 1992-96 wirkte er als Direktor des Schönberg-Instituts in Los Angeles. Zukofsky komponierte und veröffentlichte Essays in musikalischen Fachzeitschriften. Zudem wurde er 1995 in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Er starb 2017 in Hongkong.
22.10. Willy FERENZ: 100. Geburtstag
Nach seinem Studium in Wien und Mailand war er, noch im Zweiten Weltkrieg, in Liegnitz (1941-42 als Chorist und für kleine Rollen) und Nürnberg engagiert. 1945 kam er an die Wiener Staatsoper (Debüt: Figaro im »Barbier von Sevilla«), deren Mitglied er bis 1948 blieb und an der er danach noch bis 1973 gastweise auftrat. Er sang hier in insgesamt 160 Vorstellungen auch den Silvio im »Bajazzo«, den Yamadori in »Madame Butterfly«, den Zirkusdirektor in Smetanas »Die verkaufte Braut«, den Moralès in »Carmen«, den Christian wie den Renato im »Maskenball« von Verdi, den Höllenhauptmann in »Schwanda der Dudelsackpfeifer« von Weinberger, den Marcello wie den Schaunard in »La Bohème«, den Kurt in Franz Salmhofers »Das Werbekleid«, den Kilian im »Freischütz«, den Lerma wie den Tebaldo in Verdis »Don Carlos«, den Schnappauf in W. Kienzls »Der Evangelimann«, den Valentin in »Faust« von Gounod, den Rigoletto, den Faninal im »Rosenkavalier« und den Schigolch in »Lulu« von A. Berg. 1948 wurde er an das Opernhaus von Zürich verpflichtet (bis 1961); seit 1954 auch als Pädagoge an der Musikhochschule und am Konservatorium von Zürich tätig. 1964-68 an der Staatsoper Stuttgart engagiert. Umfangreiche Gastspielreisen führten den Künstler durch die ganze Welt; so sang er an den Staatsopern von Stuttgart (1968 in der Uraufführung der Oper »Prometheus« von Carl Orff) und München, am Teatro Fenice Venedig, am Teatro San Carlo Neapel, in Bologna, Genua (u.a. 1953 in der italienischen Erstaufführung der Richard Strauss-Oper »Capriccio«) und Cagliari, am Teatro San Carlos Lissabon, am Gran Teatre del Liceu in Barcelona, am Deutschen Opernhaus Berlin, am Staatstheater Karlsruhe, am Théâtre de la Monnaie in Brüssel und an der Oper von Antwerpen, wo er auch als Oberspielleiter wirkte. Sehr erfolgreich bei den großen internationalen Festspielveranstaltungen: beim Maggio Musicale von Florenz, bei den Festivals von Edinburgh und Glyndebourne (1959-60 als Faninal), bei den Festspielen von Bregenz (1964 als Gustl in »Das Land des Lächelns« von Lehár und 1966 als Achilles in Offenbachs »Die schöne Helena«) und Salzburg (1961 und 1964 als Faninal). 1958 wirkte er am Opernhaus von Dortmund in der Uraufführung der Oper »Nana« von Manfred Gurlitt mit, 1966 am Theater an der Wien in der Uraufführung der Oper »Die schwarze Spinne« von J.M. Hauer. 1968 als Professor an das College Conservatory of Music der Universität von Cincinnati berufen; 1969 wurde er zum europäischen Direktor der Corbett Foundation in Zürich ernannt. In den folgenden Jahren gab er jedoch noch Gastspiele, u.a. in Santiago de Chile, am Grand Théâtre in Genf (1966 als Faninal sowie 1969 als Alberich in »Siegfried« und in »Götterdämmerung«), an der Oper von Nizza, in Karlsruhe, Köln und Cincinnati. Von seinen vielen Bühnenpartien seien ergänzend der Figaro in »Le nozze di Figaro«, der Papageno in der »Zauberflöte«, der Minister in »Fidelio«, der Dulcamara in »L‘Elisir d’amore«, der Graf Luna im »Troubadour«, der Germont-pêre in »La Traviata«, der Fra Melitone in »La forza del destino«, der Posa in »Don Carlos«, der Ford in Verdis »Falstaff«, der Conte Robinson in Cimarosas »Il matrimonio segreto«, der Angelotti wie der Scarpia in »Tosca«, der Beckmesser in »Die Meistersinger von Nürnberg«, der Alberich im Ring-Zyklus, der Amfortas wie der Klingsor in »Parsifal«, der Hortensio in »Der Widerspenstigen Zähmung« von H. Goetz, der John Sorel in »The Consul« von G.C. Menotti, der Homonay im »Zigeunerbaron«, der Escalus in »Romeo und Julia« von H. Sutermeister, der Pedro in »Don Ranudo« von O. Schoeck, der Charlot in »Angélique« von J. Ibert und der Messager in »Antigone« von A. Honegger genannt. Er wirkte am Opernhaus von Zürich am 6.6.1957 in der szenischen Uraufführung von »Moses und Aron« von A. Schönberg als Ephraimit mit. Er nahm dort an den Schweizer Erstaufführungen mehrerer Opern teil: »Die Kluge« von C. Orff (Spielzeit 1950-51 als 2. Strolch), »Komödie auf der Brücke« von B. Martinu (Spielzeit 1951-52 als Hans, zugleich deutschsprachige Erstaufführung), »Die schlaue Susanne« von F.X. Lehner (Spielzeit 1953-54 als Lucindo), »Capriccio« von R. Strauss (1954 als Olivier), »Die Zaubergeige« von W. Egk (Spielzeit 1955-56 als Kaspar). Seit 1972 Musiktherapeut an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, zugleich Leiter eines gesangpädagogischen Studios. Er starb 1998 in Zürich.
Schallplatten: Columbia (»Die lustige Witwe«, »Boccaccio«, »Der Zigeunerbaron«), Somerset (Ausschnitte aus Operetten), Calig-Verlag (»Die Abreise« von E. d‘ Albert).
22.10. Marcel MIHALOVICI: 125. Geburtstag
Aufgewachsen in einer wohlhabenden Familie in Bukarest mit den Eltern Michael und Helene Mihalovici und vier Brüdern, erhielt Mihalovici früh ersten Violinunterricht bei Franz Fischer und Benjamin Bernfeld. Geregelten Harmonielehreunterricht erteilte ihm in Rumänien der Komponist Dimitrie Cuclin, Kontrapunktunterricht Robert Cremer. Zu den Jugendwerken zählen eine nicht erhaltene Oper Chitra, Lieder nach Texten von Goethe, Klopstock, Bethge und Klabund sowie Klavierstücke. Im Frühling 1919 empfahl George Enescu Mihalovicis Eltern, nach Prüfung von dessen Kompositionen, diesen zu Vincent d‘Indy an die Schola Cantorum nach Paris zu schicken. Im Sommer desselben Jahres reiste Mihalovici über Berlin, wo er einen seiner Brüder besuchte, nach Paris und schrieb sich sofort an der Schola als Student ein. Dort besuchte er 1919-25 den Kompositionsunterricht bei Vincent d’Indy, er studierte Harmonielehre bei Léon Saint-Réquier und bei dessen Stellvertreter Paul Le Flem, den er sehr schätzte. Besonders inspirierte Mihalovici die Welt des gregorianischen Chorals, die er durch Amédée Gastouè entdecken konnte. Im Violinspiel bildete er sich bei Nestor Lejeune weiter und schloss den Unterricht mit dem Prädikat »très bien« ab. Ein Diplom erwarb Mihalovici nicht. Noch während des Studiums entwickelte Mihalovici eine intensive künstlerische Tätigkeit in Paris, etwa in Zusammenarbeit mit der rumänischen Tänzerin Lizica Codreanu und dem russischen Malerpaar Michail Larionow und Natalja Gontscharowa. Zudem war er eng mit dem Bildhauer Constantin Brancusi und der Künstlerin Irène Codreanu aus Rumänien befreundet. In avantgardistischen Produktionen der Jahre 1921 bis 1925 mit Lizica Codreanu erklangen die Werke Prélude antique und Une vie de Polichinelle, zu denen Codreanu tanzte. Mit Larionow, Gontscharowa und Frank Martin arbeitete Mihalovici 1924 bei der Aufführung seines Balletts Karagueuz op. 23 zusammen. Mehrfach (1919, 1921 und 1925) gewann Mihalovici den Prix national de composition George Enescu. Seine Werke, etwa das Streichquartett op. 10, wurden in Pariser Musikgesellschaften wie der Société Musicale Indépendante gegeben, die Orchesterstücke Notturno und Fantaisie op. 26 erklangen in den Concerts Straram. Ab 1928 erschienen insgesamt sieben Werke Mihalovicis im Verlag La Sirène musicale von Michel Dillard in Paris, für deren Propagierung eigens Konzerte veranstaltet wurden, bei denen auch Kompositionen von Bohuslav Martinu, Conrad Beck und Tibor Harsányi ertönten. Erst ab 1932 wurde diese Komponistengruppe von der Presse – und von Mihalovici selbst – mit der École de Paris, zu der auch bildende Künstler gehörten, in Verbindung gebracht. Zu dieser École de Paris, einem Sammelbecken Pariser Künstler meist aus dem Ausland, gehörten auch Alexandre Tansman und Alexander Tcherepnin, die eng mit Mihalovici befreundet waren. Aus den 1930er Jahren stammt das zeichnerische Werk von Mihalovici; neben Skizzen in Tusche und Bleistift auch zwei großformatige Bilder, die Irène und Lizica Codreanu darstellen. Bis Anfang 1931 lebte Mihalovici an der Rue Monsieur le Prince 56, anschließend an der Avenue de Châtillon 44bis. Ab August 1937 bis zu seinem Lebensende wohnte Mihalovici an der Rue du Dragon 15. Er blieb in Paris und wurde französischer Staatsbürger. Im Jahre 1932 gründete Mihalovici zusammen mit Pierre-Octave Ferroud und namhaften Pariser Komponisten, gestützt von einem internationalen Komitee, die Kammermusikgesellschaft Le Triton. Diese Institution, die bis 1939 Konzerte veranstaltete, verstand sich als offenes Forum für die Präsentation zeitgenössischer Werke aus dem In- und Ausland. Im Rahmen von Triton erklangen verschiedene Werke von Mihalovici, so 1933 die Sonate op. 35, 1934 die Suite de Karagueuz op. 23, 1935 Divertissement op. 38 und im letzten Konzert von Triton eine Frühfassung der Toccata op. 44. Am Musikfest der IGNM in Barcelona traf Mihalovici 1936 mit Paul Sacher zusammen, der ihn ab diesem Zeitpunkt aktiv mit Kompositionsaufträgen und durch die Aufführung von Werken förderte. Im Rahmen der Musikfeste der IGNM konnte Mihalovici mehrfach (1930, 1936, 1939, 1949 und 1952) eigene Werke präsentieren. Vor dem Zweiten Weltkrieg verbrachte Mihalovici regelmäßig die Sommermonate in seiner rumänischen Heimat. Bis zur Exilzeit in Cannes entstanden die Werke Toccata op. 44, Prélude et invention op. 42 und die erste Oper L’intransigeant Pluton op. 27. Im Zuge der Besetzung von Paris musste Mihalovici, der jüdischen Glaubens war, im Sommer 1940 zusammen mit Irène und Lizica Codreanu sowie deren Sohn François nach Cannes ins Exil flüchten. Manchmal kam die Pianistin Monique Haas, die spätere Ehefrau von Mihalovici, auf Besuch. Im Exil entstanden die Sonaten op. 45 und op. 47, Ricercari op. 46 für Klavier und bis 1944 das Bekenntniswerk Symphonies pour le temps présent op. 48. Die Exilzeit durchlitt Mihalovici geduldig, ertrug das Schicksal, die ständige Angst und das unerträgliche Warten, nur schwer. Nachdem Beamte der Gestapo mehrfach die Wohnung von Mihalovici durchsucht und seinen Exilort herausgefunden hatten, musste dieser bis zum Ende der Deutschen Besetzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg untertauchen und hielt sich vorübergehend bei Freunden in Mont-Saint-Léger auf. In jener Zeit partizipierte er mit einem Komitee der Front national (Résistance), die sich aktiv für die Werke von Komponisten einsetzte, die von den Nationalsozialisten verfolgt worden waren. Ab 1945 arbeitete Mihalovici intensiv für das neu erstarkte französische Radio und verfasste für den Club d’Essai nicht nur Radiomusik zum Thema antike Tragödie, sondern 1948 auch die Oper Phèdre op. 58 in Zusammenarbeit mit Yvan Goll. Zudem war er für eine Konzertreihe verantwortlich. Eine Reise nach Palästina im Frühling 1947 brachte die erste Zusammenkunft mit der Familie nach dem Ende des Krieges. Noch vor der Erstsendung von Phèdre im französischen Radio im April 1950 führte Paul Sacher in Basel die Variations op. 54 auf und bestellte kurze Zeit später ein kurzes Orchesterwerk, das unter dem Titel Sinfonia giocosa op. 65 am 14. Dezember 1951 in Basel uraufgeführt wurde. Die Tätigkeit von Mihalovici im deutschsprachigen Raum intensivierte sich damals nicht nur in der Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Ferdinand Leitner, der am 9. Juni 1951 die szenische Uraufführung von Phèdre op. 58 in Stuttgart leitete, sondern auch durch die Bekanntschaft mit dem Musikwissenschaftler Heinrich Strobel. Für die von ihm organisierten Donaueschinger Musiktage komponierte Mihalovici die Étude en deux parties op. 64 und durch dessen Einsatz gelangte am 1. März 1953 die Sinfonia partita op. 66 mit dem Südwestfunkorchester zur Uraufführung. Auch Sacher setzte sich 1954 mit der Uraufführung der Funkoper Die Heimkehr op. 70 erneut für Mihalovici ein. Meist verbrachten Mihalovici und Haas den Sommer in jener Zeit auf dem Lande, etwa in La Chapelle-en-Serval, wo Mihalovici Kompositionsprojekte vorantrieb und Haas das Programm der kommenden Saison vorbereitete. Diese Aufteilung des Jahres in eine längere Sommerpause außerhalb von Paris, während der intensiv gearbeitet wurde, und eine aktive Konzerttätigkeit ab Herbst sollte sich in den folgenden Jahren bewähren. Eine erste Auszeichnung für sein kompositorisches Werk erlangte Mihalovici 1955 mit der Verleihung des Ludwig-Spohr-Preises der Stadt Braunschweig. In Braunschweig erklangen in den folgenden Jahren durch den Einsatz des Dirigenten Heinz Zeebe mehrere Werke von Mihalovici, so 1955 Elégie op. 72, 1956 Phèdre op. 58, 1957 Thésée au labyrinthe und im Jahre 1959 Alternamenti op. 74. Mit George Enescu starb 1955 Mihalovicis Förderer und Freund, dessen fragmentarisches Werk Mihalovici auf Bitte von Enescu teilweise ergänzte. Während eines dreimonatigen Aufenthaltes in Australien, Haas war dort auf Konzertreise, begann Mihalovici 1955 mit dem groß angelegten Chor- und Orchesterwerk Sinfonia cantata op. 88, die am 24. November 1964 in Paris uraufgeführt wurde und zu den Hauptwerken von Mihalovici zählt. Zwischen 1958 und 1962 kehrte Mihalovici für kurze Zeit, nach seiner Studienzeit, nun als Lehrer an die Schola Cantorum von Paris zurück und unterrichtete »morphologie«, also Formenlehre. Diese Tätigkeit übte Mihalovici aber mit wenig Begeisterung nur wenige Jahre aus. Vielmehr investierte er seine Kräfte in neue Kompositionsprojekte, wie etwa eine Oper mit dem Freund Samuel Beckett, die seit Mai 1959 geplant war und im Juli 1960 mit der Vollendung der Partitur zu Krapp op. 81 abgeschlossen werden konnte. Die englische und deutsche Übersetzung des französischen Librettos entstand in Zusammenarbeit mit Samuel Beckett und Elmar Tophoven im Frühling 1960. Nach einer ausgedehnten Sommerpause erfolgten erste Vorbereitungen für die Aufführung im November 1960 und Januar 1961 und die Uraufführung selbst in Bielefeld am 25. Februar 1961. In diesem erfolgreichen Jahr erhielt Mihalovici zudem den Kompositionspreis der Copley Stiftung Chicago, in deren Beirat Darius Milhaud mitwirkte. Ende 1960 hatte Mihalovici seine Sinfonia variata op. 82, die durch Igor Markevitch in Auftrag gegeben worden war, vollendet. Die Uraufführung am 5. Januar 1962 erfolgte später allerdings durch das Tonhalle-Orchester Zürich unter der Leitung von Hans Rosbaud, der das Œuvre von Mihalovici schätzte und stark förderte. In jener Zeit engagierte sich Mihalovici erneut aktiv beim französischen Radio. Er wurde Mitglied des Comité de la Musique, das die Aufgabe hatte, zeitgenössische Werke für die Rundfunkproduktion auszuwählen. Er wirkte bis 1964, als das französische Radio grundlegend umgestaltet wurde, in dieser Funktion. 1965-73 war er Mitglied des Bureau de Lecture de Partitions Musicales, eines Gremiums mit derselben Aufgabenstellung. Im September 1961 begann Mihalovici sein letztes musikdramatisches Werk, die Operette Les Jumeaux op. 84, die am 23. Januar 1963 ebenfalls am Staatstheater Braunschweig uraufgeführt wurde. Erneut wandte sich Mihalovici 1962 einem Text von Beckett zu, dem Hörspiel Cascando, das er Ende des Jahres abschließen konnte, nachdem er die Sommerpause in Ascona (Schweiz) zur Fertigstellung von Les Jumeaux op. 84 verwendet hatte. Das Hörspiel wurde in Paris am 13. Juni 1963 produziert und fand bei Beckett nur begrenzte Zustimmung. Den Sommer 1963 nutzte Mihalovici für die Komposition der Musique nocturne op. 87, eines Auftrags der Festspiele Luzern, und für den Abschluss der Sinfonia cantata op. 88 für Bariton, Chor und Orchester, die am 24. November 1964 in Paris uraufgeführt wurde. Eine weitere Ehrung erreichte ihn in demselben Jahr aus Paris. Er wurde korrespondierendes Mitglied der Académie des Beaux-Arts am Institut de France, was ihn mit Stolz erfüllte. Nach schwerer Erkrankung von Mihalovici und Haas im Frühling 1965 war es dennoch möglich, bei der wichtigen Produktion von Krapp op. 81 am 25. September 1965 in Berlin teilzunehmen, die allerdings kritisch aufgenommen wurde. Weitere Produktionen dieser Oper erfolgten 1967 in Zürich, 1968 in Paris, 1979 in Darmstadt, 1984 in Oldenburg, 1985 in Madrid und nach Mihalovicis Tod auch in London, Toronto und Prag. Bereits 1966 erreichte Mihalovici der Auftrag für seine Fünfte Symphonie op. 94 direkt vom Ministère des Arts et Lettres, welche die letzte Auseinandersetzung von Mihalovici mit dem Werk Becketts darstellt. Das symphonische Werk mit Sopransolo, dem das Gedicht que ferais-je sans ce monde sans visage sans questions zu Grunde liegt, wurde erst 1969 fertig, da Mihalovici in der Nacht vom 6. auf den 7. November 1967 einen schweren Herzinfarkt erlitt und mit der Arbeit aussetzen musste. Die Uraufführung der Fünften Symphonie erfolgte am 7. Oktober 1971 in Bukarest. Die Verbindungen zur Schweiz intensivierten sich in jener Zeit, als er in Kontakt mit dem Dirigenten und Komponisten Erich Schmid trat, der 1968 das Werk Périples op. 93 uraufführte und 1973 seine Fünfte Symphonie op. 94 für das Schweizer Radio aufnahm. Ab 1969 engagierte sich Mihalovici vermehrt in internationalen Jurys, etwa beim Musikrat der Fondation Prince Pierre de Monaco für die Vergabe des Prix de Composition Musicale Prince Rainier III. de Monaco, wo er bis 1979 Einsitz nahm. 1970 und 1972 reisten Haas und Mihalovici nach Kalifornien, wo Haas Konzerte gab und Mihalovici seinen Bruder Leo besuchte, der in die USA ausgewandert war. Weitere Aufträge des französischen Ministeriums erreichten Mihalovici bis 1975, etwa zu Cantilène op. 100, bevor er 1975 selbst Mitglied der commission des commandes des Ministère des Affaires Culturelles wurde. Zu einer der letzten großen Orchesterkompositionen von Mihalovici zählt Follia op. 106 (1976), die vom französischen Radio in Auftrag gegeben wurde und Ferdinand Leitner gewidmet ist. Zudem komponierte Mihalovici in jener Zeit auch noch Bühnenmusik, etwa Héracles nach Euripides. 1976 erkrankte Haas schwer und litt bis zu ihrem Tod an einem hartnäckigen Darmleiden. Auch Mihalovici musste verschiedene Operationen über sich ergehen lassen. In den 1980er Jahren entstanden die letzten Werke, etwa das vierte Streichquartett op. 111, Miroir des songes op. 112, Torse op. 113 und Elégie II op. 114. Gegen Ende des Lebens erreichen Mihalovici weitere Auszeichnungen, etwa 1972 der Grand Prix de la ville de Paris und 1979 der Grand Prix der SACEM. Nach einem schweren Verbrennungsunfall von Monique Haas im Jahre 1984 gerieten Mihalovici und Haas in prekäre finanzielle Verhältnisse, die durch eine großzügige finanzielle Zuwendung von Paul Sacher, der als Abgeltung Manuskripte von Mihalovici bekam, gemildert wurde. Nach dem Tod von Mihalovici am 12. August 1985 und von Monique Haas am 9. Juni 1987, die beide im Urnengrab 16083 auf dem Friedhof Père-Lachaise bestattet sind, gelangten große Teile des Nachlasses in die Paul-Sacher-Stiftung nach Basel.
22.10. Nicola Bonifacio LOGROSCINO: 325. Geburtstag
Ersten Musikunterricht erhielt er von seinem Onkel Pietro Logroscino, der Kapellmeister am Dom von Bitonto war. 1714 kam er nach Neapel und – möglicherweise mit seinem Bruder – ins Conservatorio Santa Maria di Loreto, wo er unter anderem von Gaetano Veneziano (1656–1716) und von dessen Sohn Giovanni Veneziano (1683–1742) unterrichtet wurde. Letzterer zählte zu den ersten neapolitanischen Komponisten komischer Opern. 1728 wurde Nicola Logroscino Organist beim Erzbischof von Conza. Ab 1731 wirkte er in Neapel, wo seine ersten Opern entstanden. Bis etwa 1750 schrieb Logroscino meist Opern für die unbedeutenderen Theater Neapels, vielfach als Pasticcio zusammen mit anderen Komponisten. Großen Erfolg hatte er mit L‘Olimpiade, die 1753 am Teatro Argentina in Rom aufgeführt wurde. Hiervon gibt es eine anonyme Kritik, die Pier Leone Ghezzi mit einer Zeichnung versah, die Logroscino beim Dirigieren einer Oper vom Cembalo aus zeigt. Ab 1758 war er Kapellmeister am Conservatorio de’ figliuoli dispersi in Palermo. Im Herbst 1765, etwa ein Jahr nach seinem Tod, wurde seine Oper La gelosia am Teatro Grimani in Venedig aufgeführt. Im Essai sur la musique ancienne et moderne von 1780 des französischen Komponisten Jean-Benjamin de La Borde wurde Logroscino als „Dieu du genre buffon et modèle à presque tous les compositeur du genre“ beschrieben. In neueren Studien hingegen wurde seine Rolle als deutlich weniger bedeutsam für die Entwicklung der Oper im 18. Jahrhundert eingeschätzt.
23.10. Ned ROREM: 100. Geburtstag
Seine Mutter, Gladys Miller, war zur Zeit seiner Geburt als Bürgerrechts-Aktivistin engagiert, und sein Vater, C. Rufus Rorem, Volkswirt in einem pharmazeutischen Unternehmen. 1924 zog die Familie nach Chicago, wo der Vater eine Universitätsprofessur übernahm. Beide Eltern waren zu den Quäkern konvertiert, deren Gottesdienste Ned Rorems Kindheit mitprägten. Obwohl die Eltern selbst wenig Musikkenntnisse besaßen, ermöglichten sie Ned und dessen zwei Jahre älterer Schwester regelmäßige Konzertbesuche. So erlebte er Pianisten wie Paderewski, Rachmaninow oder das Ehepaar Bartók. Beide Kinder erhielten Klavierunterricht, wobei Ned seine Schwester bald überflügelte. Als Elfjähriger kam Rorem mit den Werken Debussys und Ravels in Kontakt, was für seine spätere frankophile Neigung mitbestimmend war. In der Folgezeit lernte er auch zeitgenössische amerikanische Musik und den Jazz kennen und schrieb erste Kompositionen nieder. Im Juni 1940 spielte Rorem den 1. Satz des Klavierkonzertes von Edvard Grieg mit dem American Concert Orchestra. Im gleichen Monat machte er seinen High-School-Abschluss an der „University of Chicago Lab School“. Es folgten erste ernsthafte Studien in Musiktheorie und Harmonielehre bei Leo Sowerby am American Conservatory in Chicago. In dieser Zeit begegnete er dem Dichter Paul Goodman. Zwischen beiden entwickelte sich eine Freundschaft, die bis zu Goodmans Tod 1972 bestand. In seinen ersten Liedern (die er 1983 in einem Buch die gelungensten seines Schaffens nannte) vertonte Rorem Texte Goodmans. Trotz schwacher schulischer Leistungen wurde Rorem wegen seines „kreativen Potenzials“ an der Northwestern University’s School of Music als Jungstudent angenommen. In der Aufnahmeprüfung überzeugte er als Pianist, so dass er neben der Kompositionsklasse bei Alfred Nolte auch in die Klavierklasse Harold Van Hornes aufgenommen wurde. 1943 wechselte er ans Curtis Institute of Philadelphia und studierte dort bei Rosario Scalero und Gian Carlo Menotti. Rorem freundete sich mit Kommilitonen an, die später Interpreten seiner Werke wurden, darunter Gary Graffman und Eugene Istomin. Im Sommer 1943 wurde sein Seventieth Psalm, 1944 seine Four-Hand Piano Sonata aufgeführt. 1944 verließ er das Curtis Institute und zog gegen den Wunsch der Eltern nach New York. Dort bestritt er seinen Lebensunterhalt als Kopist Virgil Thomsons, der ihn in Orchestrierung unterrichtete. Vorübergehend arbeitete Rorem auch als Korrepetitor in der Ballettklasse Martha Grahams. Auf Drängen des Vaters begann Rorem ein Kompositionsstudium an der Juilliard School in New York bei Bernard Wagenaar und verbrachte die Sommer 1946 und 1947 am Berkshire Music Center in Tanglewood, wo er bei Aaron Copland studierte. 1948 schloss er sein Studium erfolgreich ab. Seine Abschlussarbeit, die Overture in C, erhielt den mit 1.000 $ dotierten „Gershwin Memorial Award“. Im gleichen Jahr wurde The Lordly Hudson auf Gedichte Paul Goodmans von der Music Library Association zum besten veröffentlichten Lied des Jahres gewählt. Der Gewinn des Gershwin-Preises erlaubte Rorem eine Reise nach Frankreich; der ursprünglich für drei Monate geplante Aufenthalt dauerte schließlich neun Jahre. In den ersten zwei Jahren lebte er mehrere Monate in Marokko im Haus eines Freundes und schrieb zahlreiche Kompositionen, darunter allein zwanzig Orchesterwerke. 1950 erhielt er den „Lili Boulanger-Preis“, 1951 den „Prix de Biarritz“ für das Ballett Mélos und im gleichen Jahr ein Fulbright-Stipendium, das ihm ein Studium bei Honegger in Paris ermöglichte. Rorem war einer der wenigen amerikanischen Komponisten, die, obwohl in Frankreich studierend, keinen Unterricht bei der renommierten Lehrerin Nadia Boulanger nahmen. Boulanger lehnte ihn als Schüler ab, aber nicht wegen mangelnder Begabung, sondern weil sie der Ansicht war, dass dadurch die bereits geformte Persönlichkeit des 24-Jährigen verfälscht würde. In Paris lernte Rorem die Mäzenin Vicomtesse Marie-Laure de Noailles kennen, in deren Haus er bis zum Ende seiner Pariser Zeit lebte. Dort traf er viele der bedeutendsten Komponisten, Maler und Literaten der Zeit. Die Pariser Jahre Rorems wurden zu den produktivsten seines kompositorischen Schaffens. Neben der musikalischen Arbeit führte Rorem ab den fünfziger Jahren Tagebuch, in dem das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Frankreich – später in Amerika – unterhaltsam und teils rücksichtslos kommentiert wird. Die in fünf Bänden publizierten Tagebücher enthalten neben Beschreibungen berühmter Maler, Komponisten, Dichter und Dirigenten auch persönliche Berichte über seine homosexuellen Beziehungen und Probleme mit Alkohol, Drogen und Depressionen. Die Veröffentlichung des ersten Tagebuchs, des „Paris Diary“, erregte 1966 in Kreisen des amerikanischen Bürgertums Aufregung und Empörung. Bereits 1949 hatte Rorem für die Zeitschrift Musical America einen Artikel verfasst. Es folgten Essays, Artikel und Musikkritiken, die in großen Zeitungen und Fachzeitschriften der USA erschienen und auch in Buchform ediert wurden. Darunter sind zahlreiche Berichte und Anmerkungen zu Komponisten, die durch Bekanntschaft oder Freundschaft geprägt sind, darunter Poulenc, Milhaud, Honegger, Auric, Virgil Thomson, Copland, Nadia Boulanger, Carter, Bernstein und Boulez; aber auch Literaten wie Auden, Chester Kallman, Cocteau, Pound oder Green. Auch mit dem amerikanischen Schriftsteller John Cheever hatte Rorem eine kurze Affäre. 1996 erschien die Autobiographie „Knowing When to Stop“, welche die Zeit bis 1949 umfasst. Immer wieder wies Rorem darauf hin, dass seine Musik und seine literarischen Arbeiten einander ergänzten, indem er in der Musik seinen Wunsch nach Ordnung und System realisiere, sein Schreiben aber den Willen zum Chaos befriedige. Mitte der fünfziger Jahre besuchte Rorem dreimal die USA, um Premieren eigener Werke beizuwohnen und sich um die Publikation neuer Stücke zu kümmern. Erst 1958 aber übersiedelte er wieder nach Amerika. Unter anderem war die repressive Kultur- und Sozialpolitik der McCarthy-Ära für das lange Verweilen in Frankreich verantwortlich. Die offene Homosexualität Rorems wurde in der damaligen amerikanischen Gesellschaft weniger toleriert als in Frankreich. Im „New York Diary“ beschreibt Rorem, dass sein ausschweifender Lebensstil mit Alkoholproblemen in New York zunächst bestehen blieb, auch wenn er versuchte, die Sucht medikamentös, durch Entziehungstherapien und Teilnahme an Treffen der „Anonymen Alkoholiker“ zu bekämpfen. Er beschrieb die Jahre 1955–65 als seine „drinking decade“. Erst der Organist James Holmes, den Rorem 1967 kennenlernte, und mit dem er bis zu dessen Tod 1999 in einer Partnerschaft lebte, nahm stabilisierenden Einfluss auf sein Leben. Ned Rorem starb am 18. November 2022 im Alter von 99 Jahren in Manhattan.
23.10. Otto SCHEIDL: 125. Geburtstag
Er erhielt seine Ausbildung zum Sänger in Wien und debütierte 1924 am dortigen Schlosstheater Schönbrunn. 1925-28 war er am Stadttheater von Reichenberg (Liberec) in Böhmen, 1928-33 am Stadttheater von Bremerhaven und 1933-36 am Stadttheater von Dortmund engagiert. 1936-44 war er dann Mitglied des Staatstheaters von Wiesbaden, an dem er in einer Vielzahl von Partien aus dem Buffo- wie dem Charakterfach auftrat, darunter als Mime im Nibelungenring, als David in »Die Meistersinger von Nürnberg«, als Monostatos in der »Zauberflöte«, als Don Basilio in »Le nozze di Figaro«, als Veit in »Undine« und als Georg im »Waffenschmied« von Lortzing, als Goro in »Madame Butterfly« und als Spoletta in »Tosca«. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er gastierend in Bremerhaven, betätigte sich dann aber dort auch als Pädagoge und Leiter einer Musikschule. In den Jahren 1967-68 war er nochmals am Stadttheater von Bremerhaven fest engagiert und wirkte dort als Ballettrepetitor. Er starb 1993 in Bremerhaven.
23.10. Philipp SIEGRIST: 200. Geburtstag
Der Sänger, dessen eigentlicher Name Philipp Garnhuber war, wanderte in seiner Jugend nach Italien aus. Dort leistete er in der Armee des Königs Ferdinand von Sizilien Militärdienst. Nach Deutschland zurückgekehrt, wandte er sich dem Theater zu und trat als Bassist, vor allem als Bass-Buffo auf. Er hatte sein erstes Engagement 1849-50 am Theater von Glatz in Schlesien, sang dann 1850-51 am Hoftheater von Altenburg in Thüringen, 1851-52 am Theater in der Josefstadt in Wien, 1852-53 am Hoftheater von Neustrelitz, 1853-54 am Theater von Brandenburg, 1854-55 am Stadttheater von Posen (Poznan), 1855-59 am Hoftheater von Oldenburg und 1859-60 am Opernhaus von Düsseldorf. 1860-61 wirkte er am Theater von St. Gallen als Sänger und Regisseur, 1861-62 wieder in Posen, 1862-67 am Friedrich Wilhelmstädtischen Theater Berlin. Neben seiner Karriere auf der Opernbühne kam eine zweite als Schauspieler in Sprechstücken zustande. Seit 1867 wandte er sich ganz dem Schauspiel zu und trat bis 1899 am Königlichen Schauspielhaus Berlin in komischen alten Rollen auf. Als seine Glanzrolle im Bereich der Oper galt der Leporello in »Don Giovanni«. Er starb 1904 in Berlin.
23.10. Pietro GENERALI: 250. Geburtstag
Über sein Geburtsdatum gibt es unterschiedliche Angaben, die Musikenzyklopädie Grove vermerkt hierzu den 23. Oktober 1773. Sein Vater änderte seinen Familiennamen, als er nach einem Bankrott mit seiner Familie nach Rom zog. Hier studierte Pietro Musik bei Giovanni Masi und schrieb nach einem Abschluss an der Congregazione di Santa Cecilia in Rom zunächst Kirchenmusik, bevor er 1800 seine erste Oper veröffentlichte. Sein erster größerer Erfolg auf diesem Gebiet war die farsa Pamela nubile am Teatro San Benedetto im Jahre 1804, eine Zusammenarbeit mit dem bekannten Librettisten Gaetano Rossi, gefolgt von Le lagrime d’una vedova Ende Dezember 1808 am kleinen Teatro San Moisè. Bis zu Rossinis Aufstieg zählte er zu den bekanntesten Komponisten in Venedig. So hatte seine farsa Adelina, eine opera semi-seria oder farsa, die ebenfalls gemeinsam mit Rossi entstand, am Teatro San Moisè mit 20 Vorstellungen die meisten Aufführungen und übertraf damit Rossinis La cambiale di matrimonio um 8 Vorstellungen. 1812 schrieb er die Opera seria Attila und erzielte auch hier einige Erfolge, 1817 I Bacchanali di Roma. Inzwischen behinderte die überwältigende Popularität von Rossini andere italienische Opernkomponisten am Aufbau ihrer eigenen Karriere. Generali zog deshalb nach Barcelona als Direktor der Operngesellschaft am Teatro Santa Cruz. Hier blieb er zwei Saisons, besuchte 1818 Italien und war 1819 in Paris, wo in jenem Jahr einige Frühwerke von ihm am Théâtre-Italien wiederaufgeführt wurden. 1821-23 lebte er in Neapel, wo er noch einige Opern schrieb und unterrichtete, wobei unter anderem Luigi Ricci zu seinen Schülern zählte. Nach dieser Zeit kam seine Tätigkeit als Opernkomponist zu einem Ende. Er wurde Musikdirektor der Oper Palermo und wurde in dieser Funktion 1825 durch Donizetti ersetzt. Als im Mai 1826 die Polizei entdeckte, dass er Mitglied einer Freimaurerloge war, musste er das Königreich beider Sizilien verlassen. Er kehrte nach dem heimatlichen Norditalien zurück und wurde 1827 Maestro di cappella an der Kathedrale von Novara. Dieses Amt übte er bis zu seinem Tode 1832 aus und widmete sich in seinen letzten Lebensjahren hauptsächlich der Komposition von Kirchenmusik und dem Unterricht. Es sind von ihm etwa 54 Opern überliefert, sowie zahlreiche Kantaten, Messen, Requiems und andere kirchenmusikalische Werke. Unter seinen Zeitgenossen gab es widersprüchliche Beurteilungen seines Werks. 1828 schrieb der Kritiker Tommaso Locatelli in der Gazetta di Venezia über seine Oper Francesca di Rimini: „Es herrscht hier eine gewisse Sorglosigkeit, eine gewisse Trivialität des Stils, als ob der Maestro beinahe per otium (in der Freizeit) geschrieben hätte.“ In der Tat war Generali für eine etwas oberflächliche Art des Komponierens bekannt, was ihn oft dazu führte, seine Opern erst während der Probenarbeit fertig zu schreiben. Pietro Generali ist heute selbst in Italien kaum mehr bekannt. Das Festival Rossini in Wildbad unternahm 2010 den erfolgreichen Versuch, Generali einem heutigen Publikum näherzubringen. Die moderne Erstaufführung von Adelina fand am 16. Juli 2010 im Königlichen Kurtheater Bad Wildbad in der Regie von Kay Link statt, die Titelpartie sang Dusica Bijelic. Deutschland Radio Kultur übertrug Adelina am 24. Juni 2010, eine Publikation auf CD ist 2015 bei Naxos erschienen.
24.10. Alexandru IONITZA: 75. Geburtstag
Der in Rumänien geborene Künstler studierte zuerst Ingenieurwissenschaften, ließ dann jedoch seine Stimme an der Musikakademie in Bukarest ausbilden. Nachdem er bereits in Bukarest debütiert hatte, verließ er Rumänien und sang an verschiedenen Häusern im Westen. Er war 1971-73 am Theater von Klagenfurt, 1973-76 am Stadttheater von Bielefeld, 1976-84 bei den Städtischen Bühnen Münster, seit 1984 an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg engagiert. 1978 war er Preisträger beim Maria Callas-Wettbewerb in Athen. Auch dem Theater am Gärtnerplatz München verbunden, wo er u.a. als Rodolfo in »La Bohème« sehr erfolgreich auftrat. Man hörte ihn an der Deutschen Oper Berlin wie an der Wiener Volksoper als Belmonte in der »Entführung aus dem Serail«, an der Staatsoper von Stuttgart als Alfredo in »La Traviata«, an der Oper von San Diego als Rodolfo in »La Bohème«. 1987-88 gastierte er bei den Festspielen von Bregenz als Hoffmann in »Hoffmanns Erzählungen« von Offenbach, an der Opéra de Wallonie Lüttich als Faust von Gounod, am Opernhaus von Köln als Alfredo und 1991 als Nemorino in »L‘Elisir d’amore«, an der Wiener Staatsoper als Matteo in »Arabella« von Richard Strauss. 1993 sang er an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg den Rodolfo. Weitere Gastspiele an deutschen, holländischen und Schweizer Theatern, dazu intensive Konzerttätigkeit. Auf der Bühne standen lyrische Partien im Mittelpunkt seines umfangreichen Repertoires. Er starb 2010 in Düsseldorf. Er war verheiratet mit der Sopranistin Tamara Lund (1941-2005), die in der Hauptsache in München wirkte.
Schallplatten: Ariola-Eurodisc (Beppe im »Bajazzo«, Borsa in »Rigoletto«), Decca (Elemer in »Arabella«), Orfeo (»Oedipus Rex« von Strawinsky, »Alzira«, von Verdi).
24.10. Anna STARASTOVÁ: 80. Geburtstag
Informationen über die slowakische Sopranistin auf Tschechisch: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=42257
24.10. Hans KRAEMMER: 90. Geburtstag
Gesangstudium an der Wiener Musikakademie bei Josef Witt. Er debütierte 1962 am Landestheater Saarbrücken als Leporello in »Don Giovanni«. 1964-69 war er am Stadttheater von Freiburg i. Br., 1969-72 am Theater am Gärtnerplatz in München engagiert. 1971-99 war er Mitglied der Wiener Volksoper, wo er in über 1.500 Vorstellungen in 65 verschiedenen Rollen zu sehen war. Bei den Salzburger Festspielen sang er 1968-69 eine kleine Partie im »Barbier von Sevilla«, 1971-72 den Doktor in »Wozzeck«, 1976 den Antonio in »Le nozze di Figaro« und wirkte dort am 7.8.1981 in der Uraufführung der Oper »Baal« von F. Cerha in mehreren Rollen mit. 1972-95 trat er auch an der Wiener Staatsoper auf (u.a. als Betto in Puccinis »Gianni Schicchi«, als Frosch wie als Frank in der »Fledermaus« sowie als Haushofmeister in »Ariadne auf Naxos« von R. Strauss). Von seinen weiteren Partien aus dem Opern- wie dem Operettenrepertoire sind zu nennen: der Dulcamara in »L‘Elisir d’amore«, der Titelheld in »Don Pasquale«, der Plumkett in Flotows »Martha«, der Agamemnon in »Die schöne Helena« von Offenbach, der Zsupan im »Zigeunerbaron« von J. Strauß und der Baron Weps im »Vogelhändler« von C. Zeller, den er u.a. 1984 bei den Festspielen von Bregenz sang, wo er bereits 1978 als Ormuz in der Johann-Strauß-Operette »Tausendundeine Nacht« auftrat. Neben seiner Laufbahn als Opernsänger war er auch als Schauspieler tätig. Er starb 2021 in Wien.
Schallplatten: Decca-Video (»Arabella«).
24.10. Irma KELLER: 100. Geburtstag
Nach ihrer Ausbildung, die in Zürich stattfand, begann sie ihre Bühnenkarriere mit einem Engagement am Theater von St. Gallen (1948-49) und war dann 1955-57 am Opernhaus von Zürich tätig. 1957-59 gehörte sie dem Opernhaus von Frankfurt a.M., 1959-61 dem Opernhaus von Köln an. Sie trat in ihrer Schweizer Heimat als Gast auf der Bühne wie im Konzertsaal hervor. Bühnenpartien der Sängerin waren dabei u.a. der Cherubino in »Le nozze di Figaro«, die Dorabella in »Così fan tutte«, die Titelrolle in »Oberon« von Weber, der Nicklaus in »Hoffmanns Erzählungen«, der Hänsel in »Hänsel und Gretel«, die Magdalene in »Die Meistersinger von Nürnberg«, die Fenena in Verdis »Nabucco«, die Amneris in »Aida«, der Octavian im »Rosenkavalier« und die Christine in »Die schwarze Spinne« von H. Sutermeister, die sie u.a. in einer Opernsendung über Radio Zürich sang. Am 6.6.1957 wirkte sie am Opernhaus von Zürich in der szenischen Uraufführung von »Moses und Aron« von Schönberg mit. 1957 gastierte sie am Teatro San Carlos Lissabon.
25.10. Giuliano CIANNELLA: 80. Geburtstag
Er begann das Ingenieurstudium an der Universität von Bologna und schloss diese Ausbildung mit dem Staatsdiplom ab. Zugleich ließ er aber auch seine Stimme (nach deren zufälliger Entdeckung in einem befreundeten Haus) ausbilden, wozu die große Sopranistin Mirella Freni ihn ermutigt hatte. Am Konservatorium von Bologna war er Schüler von Leone Magiera, später wurde er durch den berühmten Tenor Carlo Bergonzi weitergebildet. Er gewann mehrere Gesangwettbewerbe, darunter den Concours von Busseto, und debütierte 1974 in Mailand als Edgardo in »Lucia di Lammermoor« von Donizetti. Er hatte daran anschließend große Erfolge bei Auftritten in Genua, Venedig und Parma und debütierte 1976 als Cassio in Verdis »Otello« an der Mailänder Scala, an der er dann auch 1978 den Carlo in Verdis »I Masnadieri«, 1978-79 den Pinkerton in »Madame Butterfly«, 1979 den Jacopo Foscari in Verdis »I due Foscari« und 1989 in einem Galakonzert sang. 1979 kam er zu einem erfolgreichen Debüt an der Metropolitan Oper New York als Cassio in Verdis »Otello« (nachdem er bereits zuvor in einigen konzertanten Aufführungen dieser Kompanie in New Yorker Parkanlagen den Alfredo in »La Traviata« gesungen hatte). Bis 1989 sang er dort in insgesamt 112 Vorstellungen auch den Des Grieux in Puccinis »Manon Lescaut«, das Tenorsolo im Verdi-Requiem, den Rinuccio im »Gianni Schicchi«, den Rodolfo in »La Bohème«, den Pinkerton, den Manrico im »Troubadour«, den italienischen Sänger im »Rosenkavalier«, den Macduff in Verdis »Macbeth«, den Titelhelden in Verdis »Don Carlos« und den Calaf in Puccinis »Turandot«. Seine Karriere nahm eine schnelle Entwicklung; er sang beim Maggio Musicale Fiorentino, an der Staatsoper von Hamburg, in Chicago (1982 den Pinkerton), San Francisco (1984 den Don José in »Carmen«), Houston/Texas (1985 den Faust von Gounod) und an der Deutschen Oper Berlin. Der Sänger, der in Monte Carlo seinen Wohnsitz nahm, wurde durch weitere Gastspiele international bekannt; 1983, 1985 und 1988 wirkte er bei den Festspielen in der Arena von Verona mit. 1985 gastierte er an der Münchner Staatsoper als Don Carlos in der gleichnamigen Verdi-Oper, 1988 in Köln als Don José und 1990 als Des Grieux. An der Wiener Staatsoper, an der er 1985 als Cavaradossi in »Tosca« debütierte, hörte man ihn bis 1991 auch als Calaf, als Rodolfo in »La Bohème«, in der Titelrolle von »Andrea Chénier« von Giordano, als Faust von Gounod, als Manrico, als Edgardo, als Des Grieux in »Manon Lescaut«, als Alfredo, als italienischen Sänger im »Rosenkavalier«, als Alvaro in »La forza del destino«, als Pinkerton, als Rodolfo in »Luisa Miller« und als Riccardo in Verdis »Un ballo in maschera«. 1987 sang er in den Aufführungen von Verdis »Aida« vor den Tempeln von Luxor den Radames. 1989 hörte man ihn in Hannover als Cavaradossi, an der Deutschen Oper Berlin als Edgardo, am Teatro Regio Parma wieder als Riccardo. 1990 trat er am Teatro Carlo Felice in Genua einmal mehr als Riccardo, im Palais des Sports Lüttich als Manrico auf. Aus seinem reichhaltigen Bühnenrepertoire sind noch der Raoul in den »Hugenotten« von Meyerbeer und der Otello in Rossinis Oper gleichen Namens nachzutragen. Auch als Konzertsolist hatte er eine bedeutende Karriere. Er starb 2008 in Ferrara.
Schallplatten: Discocorp (Cassio in Verdis »Otello«).
25.10. Colette HERZOG: 100. Geburtstag
Sie erhielt ihre Ausbildung in der Hauptsache durch Lucie Schaeffer am Konservatorium von Nancy. Seit 1945 unterrichtete sie zehn Jahre lang am Konservatorium von Besançon. Ihre Stimme wurde durch den Dichter Antoine Goléa entdeckt (den sie später heiratete), als sie 1957 in Besançon das Sopransolo in einer Messe von Haydn sang. 1958 interpretierte sie in Straßburg »Le Visage nuptial« von Pierre Boulez und »Das Buch der hängenden Gärten« von Schönberg. 1964 folgte sie einem Ruf an die Grand Opéra Paris und sang als Antrittsrolle die Zerlina in »Don Giovanni«. Partien wie die Gräfin in »Le nozze di Figaro«, die Mélisande, die Eurydike in »Orpheus und Eurydike« von Gluck, die Céphise in »Zoroastre« von Rameau und die Mme. Fabien in »Volo di notte« von Dallapiccola bestätigten ihren Ruf als führende Sängerin der Opéra, an der sie bis 1971 engagiert war. Sie gastierte beim Maggio Musicale von Florenz 1964 in »Die Zwingburg« von E. Krenek, 1972 am Teatro Comunale Bologna als Donna Elvira in »Don Giovanni«, auch an der Deutschen Oper Berlin, und sang 1971 am Opernhaus von Rouen die Partie der Calypso in der französischen Erstaufführung der Oper »Ulysse« von L. Dallapiccola. Gastspiele in Nizza, Marseille, Bordeaux (französische Premiere der Oper »Bluthochzeit« von W. Fortner), Montreux und Besançon. Noch bedeutender war jedoch ihre Karriere im Konzertsaal. Hier kreierte sie Werke von Bondon, Egk, Tomasi, Casanova, Chailly und Bibalo. Ivo Malec komponierte für sie »Cantate pour elle« (1966) und Jolivet »Songe à nouveau rêvé« nach Gedichten ihres Gatten A. Goléa (1971). 1969 trat sie in Hamburg in einem Konzert anlässlich des Weltmusikfestes auf. 1981 sang sie in der Uraufführung von »El tigro de Oro« von Clostre, einem Werk das Radio France in Auftrag gegeben hatte. Geschätzte Pädagogin. Sie starb 1986 in Paris.
Schallplatten: DGG (»L’Enfant et les sortilèges« von Ravel), Philips.
25.10. Thomas Johannes JENSEN: 125. Geburtstag
Biographie des dänischen Dirigenten auf Dänisch: https://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jensen_(dirigent)
26.10. Raija MÄÄTTÄNEN-FALCK: 90. Geburtstag
Sie studierte zunächst Violoncello, dann Gesangstudium bei den Pädagogen Toru Linnala und Matti Lehtinen in Helsinki sowie bei Luigi Ricci in Rom. Seit 1960 war sie als Chorsängerin an der Nationaloper von Helsinki tätig; sie debütierte dort 1965 als Solistin. Neben ihrem Wirken an der Nationaloper von Helsinki wurde sie durch zahlreiche Auftritte bei den Festspielen von Savonlinna und im Finnischen Rundfunk bekannt. 1989 gastierte sie am Opernhaus von Essen. Seit 1965 gab sie auch Konzerte, in denen sie vor allem in Oratorien und in Werken aus dem Bereich der religiösen Vokalmusik erfolgreich war. Sie starb im Jahr 2015. – Sie war 1962-89 mit dem Bariton Jorma Falck (1939-2017) verheiratet.
Schallplatten: Finnlevy (»Juha« von Merikanto), BIS (Opernszenen aus Savonlinna).
26.10. Jesús Quiñones LEDESMA: 90. Geburtstag
Biographie des puertorikanischen Tenors auf Spanisch:
https://prpop.org/biografias/jesus-quinones-ledesma/
26.10. Janusz POPŁAWSKI: 125. Geburtstag
Er wurde in Polen bekannt, nachdem er 1927 an die Nationaloper von Warschau engagiert worden war, an der er seitdem eine bedeutende Karriere entfalten konnte. Neben seinen Erfolgen in Polen ist er auch als Bühnen- und Konzertsänger in Nordamerika hervorgetreten. Dabei benutzte er teilweise Künstlernamen wie Jan Bolesta und Marian Olszewski. Er starb im März 1971.
Schallplatten seiner Stimme sind nicht bekannt.
27.10. Anni ANDRASSY: 125. Geburtstag
Eigentlicher Name Anni Berchtenbreiter; sie war eine jüngere Schwester der berühmten Altistin Maria Olszewska (1892-1969). Sie begann ihre Bühnenkarriere 1921-24 am Stadttheater von Krefeld und sang dann 1924-25 am Opernhaus von Leipzig, 1925-26 am Landestheater von Oldenburg, 1926-28 am Landestheater Hannover, 1928-31 am Opernhaus von Essen und 1931-34 am Landestheater Wiesbaden. Sie setzte ihre Karriere mit Engagements an der Wiener Volksoper (1934-35), am Theater von Königsberg (Ostpreußen, 1935-37), am Stadttheater von Kiel (1938-39) und am Theater von Posen (Poznan) fort. 1928 gastierte sie an der Covent Garden Oper London als Magdalene in »Die Meistersinger von Nürnberg«, als Rheintochter und als eine der Walküren im Ring-Zyklus, während ihre Schwester die großen Wagnerrollen sang. 1929 erschien sie nochmals an der Covent Garden Oper als Magdalene und als Annina im »Rosenkavalier«. Bei dieser Gelegenheit entstand ihre einzige Schallplattenaufnahme, das Finale des 2. Aktes des »Rosenkavaliers« mit Richard Mayr als Ochs auf Lerchenau, unter dem Etikett von Columbia. Sie sang auf der Bühne Partien wie die Venus in »Tannhäuser«, die Ortrud imn»Lohengrin«, die Brangäne in »Tristan und Isolde«, die Fricka und die Waltraute im Ring-Zyklus, die Azucena im »Troubadour«, die Amneris in »Aida«, die Adelaide in »Arabella« von R. Strauss und die Margret in »Wozzeck« von A. Berg (die sie auch bei der Premiere dieser Oper 1929 in Oldenburg sang, bei der es sich um die erste Aufführung des Werks nach der Berliner Uraufführung handelte). Sie lebte nach ihrem Rücktritt von der Bühne in London, wo sie 1959 starb.
28.10. Kenneth MONTGOMERY: 80. Geburtstag
Er begann seine berufliche Laufbahn an der Glyndebourne Festival Opera und der Englischen Nationaloper (damals noch unter dem Namen Sadler’s Wells Opera bekannt). 1973 wurde er Musikdirektor der Bournemouther Sinfonietta und zwei Jahre später Musikdirektor der Glyndebourne Touring Opera. Nach seinem Erstauftritt 1970 bei der Nederlandse Opera machte er sich schnell in den Niederlanden einen Namen und wurde 1975 zunächst Hauptdirigent des Sinfonieorchesters des niederländischen Rundfunks und anschließend Leiter des niederländischen Rundfunkchors. Er trat regelmäßig als Dirigent bei der Nederlandse Opera sowie bei der niederländischen Nationale Reisopera auf. Mitte der 1970er Jahre nahm er seine langjährige Tätigkeit als Gastdirigent der Samstagnachmittag-Konzerte bei der niederländischen Rundfunkanstalt VARA auf. Kenneth Montgomery war auch auf der internationalen Bühne keine unbekannte Persönlichkeit. Er trat als Gastdirigent in Frankreich, Belgien, Italien, den USA, in Kanada und Australien auf. Zudem hatte er verschiedene Posten an einigen anderen Opernhäusern bekleidet. Er wurde künstlerischer und musikalischer Direktor der nordirischen Oper und Rektor für Opernstudien am Königlichen Konservatorium in Den Haag, wo ein nach ihm benannter Lehrstuhl eingerichtet wurde. Kenneth Montgomery trat auch regelmäßig als Gastdirigent mit Orchestern in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den USA und Kanada auf. Viele seiner Aufzeichnungen sind auf LP und CD verfügbar. Er starb am 5.3.2023 in Amsterdam.
Weitere Informationen auf seiner Homepage: http://www.kennethmontgomery.net/
28.10. Eduard WOLLITZ: 95. Geburtstag
Bereits mit neun Jahren erhielt er Geigen- und Klavierunterricht, dann Chorknabe an St. Michaelis in Hamburg. Seit 1946 Kapellmeisterstudium an der Hamburger Musikhochschule, seit 1948 Gesangsausbildung durch Frau Bertha Dammann in Hamburg. Er trat gelegentlich in Konzertveranstaltungen auf, betätigte sich aber zunächst als Chorleiter, Liedbegleiter und Repetitor. 1952 begann er seine Bühnenlaufbahn am Landestheater von Darmstadt. Über das Stadttheater von Heidelberg kam er an das Opernhaus von Wuppertal und wirkte dann 1963-65 am Opernhaus Zürich. Seit 1966 erster seriöser Bass am Staatstheater von Wiesbaden. Hier wie bei seinen zahlreichen Gastspielen sang er als Hauptpartien den Gurnemanz in »Parsifal«, den König Marke in »Tristan und Isolde«, den Daland in »Der fliegende Holländer«, den Landgrafen in »Tannhäuser«, den Sarastro in der »Zauberflöte«, den Ochs im »Rosenkavalier«, den La Roche in »Capriccio« von R. Strauss und den Rocco in »Fidelio«. Neben seinem Wirken auf der Bühne stand eine zweite ebenso bedeutende Karriere als Konzert- und namentlich als Oratoriensänger. Gastspiele und Konzerte in den deutschen Großstädten, in Amsterdam, Paris, Bordeaux, Lyon, Straßburg, Genf, Wien, Warschau, Rom, Venedig, Neapel, Turin, Barcelona, Kopenhagen, Stockholm, Teheran, Portland (USA) und Los Angeles. Er wirkte bei den Festspielen von Wiesbaden, bei den Händel-Festspielen Göttingen, beim Maggio Musicale von Florenz, bei den Festwochen von Zürich und den Bach-Festwochen von Ansbach mit. Rundfunksendungen über viele deutsche und westeuropäische Sender, Auftritte im deutschen, französischen, Schweizer und dänischen Fernsehen. Seit 1974 neben seinem Engagement in Wiesbaden Professor für Gesang im Fachbereich Musikerziehung an der Universität Mainz. Er gab seine Autobiographie unter dem Titel »Heiteres und Bedenkliches: Erinnerungen aus einem langen Sängerleben« heraus. Er starb im Oktober 2022.
Schallplatten: Vox (»L’Incoronazione di Poppea« und »Il ritorno d’Ulisse in patria« von Monteverdi, »Elias« von Mendelssohn, Requiem-Messen von Verdi und Mozart), Cantate (Bach-Kantaten), Opus (Cäcilien-Messe von Cherubini).
28.10. Pierre-Marius JOURDAN: 200. Geburtstag
Er erhielt seine Ausbildung am Conservatoire National Paris, die dort 1845 zum Abschluss kam. 1846 debütierte er an der Opéra-Comique Paris in »Zémire et Azor« von Grétry und blieb während der folgenden 14 Jahre bis 1860 an diesem Haus tätig. 1860-69 gehörte er zum Ensemble des Théâtre de la Monnaie Brüssel; 1869-70 war er am Théâtre Athénée Paris engagiert, 1870-71 an der Oper von Antwerpen und 1871-73 nochmals am Théâtre de la Monnaie Brüssel. Danach trat er noch am Théâtre de la Haye im Haag auf. Er sang an der Opéra-Comique 1848 in der Uraufführung der Oper »Le Val d’Andorre« von Halévy, 1852 in der von »Le Farfadet« von A. Adam, am 16.2.1854 in der von »L’Étoile du Nord« von Meyerbeer, am 23.2.1856 in der von »Manon Lescaut« von Auber (der Gervais), in Brüssel 1865 in der von »Le Captif« von Eduard Lassen. 1871 gastierte er an der Covent Garden Oper London in »Hamlet« von A. Thomas und in Meyerbeers »L‘Étoile du Nord«. Aus seinem umfangreichen Bühnenrepertoire sind der Titelheld in »Richard Coeur-de-Lion« von Grétry, der Hüon in »Oberon« von Weber, der Nephtali in »Joseph« von Méhul, der Capuzzi in »Zampa« von Hérold, der Georges in »L’Éclair« von Halévy, der Lorédan in Aubers »Haydée«, der Horace in »Le Domino noir« vom gleichen Komponisten, der Nourredin in »Lalla-Roukh« von David, der Philémon in Gounods »Philémon et Baucis«, der Vincent in »Mireille«, der Faust, der Roméo in »Roméo et Juliette«, der Lara in der gleichnamigen Oper von Maillart, der Tonio in Donizettis »La Fille du Régiment« und der Alfredo in »La Traviata« zu nennen. Er starb 1879 in Brüssel. Er war verheiratet mit der Opernsängerin Alexandrine-Marie Mercier (* 22.7.1828 Paris), die ihre Ausbildung am Conservatoire de Paris erhalten hatte, 1846 an der Pariser Opéra-Comique in »Les Diamants de la Couronne« von Auber debütierte und bis 1852 an diesem Haus auftrat.
29.10. Emmanuel BONDEVILLE: 125. Geburtstag
Biographie des französischen Komponisten auf Englisch: https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Bondeville
29.10. Gustav Eduard ENGEL: 200. Geburtstag
Er kam bereits im Jahre 1824 nach Danzig, wo er ersten Unterricht im Klavier- und Orgelspiel durch Bauer erhielt. Seit 1834 lebte er in Berlin; er studierte an der dortigen Universität und erregte erstes Aufsehen, als er Solopartien in Konzerten übernahm. 1843 trat er der Berliner Singakademie bei und sang jetzt Soli in deren Konzertveranstaltungen. 1846 wurde er Tenorsolist des Berliner Domchores. 1847 promovierte er zum Doktor der Philosophie und wurde Lehrer am Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin. Er wirkte neben seinen Auftritten im Konzertsaal in der preußischen Hauptstadt als hoch angesehener Gesanglehrer (einer seiner Schüler war der Bassist Karl Gillmeister). Seit 1853 war er Berichterstatter der Berliner Zeitung, auch der Berliner Neuen musikalischen Zeitung, der Niederrheinischen Musikzeitung und seit 1860 der Preußischen Zeitung. Er veröffentlichte zahlreiche musikalische und musikpädagogische Schriften, darunter ein »Sänger-Brevier« (Leipzig, 1860). Er starb 1895 in Berlin.
30.10. Venceslao FUMI (italienischer Komponist): 200. Geburtstag
31.10. August EVERDING: 95. Geburtstag
Er kam mittels Notgeburt als Sohn eines katholischen Propsteiorganisten in Bottrop zur Welt. Er studierte in Bonn und in München Philosophie, Germanistik, Theologie und Theaterwissenschaft. An den Münchner Kammerspielen arbeitete er ab 1953 als Regieassistent. Schon 1955 wurde er Regisseur, 1959 Oberspielleiter, 1960 Schauspieldirektor und 1963 Intendant des Hauses. 1973 wechselte er als Intendant an die Hamburgische Staatsoper, 1977 an die Bayerische Staatsoper in München. Zugleich unterrichtete er als Professor an den Musikhochschulen in Hamburg (1973-77) und München. 1982 avancierte Everding zum Generalintendanten der Bayerischen Staatstheater. In dieser Position, die er bis 1993 innehatte, rief er das Bayerische Staatsballett und die Bayerischen Theatertage ins Leben. Ab 1993 führte er den Titel Staatsintendant. Als Präsident des Deutschen Bühnenvereins (DBV) organisierte Everding ab 1989 die Integration der Ex-DDR-Theater und -Orchester in das gesamtdeutsche Theatersystem. In zahlreichen Gremien kämpfte er gegen Subventionskürzungen und Theaterschließungen. Ein vielbeachteter Coup gelang ihm 1993 mit der Gründung der Bayerischen Theaterakademie, der er als Präsident vorstand. Seinen für München wohl größten Verdienst erwarb er sich durch seine Initiative für die Renovierung und Wiedereröffnung des Prinzregententheaters 1988 (sogen. Kleine Lösung ohne Hauptbühne), die schließlich in der kompletten Renovierung (inkl. Hauptbühne) am 10. November 1996 mündete. August Everding galt als eine der kulturpolitisch einflussreichen Theaterpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und als Workaholic. Er hatte in Münchener Theaterkreisen die (von ihm nicht geliebten) Spitznamen „Cleverding“ und „Everything“, die selbstredend sind. In den Medien warb er als versierter Redner und Diskussionspartner für die Sache der Kultur („Kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit!“) und erlangte einen hohen Bekanntheitsgrad. Ein Krebsleiden, das seine letzten Jahre überschattete, hielt er vor der Öffentlichkeit geheim. Noch wenige Tage vor seinem Tod im Jänner 1999 trat er bei einem Podiumsgespräch im Gartensaal des Prinzregententheaters auf. Er wurde in seiner Wahlheimat Truchtlaching im Chiemgau beigesetzt. Seit 1963 war Everding mit der Ärztin Dr. Gustava von Vogel, die sich für die Hospiz-Bewegung engagiert, verheiratet. Aus der Ehe gingen vier Söhne hervor: Christoph, Cornelius, Johannes und Marcus Everding. 1978-97 bewohnte er eine Dienstwohnung auf der Burg Grünwald, danach wohnte er in München-Schwabing.
August Everding begann seine Karriere als Schauspielregisseur. Geprägt wurde er von der Zusammenarbeit mit Hans Schweikart und Fritz Kortner. Später war er auf internationaler Ebene vor allem im Bereich der Oper tätig. Er inszenierte bei den Bayreuther Richard-Wagner-Festspielen (Der fliegende Holländer, Bühnenbild Josef Svoboda, Dirigent Silvio Varviso, 1969; Tristan und Isolde, Bühnenbild Josef Svoboda, Dirigent Carlos Kleiber, 1974), an der Wiener Staatsoper (Tristan und Isolde, Bühnenbild Günther Schneider-Siemssen, Dirigent Karl Böhm, 1967; Parsifal von Richard Wagner, Bühnenbild und Kostüme Jürgen Rose, Dirigent Horst Stein, 1979; Linda di Chamounix von Gaetano Donizetti, Bühnenbild Philippe Arlaud, Dirigent Bruno Campanella, 1997), dem Wiener Theater in der Josefstadt, der Pariser Opéra (Parsifal, Bühnenbild und Kostüme Jürgen Rose, Dirigent Horst Stein, 1973; Elektra von Richard Strauss, Bühnenbild und Kostüme Andrzej Majewski, Dirigent Karl Böhm, 1974; Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart, Bühnenbild und Kostüme Toni Businger, Dirigent Georg Solti, 1975), der Metropolitan Opera in New York (Tristan und Isolde, Bühnenbild Günther Schneider-Siemssen, Dirigent Erich Leinsdorf, 1971; Boris Godunow, Bühnenbild Ming Cho Lee, Dirigent Thomas Schippers 1974; Lohengrin, Bühnenbild Ming Cho Lee, Dirigent James Levine 1976; Chowanschtschina, Bühnenbild Ming Cho Lee, Dirigent Neme Järvi 1985; Der fliegende Holländer, Bühnenbild Hans Schavernoch, Dirigent James Levine 1989) oder an den Opernhäusern in San Francisco und Warschau. In der Inszenierung der Zauberflöte (1983) an der Staatsoper Unter den Linden baute Everding auf die Bühnenbilder Karl Friedrich Schinkels (1816).
31.10. Paul KÖTTER: 125. Geburtstag
Nach Ableistung des Kriegsdienstes im Ersten Weltkrieg begann er 1919 sein Gesangstudium bei Julius von Raatz- Brockmann in Berlin, der seinen ursprünglichen Bariton zum Tenor umschulte. 1928 debütierte er am Opernhaus von Essen als Walther von Stolzing in »Die Meistersinger von Nürnberg«. 1930 kam er an das Stadttheater (Opernhaus) von Hamburg. 1935 wurde er von dort an die Oper von Frankfurt a.M. engagiert, blieb jedoch durch einen Gastspielvertrag bis 1942 mit dem Hamburger Haus verbunden. Gastspiele ließen ihn international bekannt werden; so sang er an den Opernhäusern von Prag, Belgrad, Sofia, Genf und Antwerpen. Bei den Festspielen von Zoppot sang er 1934 den Walther von Stolzing in den »Meistersingern«, 1938-39 den Loge im »Rheingold«, an der Wiener Volksoper 1939 ebenfalls den Walther von Stolzing; er gastierte auch an der Dresdner Staatsoper, an den Staatsopern von München und Berlin, an der Städtischen Oper Berlin und bei den Maifestspielen von Wiesbaden. Seine eigentliche künstlerische Heimat blieb jedoch das Frankfurter Opernhaus, wo er u.a. in den Uraufführungen der Opern »Dr. Johannes Faust« von Hermann Reutter (22.5.1936), »Columbus« von Werner Egk (13.7.1942) und »Die Kluge« von Carl Orff (20.2.1943) mitwirkte. Er war bis 1945 an diesem Haus als Sänger tätig und übernahm dort nach dem Zweiten Weltkrieg in sehr verdienstvoller Weise die Publikums- und Personalbetreuung. Bis 1973 setzte er seine Tätigkeit am Opernhaus von Frankfurt a.M. fort (u.a. auch als Regisseur). Er starb 1974 in Frankfurt a.M. – Seine große, heldische Tenorstimme erreichte ihre besten Leistungen im Wagner-Fach und in Partien wie dem Radames in »Aida«, dem Turiddu in »Cavalleria rusticana«, dem Riccardo in Verdis »Maskenball«, dem Manrico im »Troubadour« und dem Kaiser in der »Frau ohne Schatten« von R. Strauss. Er übernahm zahlreiche Operettenrollen wie den Danilo in Lehárs »Die lustige Witwe«, den Goethe in »Friederike« von Lehár, den Jan in Millöckers »Der Bettelstudent«, den Amando in »Maske in Blau« von F. Raymond, den Herzog in »Eine Nacht in Venedig« von J. Strauß, im Bereich des Opernrepertoires auch den Königssohn in »Königskinder« von Humperdinck, den Fra Diavolo in der gleichnamigen Oper von Auber und den Hüon in »Oberon« von Weber.
Schallplattenaufnahmen auf Ultraphon (1929-30), Telefunken und Homeland.

