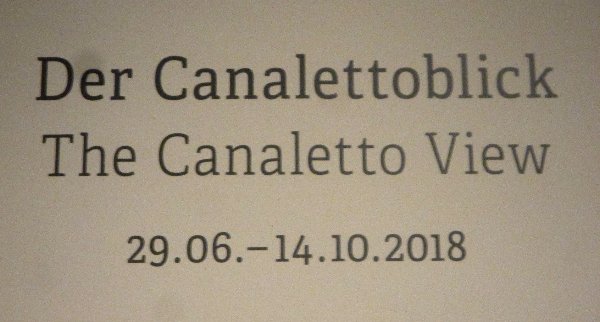
WIEN / Oberes Belvedere:
DER CANALETTOBLICK
Vom 29. Juni 2018 bis zum 14. Oktober 2018
Das gefährdete Ideal
Als Max Reinhardt 1924 die Josefstadt zum schönsten, „wienerischsten“ Theater der Stadt umbauen ließ, wählte er für den Eisernen Vorhang den „Canalettoblick“ – jenes legendäre Gemälde von Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, das dieser unter dem Titel „Wien vom Belvedere aus gesehen“ geschaffen hatte. Es ist das vielleicht berühmteste Bild, das in Bellottos kurzen Wiener Jahren entstanden ist – und wurde zur Ikone. Im Belvedere geht man dem „Canalettoblick“ vom 18. bis ins 21. Jahrhundert nach.
Von Heiner Wesemann
Bernardo Bellotto Geboren 1722 in Venedig, war er der Neffe des berühmten Antonio Canal (1697-1768), der zuerst unter dem Namen „Canaletto“ berühmt wurde. In dessen Werkstatt lernte er das „Veduten“-Handwerk. Er emanzipierte sich aber später – möglicherweise trug zur Verstimmung bei, dass auch Bellotto sich „Canaletto“ nannte. Doch während der Onkel seine Wirkungsgebiete in Italien und England fand, waren es für Bellotto-Canaletto vor allem Dresden und Warschau. Und, für eine kurze Periode, Wien. Von 1759 bis 1761 hielt er sich hier auf und schuf im Auftrag zuerst von Adeligen, dann des Hofes seine berühmten Wien-Bilder. Bellotto kehrte dann an den sächsischen Hof zurück und starb 1780 in Warschau.

Das Original fehlt leider Zweimal Schloß Schönbrunn, dreimal Schlosshof, dazu Ansichten der Freyung und anderer Wiener Plätze haben ebenfalls Ikonen-Status, aber „Wien vom Belvedere aus gesehen“ ist das berühmteste der Bilder, die in Bellottos Wiener Zeit entstandenen sind. Sie alle befinden sich im Besitz des Kunsthistorischen Museums. Es wäre zu hoffen gewesen, dass zumindest jener „Canalettoblick“, den das Belvedere nun dokumentiert, jener Blick, den man vom Belvedere selbst noch heute überprüfen kann (!), den Weg vom Burgring in die Prinz-Eugen-Straße geschafft hätte – so weit ist es schließlich nicht. Aber die Canalettos zählen zu jenen Bildern, die das KHM nicht verleihen darf, und so gab es keine Ausnahme. Das Belvedere hilft sich mit Videos sowie einer kleinen Kopie des Originals, in der die darauf abgebildeten Gebäude mit Nummern versehen und identifiziert werden. Dasselbe geschieht mit einer heutigen Fotografie, und schon damit kann man beweisen, wie Bellotto hier den „idealen“ Wien-Blick manipulierte und Gebäude malte, die man von diesem Standpunkt gar nicht sehen konnte.

Blicke auf die Stadt Die Ausstellung geht von Canaletto zurück zu Salomon Kleiner, der in seiner exakten Kupferstichmanier bereits 1731 sowohl die Gärten (und die beiden Schlösser) des Belvedere abbildete, desgleichen die daneben liegenden Gärten der Schwarzenbergs. Damit ist (wie auch durch Fotos und die Wirklichkeit) bewiesen, dass in dem „Zwickel“ zwischen der heutigen Prinz-Eugen-Straße und dem heutigen Rennweg der Anteil der Schwarzenbergs nie auch nur annähernd so groß war, wie Canaletto ihn gemalt hat. Diesen speziellen Blick auf die Stadt vom „Hügel“ des Oberen Belvedere hat Canaletto übrigens deshalb als Erster gewählt, meinte Kurator Markus Fellinger, weil diese fürstlichen Areale damals ja nicht öffentlich zugänglich waren: Man brauchte schon einen Auftrag, um dort malen zu dürfen.
Immer wieder Canaletto Der so genannte Canalettoblick (oder, besser „Canaletto-Blick“, möchte man meinen, der Begriff entstand früh) bedeutete für viele Künstler die Anregung, ihrerseits vom Oberen Belvedere auf die Gärten und die Stadt zu blicken. Dabei hat Canaletto die Sphinxe, die direkt vor dem Schloß stehen, bekanntlich ausgespart. Für andere Künstler, von Tina Blau bis Kolo Moser, waren gerade die offenbar von besonderem Reiz. Ein Maler, der das Belvedere (in der Canaletto-Perspektive, teils realistisch, aber auch gewissermaßen „kubistisch“) immer wieder umkreist hat, war Gerhard Frankl (1901-1965). Von ihm zeigt die Ausstellung mehrere Ansichten. Das Wien, das bei ihm hinter den Belvedere-Gärten zu sehen ist, schien dem aus der Emigration Heimgekehrten düster. Der Versuch, auch historische Fotos zum Thema zu finden, bringt auch originelle Ergebnisse – nach dem Krieg weideten Kühe auf den Wiesen des Belvederes.

Die Zerstörung des Blicks Es gibt übrigens einen aktuellen Aufhänger zum „historischen“ Thema: Ungeachtet aller politischen Turbulenzen und Widerstände (Zeitungen dokumentieren) hat die rot-grüne Stadtregierung die Neubebauung des Heumarkts bewilligt. Dabei ist eine Höhe der neuen Gebäude bis 66 Meter vorgesehen (derzeit hält man bei den 39 Metern Maximum des Hotels Intercontinental). Es wird Wien den UNESCO-Ehrentitel des „Weltkulturerbes“ kosten, aber offenbar sind die finanziellen Erwägungen dominierend. Dieses „Weltkulturerbe“ zeigt die Ausstellung in Gestalt eines Luftbildes der Inneren Stadt, wobei zu dem rot umrandeten Weltkulturerbe auch das Belvedere dazu gehört. Wie die Entwürfe von Isa Weinfeld und Stefan Murr sich im realen Blick auf Wien auswirken werden, ist durch Fotomontagen leicht zu versinnlichen. Dennoch will man, wie Direktorin Stella Rollig nachdrücklich versicherte, nicht in die Diskussion eingreifen. Immerhin, der zeitgemäße Aspekt für die Ausstellung ist gegeben. Im übrigen: Wenn die Diskussionen über die „Aufstockung“ des links von der Karlskirche (und neben dem Wien Museum gelegenen) Winterthurgebäude dann noch mehr hochkochen, kann man das ja auch ausstellungsmäßig dokumentieren: Ansichten von der Karlskirche gibt es genügend.
Oberes Belvedere: Der Canalettoblick
Bis 14. Oktober 2018
Täglich von 9 bis 18 Uhr, Freitag bis 21 Uhr

