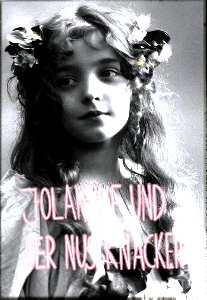
WIEN / Volksoper:
JOLANTHE UND DER NUSSKNACKER
Musiktheater nach der Oper und dem Ballett von Peter Iljitsch Tschaikowski
9.Oktober 2022
Der Abend an der Volksoper, mit dem sich Intendantin Lotte de Beer erstmals als Regisseurin an „ihrem“ Haus vorstellt, nennt sich „Jolanthe und der Nussknacker“ und wird charakterisiert als Musiktheater nach der Oper und dem Ballett von Peter Iljitsch Tschaikowski.
Der „Nussknacker“ wird den meisten Menschen schon einmal begegnet sein, rund um Weihnachten ist diesem Tschaikowski-Ballett kaum zu entkommen. Unter seinen Opern war „Jolanthe“ lange kaum bekannt, bis Anna Netrebko entdeckte, dass die Titelrolle viel Schönes zu singen hat und das Werk in ihr Repertoire aufnahm. Damals beherrschte sie noch dermaßen die Opernwelt, dass von der Metropolitan Opera bis Baden Baden viele Häuser das Werk ansetzten, außerdem ging sie damit auf Tournee. So brachte es die Geschichte der blinden Prinzessin zu einiger Popularität.
Der Haken an dem Werk: Es ist nur 100 Minuten lang, also nach allgemeinen Vorstellungen nicht abendfüllend (obwohl ähnliche Kürze bei „Salome“ und „Elektra“ noch niemanden gestört hat). „Iolanthe“ mit einem anderen „starken“ Werk zu koppeln, hat sich als nicht opportun erwiesen (die Met spielte dazu „Herzog Blaubarts Burg“). 1892 hat man in St. Petersburg danach den „Nussknacker“ gespielt, was offenbar zur Inspiration für Lotte de Beer wurde. Allerdings lässt sie (wie es der Haushofmeister in „Ariadne“ anordnet…) die Werke nicht hintereinander, sondern nebeneinander, also verschränkt spielen.
Die zugrunde liegende dramaturgische Idee besagt also, dass die blinde Jolanthe vor ihrem geistigen Auge immer wieder einzelne Szenen aus dem „Nussknacker“ sieht, wobei das Mädchen Clara quasi ihr Alter Ego ist und der Nussknacker-Prinz dann ganz ihrem Graf Vaudemont gleicht, der sie von ihrer Blindheit erlöst. Dieses Einfügen der „Nussknacker“-Szenen ist zwar nicht unbedingt zwingend, aber es hat immerhin doppelte Funktion – es macht den Abend „bunt“ und es macht ihn mehr oder weniger (wenn auch eher weniger) „kindergerecht“.

Fotos: Volksoper
Denn eigentlich ist die Geschichte von Jolanthe und ihrer Blindheit, von der sie nichts weiß, keinesfalls ein Kinderstück, kompliziert auch, wenn das Werk auf Deutsch gespielt wird, psychologisch vertrackt und auch inhaltlich so vielschichtig. Man kann zwar, wie es in der Volksoper geschieht, eine „fantasievoll ausgestattete Tanzoper über das Erwachsenwerden“ ankündigen, aber viele Kinder im Zuschauerraum (neben mir sowohl kleine wie Teenager) haben sich herzlich gelangweilt, weil sie abseits der „Nussknacker“-Szenen mit dem Ganzen nichts anzufangen wussten.
Die „Buntheit“ der Balletteinlagen, wo die Herrschaften des Staatsballetts dermaßen „verkleidet“ sind, dass sie nur als Masse, nicht als Individuen wirken, besticht durch die phantasievolle Kostüm-Opulenz (Jorine van Beek). Andrey Kaydanovskiy hat sehr hübsch und kindergerecht choreographiert und lockert die Inszenierung entscheidend auf. Hätte Lotte de Beer die Oper ohne weiteren Aufputz auf die Bühne gestellt, wo es nichts gibt als eine Schräge, ein paar klobige Sessel und einen dunklen Hintergrund (Bühnenbild: Katrin Lea Tag), das Werk wäre – hier noch in Alltagskostümen, die nichts charakterisieren – an Dürre eingegangen.

Zumal sich ja eine Geschichte ganz ohne Ambiente schwer erzählt. Erst gegen Ende spielen die getanzten Szenen mit der Verdoppelung der Figuren wirklich mit, ohne dass sich das Ganze tatsächlich logisch auflöste. Man hält sich also an die bunte Märchenwelt der (gar nicht so zahlreichen) „Nussknacker“-Szenen, um die „junge Volksoper“ zu behaupten.
Was die Besetzung betrifft, so wurde ein wenig mit Wasser gekocht, vor allem die Titelheldin war zwar als Erscheinung schlank und mädchenhaft und darstellerisch bemüht, aber Olesya Golovneva ließ durchgehend eine harte, metallische, so gut wie immer scharfe Stimme hören. Besser die Männer, vor allem der bewährte Stefan Cerny mit seinem schönen Baß als königlicher Vater, einigermaßen Georgy Vasiliev als tenoraler Liebhaber Graf Vaudemont, die Baritone Andrei Bondarenko und Szymon Komasa. Dennoch, ein Sängerfest ist es nicht geworden.
Im Orchester sah die Sache besser aus: Omer Meir Wellber, gemeinsam mit Lotte de Beer angetreten (hoffentlich lassen sich die beiden nie so hässlich „scheiden“ wie Jordan / Roscic), hatte das Problem, die beiden verschiedenen Partituren, die doch ganz verschiedene „Sprachen“ sprechen, zusammen zu fügen. Immerhin, beides ist Tschaikowski, und da bringt Wellber von durchsichtiger Transparenz bis zu fröhlichem Schwung und letztlich bombastischer Dramatik alles gleich überzeugend und klangschön auf einen Nenner.
Es war ein gewissermaßen sympathisch-ambitionierter Abend, für den sich die Regisseurin / Direktorin in Minikleid und High Heels vom Publikum feiern ließ. Sagen wir: eine gelungene Vorspeise. Man wartet auf Substanzreicheres.
Renate Wagner

