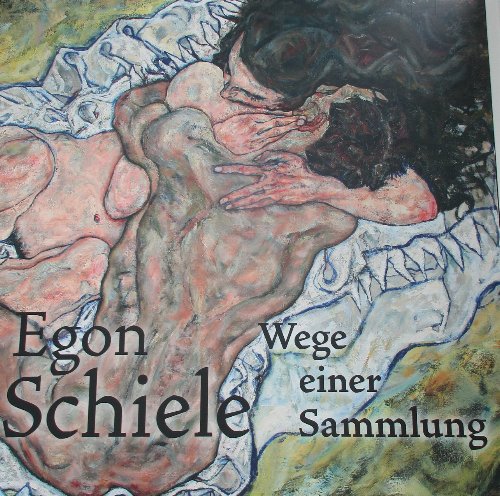
WIEN / Belvedere / Unteres Belvedere – Orangerie:
EGON SCHIELE – WEGE EINER SAMMLUNG
Vom 19. Oktober 2018 bis zum 17. Februar 2019
Was war, was ist
Die Schiele-Jubiläums-Schau des Leopold Museums arbeitet sich auf eine halbe Million Besucher zu, sensationelle 450.000 waren es schon. Die Frage, ob das für einen hundertesten Todestag nicht ausreicht und ob selbst eine durchaus ausstellungssüchtige Stadt wie Wien noch mehr Schiele verträgt, beantwortet das Belvedere: Einmal geht’s noch. Schließlich besitzt dieses Haus eine besondere Schiele-Tradition, die bis in die Lebzeiten des Künstlers zurückreicht. Und die eigenen Meisterwerke des Hauses rangieren in der A-Liga vor allem der Schiele-Gemälde. Was bedeutet, dass jeder Kunstfreund nun auch den Weg in das Untere Belvedere antreten wird, um in der Orangerie „Egon Schiele – Wege einer Sammlung“ zu betrachten.

Von Heiner Wesemann
Als man die „Moderne“ sammelte 1903 gründete man im angeblich so konservativen Österreich die in den Räumen des Belvedere beheimatete „Moderne Galerie“, deren erste Direktoren die damalige Moderne kannten, schätzten, kauften. Auch Egon Schiele. Er hat Franz Haberditzl, der nur zwei Jahre älter und seit 1915 der Direktor der nun so genannten „Staatsgalerie“ war, nicht in offiziellem Auftrag, sondern quasi „privat“ gemalt.

Das Gemälde, ein Meisterstück aus dem Jahre 1917, konnte erst in der Direktion von Gerbert Frodl 2003 (damals um 6 Millionen Euro, ein „Schnäppchen“) für das Haus erworben werden. Dergleichen Informationen sind es, die man aufarbeiten wollte, die Verbindungen von Menschen und Fakten aufzeigen. Und Leuten wie Haberditzl, der 1938 zwangspensioniert wurde, für ihre Arbeit ein Denkmal setzen. Denn angesichts der Künstler vergisst man auf die Direktoren.
Edith mit dem bunten Rock Das allererste Schiele-Gemälde, das Franz Haberditzl (über die Kunsthandlung Nebehay) erwarb, war 1918 das berühmte Gemälde von dessen Gattin Edith. Und hier – und nicht nur bei diesem Bild – kamen die digitalen Röntgenanlagen, die eigens für das Belvedere konstruiert wurden, zum Einsatz. Wie es das KHM derzeit mit Bruegel hält, wo die Naturwissenschaft vor der künstlerischen Interpretation rangiert, so hat man auch im Belvedere auf historische (sammlungsbezogene) und wissenschaftliche Erkenntnisse gesetzt. Dabei ergab es sich etwa bei dem Bild von Edith Schiele, dass der Künstler es übermalt und farblich neu gestaltet hat. Die Mühe, die alte Fassung per Computer herzustellen, bringt ein verblüffendes Ergebnis: Erst- und Letztfassung nebeneinander zeigen, wie „bunt“ Schiele die Gattin anfangs gedacht hat, in einer orangenfarbenen Jacke und einem bunt gewürfelten Rock. In der Endfassung sitzt sie „brav“ in Blau und Grau vor dem Betrachter… Das sind wirklich, wie Kuratorin Kerstin Jesse meinte, spannende Ergebnisse, wenn man auch zwar vieles, aber nicht alles recherchieren kann: War es der wohlwollende Freund Haberditzl, der Schiele dazu brachte, Edith „solidere“ Farben zuzuteilen?

Der „Reinerbub“ mit „e“ Ein berühmtes Porträt Schieles – auch weil er verhältnismäßig selten Kinder malte – galt dem so genannten „Rainerbub“ (den Rudolf Leopold übrigens gegen die „Wally“ eingetauscht hat), damals noch mit „ai“ geschrieben. Schiele malte den fünfjährigen Sohn eines bekannten Arztes 1910 als Auftragsarbeit und erzielte vor allem mit dem Gesicht- und der Augenpartie starke Wirkung.

Näheres über Herbert Reiner wusste man nicht, bis man sich für diese Ausstellung auf seine Spuren setzte. Er wurde Arzt wie der Vater, emigrierte in die USA, gründete eine Familie und blieb und starb 1978 in den Staaten. Seine Söhne konnten der Kuratorin manches über ihren Vater und Schiele erzählen.
Die „Wally“ kommt zu Besuch Man verbindet die „Wally“, Schieles Porträt seiner Geliebten Wally Neuzil, vor allem mit dem Leopold Museum, wo es – unter großer Beachtung von Seiten der Öffentlichkeit – 1998 in den USA als „Raubkunst“ zurückgehalten wurde. Das Leopold Museum konnte das Bild erst nach endlosem Rechtsstreit und nach hoher Zahlung endgültig ans Haus zurück holen. Davor allerdings gehörte es dem Belvedere und kam im Tausch 1954 an Rudolf Leopold (solche Tauschgeschäfte, die wohl mehr oder minder „unter der Hand“ erfolgten, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen – dabei ist die Schiele-Geschichte des Hauses voll davon). Im Zuge des Versuchs, „alle Schiele“, die sich einst hier befanden, zu zeigen, wurde die „Wally“ für diese Ausstellung „geliehen“. Dass alle Schiele-Zeichnungen, die man nach dem Ersten Weltkrieg in einer Neuordnung der Museumslandschaft an die Albertina abgab, hätten zurückkommen können, war ohnedies nicht möglich.

Eine Perlenreihe von Meisterwerken Schieles eigener Bronzekopf, den das Belvedere in einem Nachguß von 1980 besitzt, ist weit verbreitet. Nicht hingegen berühmte Hauptwerke, die sich im Besitz des Hauses befinden. Sie machen die Ausstellung, abgesehen von ihrem Dokumentationscharakter, dann wieder zum Schauerlebnis. Die Bildnisse von Eduard Kosmack und, wie erwähnt, Haberditzl sowie von Victor Bauer und Hugo Koller, dazu der „Russische Kriegsgefangene“ als Beispiel aus seiner Militärdienstzeit. Schieles „Sonnenblumen“, deren Verwandtschaft zu Van Gogh gar nicht geleugnet wird, seine „Hauswand“, die man auch als Abstraktion nehmen könnte, die magischen „Vier Bäume“, „Tod und Mädchen“, sicher als ein Höhepunkt seines Schaffens zu bezeichnen, desgleichen „Die Umarmung“, „Mutter mit zwei Kindern“ (in Vergleich zu Klimts gleichnamigem Gemälde gesetzt, wobei Klimt ausnahmsweise noch radikaler war), das „Kauernde Menschenpaar“. Das Belvedere hat immer wieder vergleichend Werke von Zeitgenossen in die Ausstellung gebracht, etwa von Hugo Kollers Gattin, Bronica Koller-Pinell, oder auch von Oppenheimer, Peschka, Faistauer, Kolig und natürlich Klimt u.v.a.
Unentbehrlich: der Katalog Es ist natürlich unmöglich, sich im Laufe eines Ausstellungsbesuchs (oder auch mehrerer) mit all den angebotenen Dokumenten zu befassen, viele handschriftlich, viele Briefe und Karten auch zu kleinteilig, um sie in den Vitrinen zu lesen. Der Katalog bildet sie alle ab, ebenso wie die Gemälde. Das Belvedere hat nicht nur Schiele, dem „Gottbegnadeten Künstler“, wie der Industrielle und Schiele-Bewunderer Carl Reininghaus ihn nannte, sondern auch sich selbst ein Denkmal gesetzt.
Belvedere / Unteres Belvedere / Orangerie:
EGON SCHIELE WEGE EINER SAMMLUNG
Bis 17. Februar 2019, täglich 10 bis 18 Uhr, Freitag bis 21 Uhr

