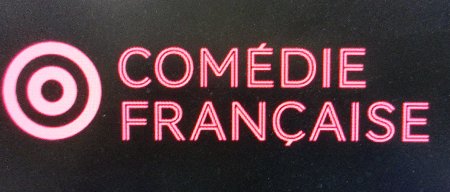
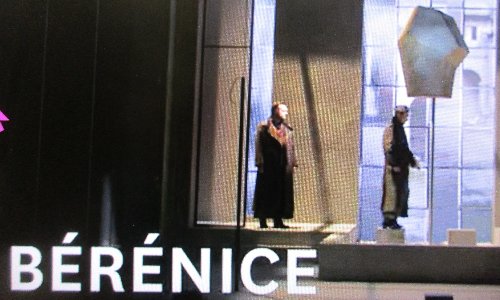
Fotos: Burgtheater
WIEN / Akademietheater / Comédie-Française;
BÉRÉNICE von Jean Racine
Eine Produktion der Comédie-Française.
entstanden am Théâtre du Vieux-Colombier (Paris) im März 2025.
Wiener Erstaufführung: 21. September 2025,
besucht wurde die zweite Vorstellung am 22. September 2025,
Eine stille Tragödie
Corneille, Racine, Molière, das ist das Dreigestirn französischer Bühnen-Klassik aus dem 17. Jahrhundert. Corneille, hoch und hehr, dessen Werke sich außerhalb Frankreichs kaum noch auf den Spielplänen finden, Racine, der große Psychologe (besonders in seinen Frauenfiguren), von dem hierzulande meist seine „Phädra“ gespielt wird (Stiefmutter liebt Stiefsohn, das ist dramatisch und kann nicht gut ausgehen) – und schließlich Molière, der König der Komödie, ohne den auch unsere Bühnen wahrscheinlich nicht existieren könnten…
Die Comédie-Française in Paris, aus derselben Zeit stammend wie die drei Dichter, ist derzeit mit einem „Kammerstück“ auf Tournee und zog für zwei Vorstellungen im Wiener Akademietheater ein, Die „Bérénice“ des Racine ist eines der vielen Römerdramen der Epoche, denn seitdem die Renaissance die Antike wieder entdeckt hatte, schöpfte man in der Geschichte und Kultur dieser Epoche. Kaiser Titus gibt es vielfach auf der Bühne (man denke nur an Mozart), aber in Racines Stück geht es auch um die Titelheldin Berenice. Diese Königin Berenike war wohl Jüdin, herrschte über das Gebiet von Palästina und lernte Titus kennen, als dieser von seinem Vater, Kaiser Vespasian, ausgeschickt wurde, im Nahen Osten, vor allem in den jüdischen Gebieten, wo man sich gegen Rom erhoben hatte, Ruhe zu schaffen (damals kam es zur Tragödie von Massada…). Berenike stand auf Seiten der Römer, desgleichen Antiochus von Kommagene. Die große Liebe zwischen Titus und Berenike ist historisch verbürgt, ob Antiochus sich da in ein Liebesdreieck fand, das Racine schildert, hingegen nicht.
Das Stück spielt zu dem Zeitpunkt, als Vespasian starb und Titus ihm als Kaiser nachfolgte. Die Idee, Berenike zu heiraten, die damals schon jahrelang mit ihm in Rom lebte, war damit erledigt, denn die Römer duldeten kein „fremdes Blut“ (was schon Cleopatra und ihr Sohn von Caesar erfahren hatten…).
Die Königin, die in der Dichtung ehrlich und leidenschaftlich, absichtslos und ohne Ehrgeiz liebt, muss begreifen, dass sie aus politischen Gründen weggeschickt wird, dass Liebe nicht über Politik siegt. Aber im Gegensatz zu anderen Heldinnen, die in Verzweiflungskrämpfe ausbrechen würden, sich selbst oder auch andere mordend, findet diese Racine’sche Bérénice ihre Würde, reist ab und lässt zwei gebrochene Männer zurück – denn sowohl Titus wie Antiochus lieben sie leidenschaftlich. Und künftig vergeblich.
Gut, wenn man vor dem Besuch des Wiener Gastspiels ein wenig in den französischen Kritiken geschmökert hat, dann war man nämlich vorbereitet auf das, was die unendlich spartanische Inszenierung des flandrischen Regisseurs Guy Cassiers besonders macht: Er hat die beiden durchaus entgegen gesetzten Protagonisten Titus und Antiochus mit ein- und demselben Darsteller besetzt. Optisch kennt man sie nur auseinander, weil Jérémy Lopez als Antiochus einen langen Mantel trägt, als Titus einfach eine Anzugsjacke von heute. Wenn beide eine gemeinsame Szene haben, kommt die Antwort des anderen vom Tonband…

Man fragt sich vor allem deshalb, was die Vereinheitlichung der beiden gegensätzlichen Männer bringen soll – Titus, zwar liebend, aber letztlich doch der Politiker, der nicht wegen einer Frau auf die Kaiserwürde verzichtet, Antiochus ganz Hingabe, sowohl an die geliebte Frau wie an den Kaiser-Freund. Jeder Schauspieler, der auf sich hält, wäre imstande, zwei Charaktere so zu differenzieren, dass man sie sofort unterscheiden kann. Aber hier ging es Regisseur Guy Cassiers offensichtlich darum, dass beide zwei Seiten einer Medaille sind – Lopez unterscheidet nicht einmal in der Sprache, auch nicht im Habitus. Immer nur herzzerreißende Seelenschmerzen. Zwei Weicheier, wenn man es brutal ausdrücken wollte.
Überhaupt, die Sprache. Da war man natürlich neugierig. So, wie man die Engländer beneidet, weil sie Shakespeare sprechen können, ohne die Ebene einer Übersetzung einziehen zu müssen, wollte man wissen, was eine Aufführung der Comédie-Française von heute mit den originalen gereimten Alexandrinern (die so schwer zu übersetzen sind!) anfangen würde. Kurz gesagt – gar nichts. Man sprich darüber hinweg, dass man kaum je den Rhythmus oder je einen Reim bemerkt. Gesprochen wird in einem geradezu beiläufigen Alltags-Parlando-Ton, nur um kein Pathos aufkommen zu lassen, Hochdramatisches verhandelt man leise, um nicht „gestrig“ zu sein Wie auch alles andere, von den Kostümen (Anna Rizza) bis zu der unkenntlich modernistischen Bühne (von Guy Cassiers selbst und Bram Delafonteyne) ziemlich gesichtslos modern ist.
Trotz der Irritation durch die Doppelbesetzung der Helden funktioniert der Abend erstaunlich gut, auch dank der Hauptdarstellerin Suliane Brahim, einem Inbegriff von Schönheit, Eleganz und Seelentiefe, die nie kitschig auf die Bühne geklatscht wird. Auch in tiefster Erregung und Beleidigung, auch in intensiver Argumentation mit Titus, verliert sie nie ihre Würde. Sie geht als Siegerin vom Feld, wo sie in Claude Mathieu eine unauffällige Vertraute hat, während Alexandre Pavloff den beiden Vertrauten, sowohl von Titus wie Antiochus, Intensität gibt.
Das Publikum folgte den pausenlosen 110 Minuten mit höchster Spannung, sozusagen mucksmäuschenstill, und feierte die Gäste am Ende, so wie sie es verdienten.
Renate Wagner

