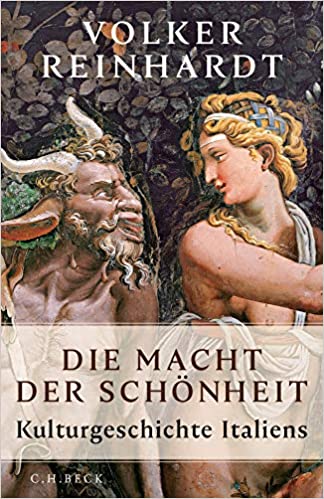
Volker Reinhardt
DIE MACHT DER SCHÖNHEIT
KULTURGESCHICHTE ITALIENS
656 Seiten, mit 110 Abbildungen, davon 50 in Farbe, und 5 Karten. Verlag C.H.Beck, 2019
„Italien“ gab es politisch als „Land“ vor dem Ende des 19. Jahrhunderts ebenso wenig wie „Deutschland“. Trotzdem war „Italien“ ein übergreifender, gewissermaßen „kultureller“ Begriff, wie Volker Reinhardt in „Die Macht der Schönheit“ gleich zu Beginn feststellt, dem Buch, in welchem er sich eine „Kulturgeschichte Italiens“ vorgenommen hat. Und wer vieles und dieses auch noch genau wissen will, hat hier sein Werk gefunden, mit dem er sich viele, viele Stunden und Tage abgeben kann (will, muss).
Der Autor, Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg, hat seine hohe Italien-Kompetenz schon in einer beachtlichen Anzahl von Büchern unter Beweis gestellt, über die Päpste und das barocke Rom, über Leonardo und Michelangelo, über Machiavelli und die Borgia und zahlreiche Abrisse italienischer Geschichte.
Es gibt so viele Aspekte zu diesem Thema. „Italianità“ – das ist die Lust an den bildenden Künsten, große Literatur, schwelgerische Hingabe an die Musik (von Monteverdi bis Verdi), Kleidungsluxus, Bauwahnsinn, sinnliche Freuden, wie sie kulinarisch geboten werden (tatsächlich gibt es auch ein eigenes Kapitel über Kochbücher und Bankette, aber es wird der Hunger auch nicht vergessen), Wissenschaft, aber auch Alchemie – das Spektrum ist weit, und der Autor betrachtet es in seiner ganzen Vielfalt.
Auch das Land ist zwar nicht übergroß, zieht sich aber lange dahin in vielen Regionen, der Norden unterscheidet sich von Sizilien, Rom und Neapel sind ohnedies anders – und die anderen großen Städte mit ihrer großen Geschichte auch (von Florenz bis Venedig, Pisa bis Bologna, Genua bis Verona, Padua bis Mantua und noch viele). Was auch mit der Verschiedenheit von Geschichte und Einflüssen zu tun hat – die Deutschen und Österreicher, die in den Norden Italiens drängten, die Araber und die Normannen, die nach Sizilien kamen, die Spanier und Franzosen, die sich in italienischen Landen unerwünscht als Herrscher etablierten.
Die Erkenntnis gehört zum Thema, dass Kunst mit Macht und Geld Hand in Hand geht, daran hat sich im Grunde (soweit es nicht um „Alternatives“ geht) bis heute nichts geändert. Städte, Fürsten und Päpste sind die Institutionen, auf deren Spuren man sich setzen muss, will man die Schönheit der Kunst erfassen, diese aber gleichzeitig im Konnex mit der Geschichte sehen. Und da sind Dauerkämpfe rücksichtslosester Art kein Vergnügen – immer wieder jeder gegen jeden, mächtige Fürsten permanent zu Auseinandersetzungen bereit. Immer wieder ging es auch um den Stolz der Einzelnen, sich selbst durch das Mittel der Kunst, die jedes Menschenleben überlebt, in die Ewigkeit einzuschreiben.
In diesem Zusammenhang muss man auf die Bildteile verweisen bzw. darüber hinaus auf deren erläuternde Texte. Nach dem Motto „Man sieht nur, was man weiß“ wird man auf den Subtext der Werke, die sich konkret auf Menschen und Taten ihrer Zeit beziehen, verwiesen. Als Beispiel kann man gleich das erste Kapitel nehmen, Palermo im 11. Jahrhundert, die Normannen in Sizilien. Wenn König Roger II sich in einem Mosaik allein mit Christus darstellen ließ, der ihn – unter gänzlichem Verzicht auf den Papst – zum König von Sizilien krönt, dann spiegelt das die selbstbewusste Macht des Normannenherrschers (und seine Auseinandersetzungen mit den Päpsten). Und das Bild dazu ist gleich im ersten Farbteil des Buches zu betrachten, eine deutlichere Illustration des Geschilderten kann es nicht geben. Sähe man das Mosaik allerdings, ohne seinen historischen Hintergrund zu kennen, wäre es nur kunsthistorisch und nicht auch historisch relevant.
Man unternimmt mit dem Autor einen Spaziergang durch die Jahrhunderte, durch tausend Jahre mehr oder minder, vom 11. Jahrhundert bis ins 21,, wo der Autor den Bogen seines Blicks auf Italien und seinen Kunstwillen wieder in Sizilien beschließt, mit Lampedusas „Leopard“ und was er im Hinblick auf das historische Verständnis des Landes bedeutet. Dann ist man allerdings schon mit Themen in der Gegenwart, die zeigen, dass Reinhardt auch Fußball, Mode und Film zur großen Kultur des Landes zählt, und dass er nicht nur die futuristische Avantgarde behandelt, sondern auch den Faschismus, den mancher vielleicht als unbequem ausklammern würde.
In sechs großen Kapiteln, die sich dann wiederum in knapp 70 Einzelartikel aufspalten, wandert man unter verschiedenen Aspekten chronologisch durch die Geschichte. Jedes Kapitel umfasst ca. 10 Seiten und ist nach beliebigen Gesichtspunkten gestaltet: Im Zentrum mag eine Stadt, ein Bauwerk, ein historisches Ereignis stehen, immer wieder auch ein Mensch – nicht nur bedeutende Männer, sondern auch eine so seltsame, aber bedeutende Heilige wie die Färberstochter Caterina von Siena, die lange nicht einmal lesen und schreiben konnte, aber zu einer bedeutenden religiösen Persönlichkeit ihrer Zeit wurde (Mitte des 14. Jahrhunderts, als das Papsttum zwischen Rom und Avignon gespalten war): Ihr gelang es tatsächlich, den Papst nach Rom zurück zu holen, während man die französischen Kardinäle in die zweite Reihe verwies: Italien sei als Erbin der Antike die überlegene Nation…
Tatsächlich muss man das Buch nicht chronologisch lesen, obwohl auch das seinen Vorteil hat. Aber wenn man plötzlich Lust auf Machiavelli oder Galileo Galilei verspürt, wenn man einfach nur Artikel zum Thema Musik lesen will (es gibt eine Menge) oder auch über bedeutende Schriftsteller – auch das ist möglich. Zusammen genommen ergibt das Buch am Ende ein glitzerndes Mosaik in allen Farben, zwischen menschlichen Abgründen und künstlerischen Höhenflügen. Als Kaleidoskop des Wissens, als Sammlung der lebenslangen Beschäftigung des Autors mit dem Thema, wird jeder Leser, sich dafür interessiert, reich beschenkt.
Renate Wagner

