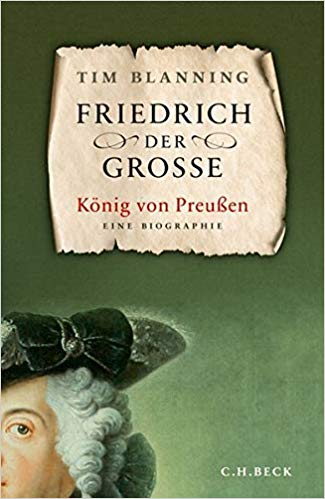
Tim Blanning:
FRIEDRICH DER GROSSE
König von Preußen
Eine Biographie
718 Seiten, Verlag C.H.Beck, 2019
Dass zur Glorifizierung von Friedrich II. von Preußen, dem „Großen“, dem liebevoll stilisierten „alten Fritz“ früherer Zeiten, heutzutage kein Anlass mehr besteht, hat sich herausgestellt, ist in mancher Biographie auch schon klar herausgearbeitet worden: ein Mann, der aus Ruhmsucht Angriffskriege geführt hat (nicht ohne Mühe zu Präventivschlägen rationalisiert), was umso schwerer wiegt, als er als intelligenter, aufgeklärter Kopf sehr wohl wusste, welches Elend er damit für die Bevölkerung seines Landes (und der anderen) verursachte…
Eine neue Biographie von Friedrich II. (1712-1786), von keinerlei rundem „Jubiläum“ gestützt, bezieht ihr Interesse daraus, dass der Autor Engländer ist. Der Blick „von außen“ hat schon manchen neuen Aspekt geliefert – kann er es in einem durch Sekundärliteratur und Zeitzeugnissen so „ausgereizten“ Thema auch?
Tim Blanning war Professor für Neuere europäische Geschichte an der Universität Cambridge, und das Europa des 17. bis 19. Jahrhunderts gilt als sein Fachgebiet. Eingebettet in eine Epoche der höchsten Turbulenzen in Europa, der dauernd wechselnden Bündnisse der Mächte, in die Friedrich Preußen rücksichtslos hineindrängte, ist die Frage, welche Motivationen Blanning dem König zugesteht.
Um eine Jugend, wie man sie sich fürchterlicher nicht vorstellen kann, kommt bei der Schilderung dieser Biographie niemand herum. Friedrich, der älteste Sohn von König Friedrich Wilhelm I. (dessen Motto war, ein König dürfe alles), mehr noch als die Geschwister mit körperlicher Gewalt und Psychoterror konfrontiert, schließlich der Androhung der eigenen Hinrichtung ausgesetzt und dem Zwang, der Hinrichtung des Freundes, der vielleicht ein Geliebter war, zuzusehen – man hat es oft gelesen, niemand nimmt es leicht. Man wundert sich eher, dass jemand dergleichen überstehen konnte. Und welche Art von Mensch, von Charakter daraus erwachsen würde – oder musste?
Für Tim Blanning ist ein Thema unumwunden wichtig, das deutsche Historiker nicht so gerne ins Zentrum stellen: Friedrichs Homosexualität. Sie kann kaum bezweifelt werden, gänzlich konkrete Beweise gibt es nicht. Doch nimmt der Autor das Jahr 1740 als doppeltes „Outing“ seiner Persönlichkeit: Nach dem Tod des Vaters, endlich selbst König, verlor der 28jährige keine Zeit, die aufgezwungene, ungeliebte Gattin aufs Nebengeleis zu schieben und ihr nie wieder einen Platz in seinem Leben einzuräumen. Dass er seinen künstlerischen Interessen – vor allem Musik (von Blanning besonders ausführlich geschildert), Literatur und Philosophie inmitten eines gepflegten, ausschließlich männlichen „Musenhofs“ nachging, wo es für Favoriten (Friedrich umgab sich nur mit Männern, die von ihm abhängig waren) reiche Geschenke und liebevolle Briefe gab, ist dem Autor Argument genug (und niemand wird ihm da widersprechen). Zweifellos hätte sein Vater, Friedrich Wilhelm I., die Freundschafts-Kulte, die Friedrich hier pflegte, als „sodomistisch“ bezeichnet…
Gleichzeitig mit dem Friedrich, der sich seinen geistigen und wohl auch sexuellen Passionen hingab, erwachte jene janusköpfige Persönlichkeit, die in einer hagiographischen deutschen Geschichtsschreibung bis nach dem Zweiten Weltkrieg meist einseitig als der große, gute König dargestellt wurde, „erster Diener“ seines Volkes, der aufgeklärte Herrscher, der alles zum Ruhme Preußens tat.
Alles davon stimmt teilweise – aber eben nur teilweise. Der aufgeklärte König, der einen „Antimachiavel“ schrieb, handelte im höchsten Grade machiavellistisch, als er 1840 auf der Stelle auszog, einer von ihm für schwach erachteten jungen Herrscherin, Maria Theresia, Schlesien abzujagen – weil er es konnte, weil er aus einer Situation der Schwäche der andern skrupellos seinen Vorteil zog (und das auch zugab). Schließlich konnte er (von seinem Standpunkt nicht unrichtig) dieses reiche Land Schlesien zur Ergänzung seines eher armen, zersplitterten Preußens gut brauchen.
Friedrich kannte den Unterschied zwischen Theorie und Praxis, zwischen Moral und dem, was ihm politische Notwendigkeit erschien. Er hat alle seine Kriege nach diesen Prämissen geführt. Und sich dabei immer an die Spitze seiner Truppen gestellt, was ihn (trotz vieler Niederlagen) als Kriegsherrn so effektiv machte. (Wobei er mehr als einmal am Rande des Abgrunds stand und nur durch Glücksfälle buchstäblich gerettet wurde – etwa der Tod von Zarin Elisabeth, die Bewunderung, die ihr Nachfolger für ihn hegte, der den Krieg mit Preußen sofort beendete). Und was den Ruhm betraf, so ist Blanning sich mit anderen Biographen einig: Es ging nur um den Ruhm Friedrichs. Ganz persönlich. Mit dem Schielen auf die großen Persönlichkeiten der Antike, die ihn seit seiner Jugend so beeindruckt hatten.
Diese Biographie, die dem König als Menschen so dicht auf den Fersen bleibt wie wenige, interpretiert den Mann aus einem gewaltigen Ego heraus – und das Ergebnis ist nicht das, was man als „sympathisch“ erachten könnte. Aber wann wären das Herrscher je gewesen?
Dass er, wenn er nicht Kriege führte, ein geradezu manisch kontrollsüchtiger Verwalter seines Reiches war, der niemand anderem zutraute, es richtig zu machen, steht auf dieser Liste. Man kann es natürlich auch „positiv“ formulieren, was Blanning auch tut: Er habe „die Tugend der Pflichterfüllung gepredigt und auch praktiziert“. Doch ist es immer angebracht, Dinge dialektisch zu betrachten.
Dass Friedrich sich seiner Familie gegenüber – seiner Frau, aber auch seinen Geschwistern (man nehme Lieblingsschwester Wilhelmine aus, ebenso seine respektierte Mutter) – so bösartig und diktatorisch verhielt, wie es sein Vater ihm gegenüber getan hatte, ist bezeugt (so zwang er seinen offen homosexuellen Bruder Heinrich in eine Ehe). Immerhin sparte er die körperliche Gewalt aus, unter der er selbst so zu leiden gehabt hatte.
Dass seine „Freundschaften“ nie hielten, zumal jene mit Voltaire, lag in diesem Fall an beiderseitiger Boshaftigkeit und Kleinlichkeit. Dass er von seinen Ministern und Generalen weit mehr gefürchtet wurde (mehr als die feindliche Kugel, wie es hieß) denn respektiert, ist belegbar bei einem Mann, der berüchtigt dafür war, keinen Widerspruch zu dulden. Dass er seine Ideale beiseite ließ – die Idee, die Leibeigenschaft aufzuheben, wurde nicht ausgeführt, um den Adel nicht zu verärgern -, wenn es um „höhere“ Interessen ging, ist immer wieder nachzuvollziehen. Er hat, wo er auf einen Zwiespalt stieß, diesen immer offen formuliert („Sicherlich ist kein Mensch geboren, der Sklave von seinesgleichen zu sein“) – und sich doch in die Notwendigkeiten gefügt.
Entscheidend für seinen Charakter ist auch bewusst „machiavellistisches“ Verhalten: Ein Mann, der gelernt hatte, sich in seiner Kindheit zu ducken und zu verstellen, um unter seinem Vater überleben zu können, hat diese Kunst der Täuschung in der Politik bis zur Meisterschaft betrieben – er wollte seinen Feinden, aber auch seinen Verbündeten ein Rätsel sein, ein Mann, von dem man nie wusste, was man von ihm zu halten und was man von ihm zu befürchten hatte. Eine, wie sich zeigte, sehr effektive Methode im europäischen „Konzert“ zwischen Habsburg und Russland, Frankreich, England, Schweden, Sachsen und anderen Mächten die Stimme zu erheben, wenn man anfangs auch nur ein zersplittertes kleines Land im Norden Europas war… Bei Friedrichs Tod war Preußen eine Macht.
Blanning führt auch genau aus, dass es mit Friedrichs Intellektualität wohl nicht so weit her war – belesen und interessiert, hatte er nie die Zeit, in die Tiefe zu gehen. Als Flötenspieler perfekter denn als Dichter, schrieb er zahllose Werke (auf Französisch), deren Beispiele ihn doch als eher dilettantisch kennzeichnen. Voltaire war ja auch zum „Korrigieren“ seiner Dichtungen angestellt. Und dass der deutscheste aller Könige, der die deutsche Literatur verachtete und Goethe attackierte, seine eigene Sprache nur höchst unzureichend schrieb, dafür gibt es einige Beispiele…
Blannings Buch ist so reich (und umfangreich), weil er versucht, schier alles zu behandeln, was zum Thema anfällt – Friedrichs speziellen Antisemitismus etwa (keine Verfolgung, aber dafür sorgen, dass es nicht zu viele Juden in seinem Land gibt) oder sein Zynismus der Religion gegenüber, seine Lust am Bauen (wobei sein Geschmack altmodisch war) und die Liebe zu Hunden, Großes, Kleines, Wichtiges, Unwichtiges, man findet es hier.
Und allein die Tatsache, dass es so viel und auch so Widersprüchliches über Friedrich zu berichten gibt, zeugt vom Reichtum des inneren und äußeren Lebens. Wie man ihm gegenübersteht, ist Sache des Lesers. Der Autor hat sich entschieden – skeptisch, aber nicht grundlegend negativ, kritisch, aber nicht herabwürdigend. Britisch fair, könnte man sagen.
Renate Wagner

