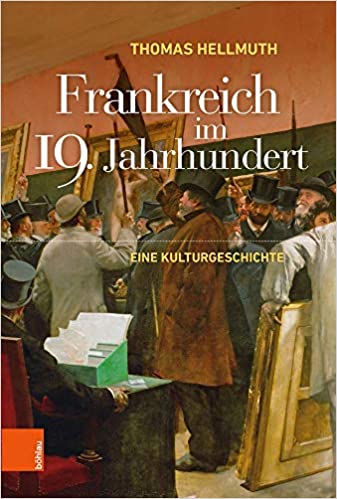
Thomas Hellmuth
FRANKREICH IM 19. JAHRHUNDERT
Eine Kulturgeschichte
382 Seiten, Böhlau Verlag, 2020
Gar so schön war es nicht, dieses 19. Jahrhundert, in das sich Menschen des frühen 20. oft zurück sehnten. Das ist der Grundtenor des Buches, das Thomas Hellmuth, seines Zeichens Professor am Institut für Geschichte der Universität Wien, Spezialgebiet: Geschichtsdidaktik, über das Frankreich des 19. Jahrhunderts geschrieben hat.
An sich ein Thema, das den Sachbuchleser reizt – die Nation nach der Französischen Revolution, die Napoleonischen Jahre, weitere Umstürze und Regierungswechsel bis zum Zweiten Kaiserreich von Napoleon III., bis die Franzoschen wieder zur Republik zurück kehrten. Belle Epoque, die explodierenden Künste, die Boheme, Offenbach, Toulouse-Lautrec, Sarah Bernhardt, die Moderne, daneben Dreyfus, Kriege, la Grande Nation…
Tatsächlich findet man das alles in dem Buch, allerdings nicht linear erzählt, sondern komplex verschachtelt. Der Autor, der sich für Grundsatzfragen wie Nationalismus oder Antisemitismus interessiert, sieht keinen „geraden“ Weg in die Geschichte und ihre Zusammenhänge, und er glaubt auch (zu Recht wohl) nicht an eine positive Entwicklung einer bürgerlichen Gesellschaft.
Auch weiß er, dass Historiker die Quellen nach Gutdünken interpretieren können, vor allem, wenn nationale Interessen dahinter stehen. Zudem ist der „Kultur“-Begriff in der „Kulturgeschichte“ nicht auf die Künste beschränkt, sondern nur in deren Verstrickung mit gesellschaftlichen Phänomenen zu begreifen.
„Um die Komplexität von Gesellschaft wenigstens annähernd zu erfassen“, schreibt der Autor, „müssen die Ebenen der Makro- und Mikrogeschichte miteinander in Verbindung gesetzt werden.“ Er findet für seine Methode die Bezeichnung der „vertikalen“ Perspektive, als würde man in einem Haus immer von einem Stockwerk zum anderen gehen, statt Dinge isoliert zu betrachten – so verknüpfen sich Wirtschaft, Politik und Kultur, statt jeweils für sich da zu stehen.
Indem der Autor ununterbrochen Türen in neue Räume öffnet, macht er es dem Leser nicht leicht, kommt aber in seiner Betrachtung von Widersprüchen und Dissonanzen immer wieder auf neue Bezüge. Dass sein „kulturgeschichtliches Referenzsystem“ nicht gefällig ist, sagt er selbst, und dass das „bürgerliche Zeitalter“ bei ihm nicht gut wegkommt, auch.
Vor allem ist es wohl die Arbeit eines Wissenschaftlers, die sich am ehesten an seine Kollegen wendet und wohl in Fach-Symposien diskutiert werden will. Das „normale“ Fachbuchpublikum, das Sachverhalte übersichtlich, verständlich und umweglos lesbar angeboten bekommen möchte, wird hier nicht befriedigt. Ein schwieriges Thema wird hier schwierig aufbereitet. Aber auch die strenge Wissenschaft muss schließlich ihren Platz zwischen Buchdeckeln finden können, nicht nur die leicht gemachte Lektüre.
Renate Wagner

