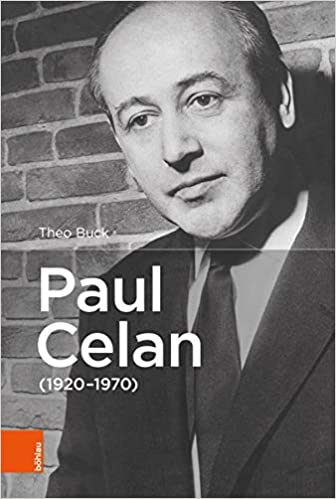
Theo Buck
PAUL CELAN
(1920-1870)
256 Seiten, Verlag Böhlau, 2020
Es gibt Einzelausgaben seiner Werke, es gibt spezifische Studien zu seinen Gedichten, es gibt – für Österreicher besonders interessant – seinen Briefwechsel mit Ingeborg Bachmann. Aber die Biographie für Paul Celan hat noch gefehlt. Anlässlich seines 100. Geburtstags am 23. November 1920 sind einige vorgesehen. Theo Buck (1930-2019), einer der großen Celan-Kenner, konnte die Biographie vor seinem eigenen Tod noch vollenden. Sie versucht, das – zugegeben – schwierig zugängliche Werk des Künstlers durch die Verbindung mit biographischen Fakten zu erhellen.
Entscheidend für Paul Celan war sein ganzes Leben hindurch die Tatsache, dass er Jude war – ein Jude aus der Bukowina, der viele Sprachen sprach, aber nur auf Deutsch schreiben konnte. Allerdings war jüdisch zu sein in Czernowitz, der Stadt seiner Geburt und Jugend, gewissermaßen nicht so schlimm – hier, im kultivierten „Klein Wien“ des Ostens, lebte noch von der Monarchie her eine dominierende großbürgerliche, gebildete Schicht von Juden, zu denen auch die Familie Antschel gehörte: Den Namen Celan nahm Paul später auf Rat eines Verlegers an, der ihn (wohl zurecht) für besser vermarktbar hielt als „Antschel“.
Es waren durchaus glückliche Jugendjahre, die Paul in Czernowitz verlebte, ein brillanter Schüler, von der Mutter auf Literatur gepolt. Das strenge Judentum des Vaters färbte auf ihn nicht ab, der sich später als religiös indifferent bezeichnete, aber er lernte Hebräisch. Im Laufe der Jahre, als die Geschichte so sehr in sein Leben eingriff, kamen noch Französisch (das er sprach wie ein gebürtiger Franzose), Rumänisch und Russisch dazu. Schon in seinen Jugendjahren begann Celan, Gedichte zu schreiben. Dennoch ging er 1938 nach Paris, um Medizin zu studieren, brachte es aber nur zu Vorbereitungskursen.
Czernowitz wurde im Verlauf des Zweiten Weltkriegs rumänisch, wurde russisch, gefährlich wurde es erst, als die deutsche Armee eintraf. Paul kam eines Tages heim und seine Eltern waren abtransportiert worden. Er sah sie nie wieder (und hier ist der Biograph erstaunlich wortkarg über dieses elementare Ereignis eines Lebens).
Als Jude kam Celan in ein Arbeitslager, und nun hatte ihn das jüdische Schicksal voll eingeholt, so dass er es nie wieder aus seinem Bewusstsein verdrängen konnte – in keiner anderen Station seines Lebens. Nicht in Bukarest, wo er im Freundeskreis unterkam und dichtete, darunter jenes Werk, das ihn berühmt, weltberühmt gemacht hat – die „Todesfuge“, die mit dem unvergleichlichen Bild „Schwarze Milch der Frühe“ beginnt, die er selbst wahrlich täglich trank, und die vor allem den Deutschen unvergesslich ins Bewusstsein einprägte: „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“.
Nicht in Wien, wo er schnell in literarische Kreise kam, von Otto Basil und Hans Weigel gefördert und auch publiziert wurde – und wo er Ingeborg Bachmann kennen lernte, eine lebenslange, verzweifelte Beziehung zweier Künstler, die sich liebten und es nicht miteinander aushielten.
Und Celans Wahn, überall Antisemitismus zu sehen, wich auch nicht in Paris, wo er mit vielen Reise-Unterbrechungen bis zu seinem Ende lebte. Zwei tragische Einschnitte seiner Existenz, die Celan nie verwunden hat, schildert der Autor ausführlich: Als er 1952 bei einem Treffen der Gruppe 47 las – und für seine „Todesfuge“ wegen des Pathos, mit dem er sie vertrug (man verglich ihn mit Goebbels!) ausgelacht wurde. Auch hatte man für sein Meisterwerk in nüchternen Zeiten nur Skepsis übrig, unterstellte ihm Berechnung… Die zweite Katastrophe seines Lebens begab sich, als er das Ehepaar Ivan und Claire Goll kennen lernte. Was wie eine schöne Freundschaft aussah, wandelte sich nach Golls Tod in eine Affäre, die von der Presse freudig (und, wie Celan meinte, mit antisemitischem Gusto) aufgenommen wurde: Claire Goll beschuldigte ihn, Golls Gedichte gänzlich unzulänglich übersetzt zu haben, zu „Celanisch“ – die Sache zog sich jahrelang hin und verdüsterte Celans Leben.
Es war ein äußerlich und innerlich erschütternd unruhevolles Leben, dem der Dichter selbst ein Ende setzte, als er sich in einem Zustand von Geisteskrankheit befand, aus dem es kein anderes Entkommen mehr gab.
Auch eine Biographie zu schreiben, ist Auswahl, ist Wertung. Kein Zweifel, dass Theo Buck, der Bewunderer, vieles nicht so schwer wiegen lässt: Nicht Celans zahlreiche, einander überlappende Frauengeschichten, die später seiner so aufopfernden Gattin schweres Unrecht taten. Nicht seine Unstetheit, die ihn auch treue Freunde wegstoßen ließ, wenn er sie plötzlich als illoyal empfand. Nicht sein Verfolgungswahn, der überall Antisemitismus witterte, auch wenn es vielleicht nur Zweifel an seinem Werk waren.
Doch ist es ein fabelhaft und übersichtlich erzähltes Buch, persönliche Entwicklung und Werkinterpretation verquickt: Denn auch das enthält diese Biographie, eine ausführliche Interpretation der wichtigsten Beispiele von Celans Lyrik, die nicht jedermann leicht fallen wird. Aber einen Zugang eröffnet der Autor allemale.
Das Leben von Paul Celan wurde zweifellos durch die Nazizeit zerstört. Aber er bekam viele Chancen, es wieder in den Griff zu bekommen, schaffte es von Zeit zu Zeit – und scheiterte letztlich. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland: Er konnte (zumal als Deutsch schreibender jüdischer Dichter) doch nicht damit leben.
Renate Wagner

