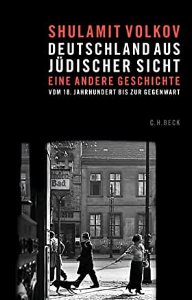
Shulamit Volkov
DEUTSCHLAND AUS JÜDISCHER SICHT
EINE ANDERE GESCHICHTE VOM 18. JAHRHUNDERT BIS ZUR GEGENWART
336 Seiten, Verlag C.H.Beck, 2022
Es gibt ausreichend Bücher, die die deutschen Juden aus der Sicht von deutschen Deutschen schildern. Shulamit Volkov hat nun versucht, die Sichtweise umzudrehen (was nicht immer einfach ist, weil man es ja mit derselben Geschichte zu tun hat). „Deutschland aus jüdischer Sicht“ jedenfalls soll „eine andere Geschichte“ sein, ist aber im Grunde die alte, trotz des Paradigmen-Wechsels. Denn, auch wenn sie es oft nicht wahrhaben wollen – Deutsche und Juden gehören zusammen, die gemeinsame Geschichte ist zu lang, zu intensiv, zu schmerzlich und vielfach zu großartig in ihren Leistungen, die Juden zur deutschen Kultur beigetragen haben.
Wie sehen nun die Juden die Deutschen, unter denen sie leben? Zweifellos distanziert, vorsichtig und misstrauisch, denn die schlechten Erfahrungen sind zahlreich. Dabei beschränkt sich die Autorin, ihres Zeichens emeritierte Professorin für Vergleichende Europäische Geschichte an der Universität Tel Aviv, auf das knappe Viertel-Jahrtausend seit 1870. Auch davor hätte es, wie man weiß, vieles zu erzählen gegeben, aber sie wollte mit der Aufklärung beginnen. Und wenn sie gleich das erste Kapitel „Aufklärung ohne Toleranz“ nennt, dann merkt man schon den Versuch, die Dinge aus jüdischer Sicht neu und auch anders zu beurteilen.
Denn die „Aufklärung“ wird in der deutschen Geschichtsschreibung ebenso glorifiziert wie die 1848er Revolution, die mit großer jüdischer Beteiligung stattfand und wo Volkov dennoch starken Antisemitismus ortet. Und auch der Liberalismus, der manchen jüdischen Aufstieg ermöglichte, war so liberal nicht – zumindest nicht gegenüber Juden, die nicht viel Geld hatten. Dennoch möchte die Autorin nicht ganz negativ sein, es gab nicht nur den Holocaust…
Wie die besten Historiker weiß auch Volkov, dass sich Geschichte nicht nur in theoretischer Analyse erschließt, sondern dass Menschenschicksale die besten Beispiele abgeben. Wenn sie Moses Mendelssohn (1729 – 1786) an die Spitze von vielen paradigmatischen Biographien stellt, ist hier schon die totale Ambivalenz jüdischer Schicksale im Zeitalter der „Aufklärung“ nachzuvollziehen. Sein Aufstieg war dank seiner enormen Fähigkeiten (etwas, das das intellektuelle Deutschland immer anerkannte, ob offen oder heimlich) nicht zu verhindern. Doch legte ausgerechnet König Friedrich II. von Preußen, der sich seiner Aufgeschlossenheit rühmte, ein Veto ein, als man Mendelssohn in die preußische Königliche Akademie der Wissenschaften aufnehmen wollte: Toleranz gegen Juden kannte ihre (königlichen und sonstigen) Grenzen. Nicht aber in den Augen der Besten wie Gotthold Ephraim Lessing, der Mendelssohn als „Nathan der Weise“ ein ewiges Denkmal in der deutschen Literatur und darüber hinaus setzte…
Es ist unendlich viel zu erzählen im Kampf um die bürgerlichen Rechte der Juden, in der Frage der Assimilation, die mit der Gefahr der Selbstaufgabe verbunden war, aber Beispiele wie Heinrich Heine zeigen, dass der Religionswechsel keinesfalls bringen musste, was man erhoffte (getaufte Juden blieben in den Augen einer missbilligenden Umwelt immer noch Juden). Aber Heine ist auch ein Beispiel dafür, mit welcher Innigkeit Juden an dem „deutschen Vaterland“ zu hängen vermochten. Ambivalenz, Widersprüche überall.
Und doch hinderte auch der im 19. Jahrhundert politisch instrumentalisierte Antisemitismus nichts am Aufstieg einzelner Juden – oft Familien wie die Liebermanns, die von Tuchhändlern zu innovativen Maschinenbauern aufstiegen, sich ein Haus neben dem Brandenburger Tor leisteten, deren berühmtestes Mitglied aber, Max Liebermann, kein Kaufmann war, sondern einer der größten Maler der deutschen Kunst.
Die „freien Berufe“, in denen Juden vordringlich tätig waren, gingen laut Autorin übrigens nicht allein auf das Verbot zurück, Land zu besitzen. Juden meinten seit frühester Zeit, wenn jemand lesen und schreiben könne, sei es Verschwendung, ihn zu Feldarbeit einzusetzen – ein originelles Argument, dem man noch nicht begegnet ist.
Deutsche Geschichte zu durchschreiten, ist immer auch eine jüdische Geschichte, denn sie blieben nie unbehelligt. Sie hatten bessere Zeiten (etwa, als Napoleon seine fortschrittliche Denkungsweise per Gesetz nach Deutschland brachte, oder in der Weimarer Republik) und entschieden schlechtere. Sie als Sündenböcke hinzustellen, scheint in der deutschen DNA eingeschrieben, bis heute, bis zu einer Pandemie, die bei der Autorin nicht vorkommt. Dass Vernichtung auch im Wesen der Deutschen lag, haben sie schon mit manchen Taten in den Kolonien bewiesen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, wo nur sehr wenige Juden nach Deutschland zurück kehrten (heute machen sie viel weniger als ein Prozent der Bevölkerung aus), geht die Geschichte weiter bis heute. Die Autorin erlaubt kein Wegsehen, schildert die Widerstände, die Fritz Bauer fand, als er Jagd auf Eichmann, Bormann, Mengele machte, erinnert an Martin Walsers Rede 1998, ausgerechnet, als er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen nahm und die Deutschen als Opfer einer falschen Erinnerungskultur darstellte, die Instrumentalisierung der „Schande“ zu gegenwärtigen Zwecken… Man glaubt zwar nicht recht, dass es außer von jüdischer Seite keinerlei Widerspruch gegeben haben soll, aber das zustimmende Nicken fand sicherlich statt.
Was resümiert das Buch nun? Wie fühlen sich Juden in Deutschland heute? Ambivalent, „sie bleiben fremd und daheim zugleich“. Dennoch will die Autorin – vielleicht dem deutschen Verlag zuliebe, vielleicht für ihre jüdischen Leser – ihren Überlegungen eine positive Schlußwendung geben: Die Lage sei nicht aussichtslos, der Blick in die Zukunft eröffne Raum für Optimismus. Ihr Wort in Jehovas Ohr.
Renate Wagner

