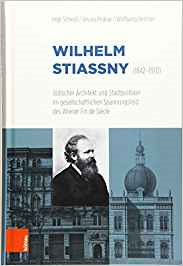
Inge Scheidl / Ursula Prokop / Wolfgang Herzner:
WILHELM STIASSNY (1842-1910)
Jüdischer Architekt und Stadtpolitiker im gesellschaftlichen Spannungsfeld des Wiener Fin de Siècle
344 Seiten, Verlag Böhlau, 2019
Wer je in dem alten Teil des Jüdischen Zentralfriedhofs geschlendert ist (1. Tor), dem mag ein antikisierendes Grabmal aufgefallen sein: Unter griechischen Säulen (mit einem orientalischen Aufbau) ruht der Architekt Wilhelm Stiassny, der auf diesem Friedhof so viel mehr und weit pompösere Grabstätten geschaffen hat. (Sein eignes Grabmal stammt nicht von ihm, sondern von Architektenkollegen Karl Mayreder, dem Gatten der Frauenrechtlerin Rosa Mayreder.)
Wilhelm Stiassny (1842-1910), von der Nachwelt vergessen, wie das Buch feststellt, das nun im Böhlau Verlag vorliegt und diesem unrechtmäßigen Vergessen mit einer imposanten Schau über sein Leben und Werk entgegenwirkt. Es ist eine Gemeinschaftsarbeit der Wissenschaftlerinnen Inge Scheidl und Ursula Prokop, die dank Wolfgang Herzner die umfangreichen Vorarbeiten von dessen verstorbener Gattin Mag. Dagmar Herzner-Kaiser heranziehen konnten. Das einzige, was das Buch ausspart, ist die ausführliche Darstellung von Stiassnys Synagogenbauten in der Monarchie, da dies in einer Dissertation von Satoko Tanaka dargestellt ist (im Internet per pdf. zugänglich).
Warum, voraus gesagt, ist Stiassny nicht so berühmt wie die anderen Ringstraßen-Architekten Hansen, Schmidt, Ferstl, Semper u.a.? Zuerst hat er keines der Repräsentationsgebäude an der Ringstraße gebaut, wenn auch zahlreiche große, eindrucksvolle und jedem Wiener bekannte Wohn- und Geschäftshäuser (ohne dass man sich Stiassnys als Architekten bewusst würde). Seine zahlreichen gemeinnützigen Bauten für jüdische Auftraggeber liegen nicht in Zentren, wo sie ins Auge springen würden. Die meisten seiner Synagogenbauten sind zerstört, darunter die einzige, die er in Wien im 2. Bezirk in der Leopoldsgasse schuf.
Und seine Großleistungen sowohl im Wiener Gemeinderat, ununterbrochen um die Verbesserung der Wohnverhältnisse der armen Bevölkerung bemüht (Wasser, Kanalisation etc.) wie auch für die Jüdische Gemeinde, für die er unermüdlich tätig war, schlagen sich nicht in optischen Zeichen nieder – es wäre Aufgabe der jüdischen Erinnerungskultur, hier einen Mann zu würdigen, der so viel für seine Mitmenschen getan hat. Auch das heutige Jüdische Museum, das auf jenes zurückgeht, das Wilhelm Stiassny einst gründete, hat sich seiner noch nie besonnen.
Wilhelm Stiassny wurde am 15. Oktober 1842 in Preßburg geboren, der ungarischen Königsstadt, als Sohn eines wohlhabenden Textilhändlers, der mit seiner Familie nach Wien zog, als der Sohn vier Jahre alt war. Es gibt viele Beispiele für den Zuzug mehr oder minder wohlhabender Familien aus der Habsburgischen „Provinz“ in die Kaiserstadt (Freud, Kraus, Herzl), und so gut wie alle taten es um der Kinder willen, denen sie die Möglichkeit von Studium und hochqualifizierter Arbeit ermöglichen wollten. Und bei dem hoch begabten Wilhelm zahlte es sich aus. Interessantes Detail am Rande: In der Akademie der bildenden Künste war Stiassny Jahrgangskollege von Otto Wagner – und als ob sie künftige Rivalität ahnten, haben sie lebenslang einen großen Bogen um einander gemacht. Tatsächlich, als Stiassny in seinen späteren Lebensjahren als Repräsentant des Ringstraßen-Stils nicht mehr gefragt war, stieg Otto Wagner als der glanzvolle „Moderne“ auf.
Aber in seiner Jugend musste sich Stiassny um sein Fortkommen keine Sorgen machen. In der Klasse des hoch liberalen Friedrich von Schmidt (seine Leidenschaft für die Gotik drückte er im Wiener Rathaus aus), wo jüdische Schüler gleichberechtigt behandelt wurden (auch die Kollegen Max Fleischer und Karl König), lernte Stiassny unendlich viel, auch über den Synagogenbau, den er in vielen „orientalisierenden“ Gebäuden realisieren sollte.
Nach kurzer Tätigkeit in Büros anderer Architekten machte sich Stiassny, der die schöne, wohlhabende, von ihm sehr geliebte Julia Taussig geheiratet hatte, 1868 (er war 26 Jahre alt) als Architekt selbständig. Über Mangel an Arbeit hatte er lange nicht zu klagen, er war übrigens auch für die Wiener Weltausstellung am Bau der „Rotunde“ beteiligt. Ab 1878 bis 1910 war er, mit Unterbrechungen, im Wiener Gemeinderat tätig, wobei er sich als „Fachmann im Dienste der Stadt“ verstand, während Kollege Karl Lueger (mit dem er erstaunlich gut auskam) lautstark Politik machte. Stiassny, immer höflich und zurückhaltend, sah sich angesichts des immer aggressiver werdenden Antisemitismus allerdings auf politischer Ebene einmal bis zum Beleidigungsprozeß attackiert. Dass seine Arbeit im Gemeinderat letztlich ungut endete, hat wohl auch seinen Tod am 11. Juli 1910 in Bad Ischl herbeigeführt.
Stiassny hatte wohlhabende jüdische Auftraggeber, voran die Familien Rothschild (der er auch die noble, elegante Gruft am Zentralfriedhof gestaltete, wo Stiassny auch die später niedergebrannte Zeremonienhalle schuf) und Königswarter. Für die Rothschilds war er der Mann fürs „Praktische“, schuf das Rothschild-Spital in Währing (abgerissen, wie so vieles) oder das Altersheim der Rothschilds in Gaming, für die Königswarter durfte er auch schon einmal ein kleines Schloß bauen. Das Buch geht zahllosen seiner Bauwerke bis ins Detail von Plänen und Konzeptionen nach, und die Frage stellt sich tatsächlich, wie er all das schaffen konnte, auch wenn sein Architekturbüro zeitweise 200 Mitarbeiter umfasste. Wenn Stiassny den überbordenden Geschmack der Ringstraßen-Ära bediente, so tat er es – viele Fotos zeigen es – mit außerordentlichem Geschmack.
Als Mann der vielschichtigen Identitäten wird Stiassny in diesem Buch geschildert, das ihn in seinen zahlreichen Berufen und Ambitionen würdigt und an seinem Beispiel zeigt, dass jüdische Assimilation nicht bedeuten musste, jüdische Identität aufzugeben. Er zählt zu den vielen Juden seiner Epoche, die die Monarchie – und damit die Vergangenheit Österreichs – in hohem Maße bereichert haben.
Renate Wagner

