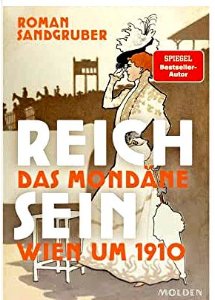
Roman Sandgruber:
REICH SEIN
DAS MONDÄNE WIEN UM 1900
352 Seiten, Molden Verlag, 2022
Es gibt Historiker, die meinen, Geschichte sei immer auch Wirtschaftsgeschichte, und sie haben sicher nicht unrecht. Denn Geld ist gewissermaßen das Schmieröl, zum Gelde drängt doch alles – und es fasziniert. Auch jene, die es nicht in reichem Maße besitzen. Das beweist Roman Sandgruber, ehemals Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johannes-Kepler-Universität Linz. Er hat sich mit dem Thema der Superreichen in der ausklingenden Habsburger-Monarchie schon vor neun Jahren befasst. Nun hat er die damalige „Traumzeit für Millionäre“ noch erweitert und liefert mit „Reich sein. Das mondäne Wien von 1910“ einen schlechtweg faszinierenden Überblick über die Epoche.
Dabei sieh er die Reichen und Schönen nie im Stil von Hochglanzillustrierten, vielmehr geht es um Analyse, um Einbettung des Reichtums in ein Gesellschaftsbild, das alle Schichten umfasst. Der „letzte Glanz der Kaiserzeit“ entfaltet sich zwar, aber dabei wird nicht auf die teils verheerende Situation der Armen vergessen, die auch nach Wien geströmt waren, um ihr Glück zu machen – und im Unglück stecken blieben.
Soziologisch ist die Aufschlüsselung der Superreichen, der Millionäre der Monarchie höchst aussagestark, und 1910 ist der ideale Zeitpunkt, sie festzumachen. Alles war damals auf dem Höhepunkt – während sich in den folgenden Jahren der kommende Krieg ja abzeichnete und die saturierte Ruhe störte. Aber nach dem Fin de Siecle, dessen künstlerischer Glanz strahlte (und teilweise von den Millionären mitgetragen wurde), vor dem Krieg, der diese Welt untergehen ließ, war „Reich sein“ in Wien noch so richtig schön. Dazu hat Sandgruber ungeheure Arbeit geleistet, das Thema gewissermaßen zu personalisieren.
Das Buch ist ungemein geschmackvoll gestaltet, widmet zentralen Persönlichkeiten auch immer wieder eine „lexikalische“ Seite, fügt Farbbilder und Fotos aus der Zeit ein, hat übersichtliche, gut zu begreifende Tabellen zu einzelnen Themenschwerpunkten. Dass am Ende, wo der Anhang so klein gedruckt ist, dass man ein Vergrößerungsglas dafür braucht, kein Platz mehr für ein Personenregister war, ist mehr als bedauerlich – das Buch eignet sich an sich vorzüglich, immer wieder einzelne Personen der Zeit nachzuschlagen.
Wie ermisst man Reichtum? Ein Wirtschaftswissenschaftler weiß es – nicht zuletzt an den Steuern. Dabei scheint es einst dasselbe Phänomen gegeben zu haben wie heute – dass die Reichen keineswegs überschwer vom Staat „geschröpft“ wurden… Die 979 Millionäre, die Sandgruber im Jahr 1910 in Wien und Niederösterreich nennt und die nur 0,7 Promille der Bevölkerung ausmachten, konnten sich die Steuern locker leisten.
Die Grundfrage war, wie man reich wurde, wobei das Buch mit dem Reichsten der Reichen beginnt – mit den Rothschilds. Albert Freiherr von Rothschild, der den Wiener Zweig der Bankiersfamilie so erfolgreich führte, steckte alle anderen in die Tasche. Woran sich gleich die Tatsache schließt, dass ein überwältigender Teil der Reichen Juden waren, was dem Antisemitismus jeglichen Auftrieb verlieh. Aber sie hatten einfach die „Hand“ für das Geschäft – nicht zuletzt durch ihre Geschichte, die ihnen diese Sparte gewissermaßen zugeschoben hatte. Manch einer der genannten Reichen hat übrigens Vermögen nicht erst von den Vätern geerbt, sondern seinen Aufstieg von ganz unten selbst angetreten.
Liest man sich durch die einzelnen Sparten des „Reichtums“, so findet man viele vergessene Namen – und andere, die entweder durch Persönlichkeiten oder Firmen noch heute ein Begriff sind. Die Ephrussi für das Bankwesen, wo laut Autor die „Urgesteine des Kapitalismus“ zu finden sind. Für den reich machenden Handel gab es unendlich viele Sparten. Sandgruber zitiert Nestroys „Frühere Verhältnisse“: „Hast du je einen armen Holzhändler gesehen?“ Holz machte reich, Kohle desgleichen, und – Kaffee, wobei das Imperium von Julius Meinl zwar angeknackst, aber dennoch bis in unsere Zeit überlebt hat. Allerdings nicht mehr mit 115 Filialen in der ganzen Monarchie wie vor dem Ersten Weltkrieg… Und manche Luxusprodukte von damals gibt es gleichfalls heute noch – ob Schlumberger, ob Kattus.
Viel Geld konnte man mit dem Textilhandel aller Art machen, und das Haas-Haus am Stefansplatz heißt (umgebaut) noch immer so, wenn es die Firma auch nicht mehr gibt. Viele große Unternehmen gingen mit spektakulären Warenhäusern Hand in Hand, die zu ihrer Zeit wahre Paläste des Konsums waren. Es war eine Epoche, wo man Luxus kaufen und verkaufen konnte.
Ein Drittel der Millionäre stellten die Industriellen – viele Namen kennt man noch: Böhler, Wittgenstein (der Vater des Philosophen, der Albert Rothschild Konkurrenz machte), Heller („Wiener Zuckerl“ gibt es noch immer), Manner, Mautner-Markhof, Ob als Bauherren, ob als Zuckerbarone, ob man als „Thonet“ eine Möbel-Weltmarke schuf, überall war Geld zu holen, auch in Nischensegmenten, wenn man sie besetzte (etwa Bedürfnisanstalten oder Insektenpulver). Später kam dann etwa auch die Autoindustrie dazu, die fest auf dem Knowhow des Wiener Kutschenbaus ruhte…
Man liest sich mit Vergnügen durch Hunderte Seiten durch, in Erinnerung daran, was damals geleistet wurde. Übrigens auch an den Universitäten, wo man gut verdiente, bei Anwälten und Ärzten. Bei den Zeitungen wurden allerdings nur die Besitzer reich, nicht die Journalisten.
Sandgruber, der als umfassend gebildeter Mann auch immer wieder Dichter zitiert (und in Arthur Schnitzlers Tagebüchern eine Fundgrube für Wirtschaftsthemen und Persönlichkeiten aufgetan hat), fragt auch, wie reich Künstler werden konnten. Nun, nicht einmal Gustav Klimt, der exorbitante Summen für seine Bilder verlangte, brachte es zum Millionär. Und das, obwohl viele reiche Juden ihre Frauen porträtieren ließen – wohl im Wissen, dass sie ihnen damit die Tür zur Unsterblichkeit öffneten – Adele Bloch-Bauer, Sonja Knips, Amalie Zuckerkandl, Margarethe Wittgenstein, Serena Lederer, Fritza Riedler, Johanna Staude… unvergängliche Schönheiten, von den Gatten bezahlt. Sonst waren es vor allem die Operettenkönige, die zu Millionären aufstiegen. Uns fällt auf, dass eine Sparte, die heute Millionäre macht, damals überhaupt noch nicht „mitspielte“: die Sportler…
Sandgruber behandelt zahlreiche anfallende Fragen, etwa jene des gesellschaftlichen Prestiges des Reichtums, und das war wohl nicht so groß wie der Neid, den er hervorrief. Ein hoher Beamter genoß in der Monarchie weit mehr Ansehen als ein reich gewordener jüdischer Unternehmer, auch wenn viele von ihnen geadelt wurden. Der „echte“ Adel, der sich mit wenigen Ausnahmen (die Harrach investierten sehr geschickt) nicht ums Geld kümmerte, hatte zu Kaisers Zeiten jedenfalls seine unangefochtene Stellung.
Aber es gab auch die Tatsache, dass reiche jüdische Väter wie die Herren Zweig, Kraus oder Broch kopfschüttelnd auf die Söhne blickten, die lieber Schriftsteller wurden, statt in der Firma mitzuarbeiten… Ein Kapitel über „schwarze Schafe“, Aussteiger aus dem familiären Reichtum und der vorgegebenen Laufbahn, ist interessant und auch amüsant.
Viele Vermögen gingen schon mit der Monarchie verloren, und nur die Glücklichen unter den Juden landeten am Zentralfriedhof in luxuriösen Grabbauten. Am Ende führt der Autor eine lapidare Liste jener Millionäre von 1910 auf, die zwischen 1938 und 1945 in den Konzentrationslagern ermordet wurden. Sein Nachwort für die Erstausgabe im Jahr 2013 musste er angesichts des Ukraine-Kriegs umschreiben. Die Hoffnung, dass es in der Welt keine Gewaltbereitschaft und Kriegslüsternheit mehr gäbe, hat sich nicht erfüllt.
Renate Wagner

