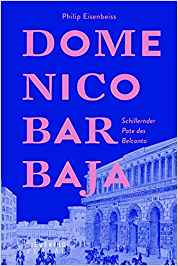
Philip Eisenbeiss:
DOMENICO BARBAJA
Schillernder Pate des Belcanto
Übersetzung: Harald Alfred Stadler
368 Seiten, Sieveking Verlag, 2019
Wem flicht die Nachwelt eigentlich Kränze? Den Komponisten gewiss, wenn auch nicht allen – aus der Fülle derer, die den unermüdlichen Opernbetrieb am Laufen halten, schaffen es nur wenige in die Nachwelt und das „ewige“ Repertoire. Schließlich sind die Namen mancher großen Sänger geblieben, die aus der Vergangenheit zu uns her glänzen. Aber nur, wer sich für Operngeschichte interessiert, wird noch den Namen „Domenico Barbaja“ kennen, obwohl er – einmal auf uns bezogen – auch in Wiens schillerndem Opernleben des beginnenden 19. Jahrhunderts eine hoch farbige Rolle gespielt hat.
Barbaja war eine Persönlichkeit, die schlimmer scheint als alle unsere heutigen Direktoren, Agenten, Impresarios zusammen (war er es wirklich?) In der deutschen Fassung der ihm gewidmeten Biographie wird er nicht zu Unrecht „Pate des Belcanto“ genannt, in der englischen Fassung der „Bel Canto Bully“. Ein Abenteuerleben. Man hat echte Freude damit zwischen Buchdeckeln.
Er war ein Selfmade-Man, wie er im Buche steht, „durch reine Willenskraft, unerschöpfliche Energie, unerschrockene Tatkraft und mehr als eine Prise Schikane“, wie ihn Autor Philip Eisenbeiss schildert. Kosmopolitisch und dekadent – und vor allem rücksichtslos. Zur Oper kam er auf Umwegen, nachdem er als Jugendlicher als Kaffeehauskellner in Mailand gearbeitet hatte (wo er schon eine eigene Kaffee-Kreation schuf, die auf die Eventsucht der Kunden abzielte). Im opernsüchtigen Italien, in das er 1778 hineingeboren wurde, standen die Spieltische in den Foyers der Opernhäuser, und Barbaja roch früh, dass da Geld zu machen war. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war durch die Franzosen als Besatzungsmacht in Italien das Glücksspiel legalisiert, und Barbaja, der als Tischbetreiber im Opernfoyer der Scala begonnen hatte, beherrschte bald das Glücksspiel mehrerer Städte und macht ein Vermögen. Bis er merkte, dass Oper selbst auch das große Geld brachte… in einer Zeit, wo niemand von Subventionen, nur von Gewinnen sprach.
Er ging nach Neapel, an das gloriose Teatro San Carlo (das, nach Bränden immer wieder aufgebaut, noch heute steht und blüht), und seine guten Beziehungen zu den wahlweise Bourbonen oder der Bonaparte-Familie, wer halt gerade herrschte (es änderte sich damals schnell), verhalfen ihm zur gemeinsamen Leitung von Glücksspiel und Oper. Mit 31 Jahren war er Impresario eines der wichtigsten Häuser Italiens – und seine wahre Berufung und Karriere konnte beginnen. Er muss ein Organisationsgenie gewesen sein – anders lässt sich sein Erfolg nicht erklären.
Oper spielte im Leben der italienischen Städte eine ungeheure (gesellschaftliche) Rolle – aber man musste den Leuten etwas bieten. Andauernd neue Werke. Spektakuläre Ausstattungen. Und – Sänger. Barbaja bekam schnell alles in den Griff. Nachdem er es mit mäßigem Erfolg mit ein paar anderen Komponisten versucht hatte, holte er Gioachino Rossini nach Neapel – und eine spannungsvolle, aber fruchtbare Zusammenarbeit begann. (Die Sängerin, die sie sich anfangs „teilten“, Isabella Colbran, wurde später Rossinis Gattin.) Beide Männer waren unersättlich in ihrer Begierde nach Essen und Frauen, und Rossini bekämpfte Barbajas Knebelverträge, wo er konnte – und schrieb Rollen für die Colbran.
Barbaja war es recht, Sänger füllten die Häuser. Er ist, so formuliert es der Autor, gleichzeitig „ein geschickter Ausbeuter und ein nachsichtiger Vater, ein bedingungsloser Lehrer und ein treuer Freund, ein aufgeklärter Ratgeber und ein unbestechlicher Richter“. Dazu kamen allerdings grobe Manieren und ein brutaler Charakter, der seine Künstler auf die übelste Weise beschimpfte, wenn ihm danach war. Auch führte er gnadenlose Prozesse, wenn man sich ihm widersetzte. Sein immer wachsendes Vermögen (angeblich war er reicher als der König von Neapel) wurde in Immobilien und hochwertige Kunst der Zeit umgesetzt.
Barbaja war ein Mann, der nie genug bekommen konnte. Als das Geld aus dem Glücksspiel durch Gesetzesänderungen versiegte, sah er sich nach weiteren Schauplätzen um, wo er „seine“ Opern und Sänger vermarkten konnte. Wenn er gekonnt hätte, wäre er auch noch gerne Impresario in Paris geworden (als sich Rossini dorthin zurückzog), aber Wien kam ihm gerade recht.
1821 nahm er neben Neapel das Kärntnertortheater als zweites Standbein, pendelte (das war damals eine anstrengende und langwierige Reise!) zwischen den beiden Städten, und fand sich nie überfordert: Er musste von Vertrags wegen in Wien auch deutsche Musik spielen – er beauftragte Weber mit „Euryanthe“ und Schubert mit „Fierrabras“. Und natürlich verfielen die Wiener dank Barbaja in ihren Rossini-Taumel.
Die Wiener Episode ist so besonders interessant, weil Barbaja sich hier wie der typische üble Unternehmer (heutigen Zuschnitts) gebärdete, Kosten kürzte, die Preise gewaltig erhöhte, gnadenlos Mitarbeiter entließ – ältere Musiker, die nirgends mehr unterkamen, trieb der in die Armut. Außerdem warf er in seiner Unersättlichkeit (gewissermaßen ein Pendant zu dem Theaterdirektor Carl Carl, der auch Theater „sammelte“) noch den begierigen Blick auf das Theater an der Wien, das er eine zeitlang gleichfalls leitete. In den wenigen Wiener Jahren hat er unübersehbare Spuren hinterlassen – und es war, niemand wird das leugnen, eine echte Blütezeit der Oper.
Trotz seiner Erfolge, trotz seiner Möglichkeiten, Kunst und Künstler zwischen Neapel und Wien herumzujonglieren, hatte Barbaja nie Mailand aus den Augen verloren: Dort in der Nähe war er geboren, seine erste Sprache war der Mailänder Dialekt gewesen, dort hatte seine Karriere begonnen. Nun pachtete er 1826 auch noch die Mailänder Scala. Und langsam brauchte er Nachfolger für Rossini. Es ist faszinierend zu beobachten, welch große Rolle er noch in den Karrieren von (dem persönlich freundlich-friedlichen) Donizetti und (dem giftigen, konkurrenzbewussten) Bellini spielte… Andere damals erfolgreiche Komponisten wie Nicola Vaccai hingegen sind völlig vergessen.
1828 zog sich Barbaja von Wien zurück, dann von Mailand, nur Neapel hat er nie aufgegeben. Die dreißiger Jahre wurden für ihn zähe, seine Glanzzeit war vorbei. Oft fand er sich vor Gericht wieder. Neue Sänger kamen und gingen. Die Cholera zog durch Europa. Erfolge blieben aus, Verluste mehrten sich. Dennoch starb er 64jährig 1841 in der luxuriösen Villa, die er sich in Posillipo (am Rand von Neapel) einst hatte bauen lassen. Seine Kinder, um die er sich nie gekümmert hatte, erbten die Kunstsammlung und die Probleme, sie zu verkaufen. Die Erinnerung an ihn verblasste schnell.
Vielleicht sollte man am Ende ein paar Worte über den Autor verlieren – die Geschichte ist zwar nicht so abenteuerlich wie jene von Barbaja, aber auch interessant genug. Philip Eisenbeiss ist nämlich Laie im Fach des Biographienschreibens (zumindest, bis er dieses Buch begann). Er lebt nämlich als Headhunter im Finanzbereich in Hongkong und hatte nur aus seiner Kindheit eine gewisse Liebe zur Oper mitbekommen. War es wirklich das einzig existierende Gemälde von Barbaja, das sich in Mailand im Scala-Museum befindet, das sein Interesse an dem Mann so angezündet hat, dass er jahrelange Recherchen auf sich nahm, u.a. auch zu den „Barbaja“-Orten (von der Villa in Posilipo ist nichts mehr zu finden). Er schrieb das Buch, ohne den Anspruch der „Wissenschaftlichkeit“ zu stellen. Primärliteratur der Zeit und Sekundärliteratur über die Protagonisten dieser farbigen Geschichte aus der Welt der Oper haben ihn geleitet. Barbaja ist der Nutznießer: Er steht nun überlebensgroß und sehr lebendig vor dem Leser.
Renate Wagner

