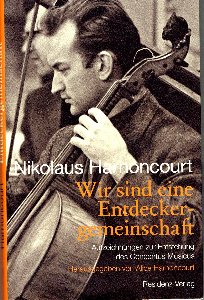
Nikolaus Harnoncourt:
WIR SIND EINE ENTDECKERGEMEINSCHAFT
Residenz Verlag 2017
„Macht keine eckige Musik!“
Die von Alice Harnoncourt in Buchform herausgegebenen Tagebuch-Aufzeichnungen und Notizen von Nikolaus Harnoncourt, der am 5. März 2016 in St. Georgen verstarb, waren eigentlich gar nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Dass sich seine Witwe, die den ganzen Lebens- und Berufsweg mit ihrem Mann gegangen war, und übrigens eine fabelhafte Geigerin und Pianistin ist, konnte wohl bestens abschätzen, was sich für eine Öffentlichmachung eignete und was nicht. Was dabei herausgekommen ist, ist ein selten ehrliches Musikerbekenntnis ohne Schönfärberei und Vertuschung von weniger angenehmen Tatsachen, dafür kündet es von dem persönlichen Engagement und dem künstlerischen Willen, seinen Weg zu gehen und sich nicht von Neidern und Spöttern davon abbringen zu lassen. Respekt!
Man hat – leider oft in Unkenntnis und in Verkennung der wahren Sachlage – Harnoncourt oft in die Ecke des weltfremden Gurus der historischen Aufführungspraxis gestellt. Das Gegenteil ist der Fall! In diesen Aufzeichnungen stellt der Autor dar, wie die Idee des Musizierens mit „historischen Instrumenten“ zur Gründung des Concentus Musicus geführt hat. Harnoncourt war ja selbst während siebzehn Jahren Solo-Cellist bei den Wiener Symphonikern und – leider bis zu einem grotesken Missverständnis – trotz aller kritischen Distanz ein großer Bewunderer Herbert von Karajans.
So war Harnoncourt immer mehr der Praktiker als der trockene Wissenschafter, der aktuell bedingte Lösungen auf musikalischem Gebiet gesucht und auch gefunden hat. Dies, weil er offen war für Neues und sich nicht darauf berief, dass man das so macht, weil man es letztes Mal auch so gemacht hatte. So perfektionierte er auf vielen Gastspielreisen durch stete Erfahrung und Weiterentwicklung der Spieltechniken die Professionalität des Concentus Musicus immer mehr. Historische Instrumente mussten gekauft, von ihren Verschandelungen befreit und auf den ursprünglichen Zustand zurückgebaut werden. Und vor allem mussten Musiker und Musikerinnen gefunden werden, die mit diesen Instrumenten umzugehen wussten und sie auch gut spielen konnten. Was heutzutage ganz selbstverständlich scheint, war damals ein Abenteuer.
Das Risiko hat sich gelohnt und Harnoncourt konnte sich durchsetzen, unterstützt durch eine fortwährende Erweiterung seines Repertoires an Schallplatten und CDs. So hielt Harnoncourt immer die Augen offen, für Neuerungen, für Selbstkritik und somit für ständige Qualitätssteigerung. Dass er von der etablierten Musikwissenschaft mitunter scheel angesehen wurde, hat ihn nicht nur geärgert, sondern letztlich auch amüsiert, was ihn zur Aussage führte: „…die da in den Bibliotheken hinter den blauen Lämpchen sitzen…“.
Ganz selten äußerte er sich auch gegenüber Kollegen, deren Interpretation und Personenkult er wenig schätzte. Dass gerade Karl Richter dafür herhalten musste, befremdet doch ein wenig. Sonst aber liest sich das Buch nicht nur spannend, sondern gewährt einem viele Einblicke in die Denkens- und Arbeitsweise Harnoncourts, die nach wie vor aktuell sind. Und dabei ist Harnoncourt selbst schon zum Urgestein des historischen Aufführungspraxis geworden, was er sicher weit von sich gewiesen hätte.
Dass er immer wieder mit anderen Orchestern als mit dem Concentus Musicus zusammengearbeitet (und von diesem als Verräter angesehen wurde) und mit ihnen viele Aufnahmen gemacht hat, zeigt nur, dass er eines nicht war, nämlich langweilig und stur. Als nach einer fulminanten Interpretation von Beethovens Fünfter eine Bewunderin zu ihm sagte, dass das für sie etwas ganz Neues gewesen sei, antwortete Harnoncourt nur: „Für mich auch!“
John H. Mueller

