18. Juni 1815 :
Vor 200 Jahren ging Napoleon in Waterloo unter!
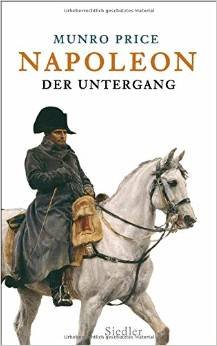
Munro Price: NAPOLEON. Der Untergang
463 Seiten, Siedler Verlag, 2015
Noch ein Buch über Napoleon? Der Autor selbst weiß es: Gut 200.000 (!) wurden seit dessen Tod über ihn geschrieben. Aber Munro Price, Professor an der englischen Universität von Bradford mit dem Forschungsschwerpunkt Frankreich, weiß von unzureichend ausgewerteten Quellen berichten – vielleicht hat sich tatsächlich nicht jeder Historiker so sorgfältig über die acht publizierten Bände des Metternich-Nachlasses gesetzt oder andere, nicht veröffentlichte Nachlässe in Archiven und Privatbesitz befragt, wie jene des Grafen Clam-Martinic, der Adjutant jenes Fürsten Schwarzenberg war, der den vereinigten Streitkräften gegen Napoleon 1813 und 14 als Oberbefehlshaber vorstand.
Und überhaupt, meint Price, habe man Napoleons Untergang im Vergleich zu dessen „glorreichen“ Siegen in der Literatur vernachlässigt. 2015 ist nun ein passendes Jahr, „Napoleon. Der Untergang“ zu veröffentlichen, denn obwohl Napoleon erst 1821 auf dem „Felsen im Atlantik“, St. Helena, gestorben ist, so endeten doch alle seine Träume und Ambitionen vor 200 Jahren, als er die unglaublichen „Hundert Tage“ zurückkehrte und in Waterloo endgültig geschlagen wurde.
Aber Price setzt den „Untergang“ (im Englischen heißt das Buch „End of Glory“) schon früher an: Damals im Winter 1812, als er sich entschloss, seine im Grunde bereits verlorene Armee in Russland zurück zu lassen, eine für einen Feldherr kaum zu entschuldigende Entscheidung.
Napoleons Rückkehr nach Paris erfolgte unter dem Vorwand, neue Truppen auszuheben, war aber tatsächlich durch zahlreiche Rebellionen und Widerstände im Mutterland provoziert worden – Napoleon wusste genau, dass das Frankreich, das er geschaffen hatte, untrennbar mit seiner Person verbunden war. Sein im März 1811 geborener Sohn (der Habsburger-Sproß) „machte“ noch lange nicht die Dynastie, die er sich erträumte. Es war nicht zuletzt die Opposition im eigenen Land, deren Stärke Munro ausführt („Komplotte und Alarmzeichen“ aufzeigend), die letztendlich Napoleon „entthronte“… Doch so weit war es Ende 1812, Anfang 1813 noch nicht.
Eine der Stärken des Buches, das seine politischen Analysen gnadenlos durchzieht, besteht in der Schilderung der Protagonisten. Bei all dem, was sich 1813 in Europa umschichtete, spielte der „menschliche Faktor“ eine übergroße Rolle – sowohl die Eigenheiten in Napoleons Charakter wie auch die doch sehr starken Gegenspieler wie etwa der so interessant umrissene russische Zar Alexander I. oder der österreichische Kanzler Metternich.
Es fällt übrigens auf, dass Metternich und „sein“ Kaiser, Franz I., üblicherweise die Lieblings-Sündenböcke der französischen Geschichtsschreiber, die ihnen nur die schlechtesten Eigenschaften zuschreiben, bei dem sachlichen Engländer Munro Price relativ gut wegkommen und er ihnen nicht die übelsten Taten und Beweggründe unterstellt.
Tatsache ist, dass Napoleon Zwangsbündnisse geschlossen hatte, mit den deutschen Fürsten, aber auch mit dem Habsburger-Kaiser, der schließlich sein Schwiegervater war, und mit den Preußen (so dass etwa die Hälfte des Heeres, das für ihn in Russland kämpfte, nicht aus Franzosen, sondern aus widerstrebenden „Bündnis“-Armeen bestand). Die Ereignisse in der ersten Hälfte des Jahre 1813 bestanden nun in hektischen Aktivitäten nicht zuletzt der Russen, alle „Verbündeten“ Napoleons von ihm abzuziehen und in vereinter Kraft gegen ihn zu lenken.
Das war ein – wie auch der Autor zugibt – in vielen Dingen kaum mehr zu durchschauender diplomatischer Tanz, ein ewiges Abwägen von Für und Wider (schließlich wurden ja auch Verträge gebrochen), ein Hin und Her von Versprechungen und Zusagen, kurz, ein Verhandlungs-Parcours ohnegleichen.
Das Ende ist bekannt – die Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813, bei der Napoleon dann alleine gegen den „Rest der Welt“ stand und unterlag. Besonders interessant ist die Schilderung, wie er danach monatelang noch glaubte, sich persönlich halten und gar Bedingungen diktieren zu können, bis er sich endlich zur Abdankung bereit fand und nach Elba ging. Wobei der Autor auch schildert, dass die Rückkehr der Bourbonen, dass vor allem die von jedermann verachtete Figur von Louis XVIII., für Frankreich keine „Lösung“ der „Nachnapoleonischen“ Epoche brachte, so dass Napoleon die Wiederkehr tatsächlich riskieren konnte – wenn auch die „Hundert Tage“ 1815 (die der Autor nur noch kursorisch betrachtet) keinen Sinn machten und mit dem endgültigen Untergang bei Waterloo endeten.
Um die Fäden, mit denen er sein Buch gewebt hat, wieder zusammen zu führen, schildert der Autor am Ende in Kurzform die weiteren Schicksale aller Beteiligter: Es waren teils tragische, teils durchaus erfolgreiche Leben, die in Ruhe beendet wurden (wie jenes von Metternich, der nach 1848 nach Österreich zurückkehrte und dort unbehelligt starb). Wie unglaublich turbulent es davor zugegangen war, das konnte man auf gut 400 Seiten nachlesen, wo vor allem diplomatische Verfilzungen so lesbar gemacht wurden wie möglich.
Renate Wagner

