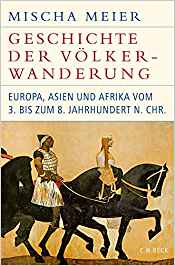
Mischa Meier:
GESCHICHTE DER VÖLKERWANDERUNG
Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert nach Christus
1536 Seiten, Verlag C.H.Beck, 2019
Unverkennbar das Paar, das am Titelbild dieses Buches reitet – die blonde Dame und der exotisch-dunkle Krieger, jedermann erkennt Krimhild und Etzel. Etzel, wie das Nibelungenlied Attila nannte, den König der Hunnen. Der Österreicher Egger-Lienz hat sie so eindrucksvoll-kantig gemalt. Und die Hunnenstürme sind es, die man mit dem Begriff „Völkerwanderung“ untrennbar verbindet.
Die neue Völkerwanderung, die Europa heute überschwemmt und zu einem in bereits zahlreichen Büchern besprochenen Begriff geworden ist, ladet eine Geschichte von Europa „von 3. bis zum 8. Jahrhundert n. Chr.“, wie sie der Tübinger Professor für Alte Geschichte Mischa Meier nun vorlegt, mit zeitgenössischen Fragen auf.
Mit 1536 Seiten (der Anhang beginnt auf Seite 1107) ist das Buch so umfangreich, dass man fast davor zurück schrecken würde. Und dennoch – eine ungewöhnlich interessante Betrachtung, wobei der Autor gleich die ersten hundert Seiten seines Buches dazu benützt, Grundlegendes zu klären.
Etwa über die Überlieferung: Zwar besitzt man zeitgenössische Schilderungen aus den frühen Jahrhunderten, aber bei weitem nicht genug, um genaue Aussagen zu tätigen, nicht über Ereignisse selbst und nicht über Motivationen. Das macht den Interpretationsraum der Autoren zu dem Thema noch breiter.
Und Interpretation ist entscheidend, wie man diese Jahrhunderte betrachtet (Der Autor nennt es „Von der Schwierigkeit, von der Völkerwanderung zu erzählen.“) Tatsächlich ist „Völkerwanderung ein perspektivischer Epochenbegriff, der in den zeitgenössischen Quellen nicht belegt ist.“ Erst im 16. Jahrhundert ist rückschauend von „migratio gentium“ die Rede, und erst, als sich die neuen Strukturen gefestigt hatten, hieß es in deutschen Landen: „Unser sind der Goten, Vandalen und Franken Heldentaten“, wobei die Germanen als Hauptakteure betrachtet wurden, unter Hintanstellung der Slawen (und dabei waren es die Hunnen, mit denen der ganze Schrecken begann).
Vor allem im 19. Jahrhundert, im Zeitalter der Nationalstaaten, hat man „Volk“ und „Kultur“ gleich gesetzt. Nach 1945 gibt es eine starke Strömung, die davon abrückt. Angesichts der Paradigmenwechsel, die auch in der Wissenschaft zu verschiedenen Strömungen führen, dominiert nun die Meinung, Völker seien soziale Gebilde, die sich im Lauf der Zeit dauernd veränderten, durch Zuwanderungs- und Abspaltungsprozesse, und keine kohärenten Einheiten mehr darstellten. Die Sprache als Identifikation reicht bei dieser Betrachtung nicht mehr aus.
Rückwirkend auf das Römische Reich geblickt, das 395 in „Ostrom“ und „Westrom“ geteilt wurde, stellt sich angesichts seines Untergangs in den folgenden Jahrhunderten die Frage, ob die Römer wirklich Römer waren. Nun, schon Julius Caesar erzürnte seine Landsleute, indem er Gallier mit nach Rom brachte und ihnen das Bürgerrecht verlieh. Indem Rom stets versucht hatte, die Randgebiete seines Reiches möglichst zu integrieren, hatte sich eine multikulturelle Gesellschaft gebildet, in der Güter, Ideen und Menschen ausgetauscht wurden, und viele Bürger hatten – wie die heutigen Migranten – „doppelte“ Identitäten.
Dennoch scheint es, wie hier der Autor es versucht, nicht ganz logisch, die Ereignisse der Völkerwanderung solcherart zu diminuieren. Mag auch schon Seneca erklärt haben, Sesshaftigkeit sei nicht der Normalfall, scheint es doch nicht völlig einsichtig, die Völkerwanderung – wie es die moderne Wissenschaft teilweise tut – jetzt nur noch als Transformation und nicht mehr als Zerstörung zu begreifen. Es sei, meint Meier, einfach die die Übergangsphase zwischen Antike und Mittelalter, in eine poströmische Welt im Westen, in eine byzantinisch-arabische im Osten, und er sieht darin eher einen schöpferischen als einen destruktiven Aspekt. Was möglicherweise bedeutet, die Rolle von brutaler Gewalt, Zerstörung, Vernichtung, Tod gering zu schätzen…
Nichtsdestoweniger schildert der Autor nach diesen langen, grundlegenden und ideologischen Überlegungen (viele Althistoriker sehen die Dinge noch immer grundsätzlich anders) die Ereignisse, wie sie sich ergaben: Hunnen, Araber, Alemannen, Franken, Ostgoten, Westgoten, Burgunder, Thüringer, Sueben, Vandalen, Perser, Langobarden, von der Donau über Afrika bis tief in den Osten, stete Veränderung, stete Unsicherheit, Kämpfe hier, Verhandlungen da, bis zum Entstehen neuer Reiche. Das ist reichlich Lesestoff aus unruhigen Zeiten, manchmal auch schwer zu durchschauen.
Am Ende gibt der Autor zu, dass die Beurteilung dieser Jahrhunderte eine Frage der Perspektive ist. Das gibt dem Leser auch die Möglichkeit, Dinge teilweise anders zu sehen als hier dargestellt. Für die Materialfülle wird er jedenfalls dankbar sein.
Renate Wagner

