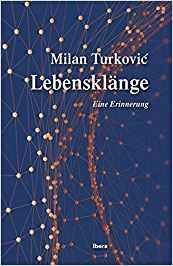
Milan Turkovic:
LEBENSKLÄNGE
Eine Erinnerung
248 Seiten, Ibera Verlag, 2019
Die einen kennen ihn als einen der berühmtesten Fagottisten aus der Welt der Musik, der übrigens auch dirigiert; die anderen, mehr auf „Seitenblicke“ ausgerichtet, wissen, dass er Ingrid Wendl geheiratet hat, was auch eine Art von Popularität ist. Und dabei hat Milan Turkovic so viel mehr zu erzählen – und er tut es in seinem Buch „Lebensklänge“, in dem er sich (nachdem er bisher eher Plauder-Bücher geschrieben hat) ernsthaft seiner eigenen Biographie zuwendet. Und die hat es in sich!
Da ist erst einmal die Geschichte der Eltern, voran jene der faszinierenden Mutter mit dem tragischen Schicksal. Sie wurde als Irmgard Overhoff geboren, eine echte Wienerin mit westfälischen und georgischen Vorfahren. Ihr Vater verdiente sein Geld in Böhmen und führte ein luxuriöses großbürgerliches Leben im Cottage-Viertel. Tochter Irmgard, Jahrgang 1905, zweite von vier Geschwistern, nahm Musikunterricht in der Schweiz (Yehudi Manuhin war einer ihrer Kommilitonen) und eroberte das Herz von Edwin Fischer, später weltberühmter Pianist, der nie verwand, dass sie ihn ausschlug. Als Irmgard von der Violine zum Gesang wechselte, sagte ihr Lehrer empört: „Was, du gibst die Kunst auf und wirst Sängerin?“
Tatsächlich bekam sie auch Rollen in deutschen Filmen der dreißiger Jahre als Partnerin von Johannes Heesters oder Paul Hörbiger. Ihr Herz hatte ein reicher kroatischer Adeliger erobert: 1938 heiratete sie Dr. Fedor Turkovic, Großgrundbesitzer mit Studien in Oxford und Wien, Liebling der Gesellschaft, der sie nach Zagreb, damals noch das Paris des Balkans, mitnahm. Das überbordende Luxusleben, das Milan Turkovic schildert (1939 geboren, kannte er es nur aus Erzählungen), genoß sie nur kurz. Der Zweite Weltkrieg erreichte auch Kroatien, und 1944 erschoß sich ihr Mann, der ahnte, dass in der Welt, die nun kam, kein Platz mehr für seinesgleichen war.
Tatsächlich beginnt Milan das Buch (in den Ereignissen flott hin und her springend) mit dem mutigen Kampf seiner Mutter gegen das Tito-Regime, das vor allem in Kroatien wütete (schließlich hatte sich die Ustascha mit dem Dritten Reich verbündet): Unter der Anklage, „Nazi-Lieder“ gesungen zu haben (Brahms, Schubert…), verschwand sie nach dem Krieg zum Entsetzen ihres kleinen Sohnes siebeneinhalb Wochen im Gefängnis, und dass sie überlebt hat, war zweifellos ein Glücksfall besonderen Ausmaßes.
Bei erster Gelegenheit nahm sie ihren Jungen, für den es kein Vergnügen war, im kommunistischen Jugoslawien aufzuwachsen, und kehrte nach Wien heim. Und so schwer die Nachkriegszeit auch sein mochte – für Milan war sie ein Paradies. Mit 12 Jahren war er eingebürgerter Österreicher, der zum Entsetzen seiner Verwandten (sein Onkel durfte als „Genosse Baron“ dem Tito-Staat seine Fähigkeiten als Landwirt und Weinbauer zur Verfügung stellen) auch nach und nach sein Kroatisch vergaß.
Es sind eindrucksvolle Schilderungen, die Turkovic von der Besatzungszeit liefert, von den Resten der Nazi-Ideologie, die noch in den Köpfen spukte (wie er in der Kadettenschule in Graz-Liebenau wohl merkte), vom Erwachen seines politischen Bewusstseins, von seinem Europäertum, das sich aus den Identitäten seiner Vorfahren speiste. Nebenbei erfährt man vom Schicksal der Mutter, die im Nachkriegs-Wien zwar in Künstlerkreisen verkehrte, ihre Karriere aber nie wieder beleben konnte…
Milan wurde Musiker, warum Fagottist? Die Frage wird ihm immer wieder gestellt, die ehrliche Antwort ist wohl, dass bei diesem Blasinstrument (und ein solches sollte es von seiner Begabung her sein) die Berufschancen am größten waren. Und da erfährt man nun eine Menge aus einem bewegten Künstlerleben als Orchestermusiker, Solist und schließlich Dirigent.
Amüsant sind die Erinnerungen an die „Philharmonia Hungarica“, ein echtes „Flüchtlings-Orchester“, in das sich auch, wenn in einer Instrumentengruppe etwa ein Musiker fehlte, einmal ein Pole oder, wie Turkovic, ein halber Kroate einfinden konnte. Das Ensemble hatte viel Erfolg, aber Turkovic zog weiter, spielte bei den Bamberger Symphonikern, unternahm mit einer Kammermusikvereinigung eine unvergessliche Tournee durch Afrika, und landete schließlich bei den Wiener Symphonikern, die damals, in den sechziger, siebziger Jahren noch unter dem „Philharmoniker-Komplex“ litten.
Wichtig für ihn war auch die Arbeit mit dem Concentus Musicus (wobei er als Hörer komplett verwirrt war, als er erstmals mit den Originalinstrumenten konfrontiert wurde) – und da er mittlerweile auch viel dirigierte, war er doch etwas enttäuscht (er gibt es offen zu), dass nach Harnoncourts Tod niemand an ihn dachte… zumindest für die Übergangszeit.
Turkovic kann viel erzählen, über die Arbeit in Orchestern, über Dirigenten, Komponisten (man hat viel für ihn und sein Fagott geschrieben), über das, was man als Lehrer vermittteln kann, über Tourneen, Begegnungen… und Misserfolge. Als er ein Musikquiz für den ORF moderierte, war er nicht sehr erfolgreich.
Das konnte seine zweite Frau besser, Ingrid Wendl, die erfolgreiche Eisläuferin mit der danach folgenden großen ORF-Karriere. Über seine missglückte erste Ehe und die Schmerzen, die ihm die Trennung von seinem Sohn bereitete (die Ex-Gattin ging mit dem Kind nach Amerika), spricht er ganz offen. Es ist überhaupt ein ehrliches Buch. Und eines, das sich überhaupt nicht aufplustert. Milan Turkovic hat sich alles, was er erreicht hat, erarbeitet. Und er ist von einer Gelassenheit und Ausgewogenheit des Urteils, die die Lektüre zum Genuß machen.
Renate Wagner
P.S. Was die Gerüchte betrifft, Pavarotti hätte keine Noten lesen können, berichtet Turkovic eine Anekdote:
Bei einem Abendessen während des Festivals in Ravenna deklarierte sich Ingrid ihrem Tischnachbarn Riccardo Muti gegenüber mit der entschuldigenden und offenherzigen Gesprächseröffnung, sie könne nicht Noten lesen. Woraufhin der exzellente und geistreiche Gastgeber gentlemanlike erwiderte: „Signora, da haben Sie aber immerhin etwas mit Luciano Pavarotti gemeinsam.“

