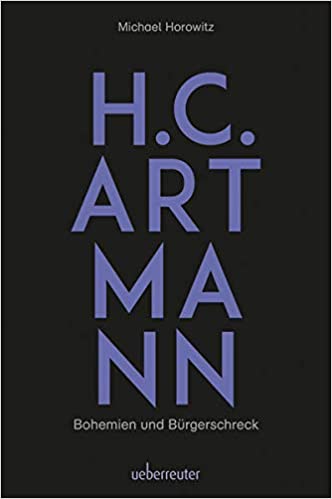
Michael Horowitz
H. C. ARTMANN
Bohemien und Bürgerschreck
208 Seiten, Verlag ueberreuter, 2021
Wenn ein Biograph den Künstler, über den er schreibt, persönlich gekannt hat, so gut gekannt, dass er als Freund behandelt und ihm vieles aus erster Hand erzählt wurde, hat er einen evidenten Vorteil. Michael Horowitz hat schon vor zwei Jahrzehnten, rund um den Tod von H. C. Artmann, ein Buch über ihn geschrieben. Nun gibt es zum hundertsten Geburtstag die erweiterte Neufassung dieses so bunten Lebensberichts.
„HC“ – man weiß eigentlich nicht, was die Initialen bedeuten, jedenfalls nicht Heinz Christian. Artmann wurde als Hans Carl am 12. Juni 1921 in Wien geboren und starb am 4. Dezember 2000 in derselben Stadt. Geboren in „Breitensee“, einem regelrechten Armenviertel im 14. Bezirk, endete er in einer Großbürgerwohnung in der Josefstadt, wollte allerdings, wenn er an seinen Tod dachte, alles nur kein Ehrengrab am Zentralfriedhof. Heute erinnert ein schlichter Stein im Urnenheim der Feuerhalle Simmering an ihn.
Wer „Artmann“ sagte, wusste oft nicht viel mehr als die „schwoazze dintn“, mit der er berühmt geworden war, und hatte einen absolut skurrilen, dünnen, schlaksigen Mann vor Augen, der gelegentlich öffentlich auftrat. Mundart-Dichtung gab es immer, aber was bei Josef Weinheber als Wiener Dialekt galt, war nicht wirklich „aus der unteren Lade“. Das schaffte H. C. Artmann in der Nachkriegszeit. Das „Breitensee“, aus dem er stammt, ist für ihn „Bradnsee“. Seine Werke machen es dem Leser nicht leicht, er muss sie wahrscheinlich laut deklamieren, um hinter scheinbar sinnlosen Buchstaben die Dialektworte zu finden… Aber was man dann las, überzeugte.
Der Sohn eines Schusters, der in der Schule im „B-Zug“ gewesen war, entwickelte ein wunderbares Gefühl für Sprache. Wie er es autodidakt schaffte, in der Nachkriegszeit Dolmetscher bei den Amerikanern zu werden, später aus dem Französischen (Villon!) und Spanischen zu übersetzen und sich außerdem mit dem Aramäischen oder dem Assyrischen und noch vielen seltsamen Sprachen mehr zu beschäftigen… es bleibt ein Rätsel wie so viel bei ihm, der sich auch gerne hinter Geschichten und Identitäten versteckte.
Das Buch von Horowitz erzählt nicht nur die Lebensgeschichte von einem, der – ähnlich wie sein Freund Qualtinger – aus tiefster Seele antibürgerlich lebte und arbeitete. Er ist auch meisterlich darin, Milieus und Zeiten zu schildern – das Aufwachsen im Multi-Kulti-Prolo-Breitensee, das Gefühl der Nachkriegszeit mit ihren Nöten und Ideologien. Man geht mit Artmann ins Burgtheater im Ronacher statieren und zieht mit ihm durch die Cafés, landet im Hawelka und ist mitten drin in dem Wirbel, den die „Wiener Gruppe“ in den fünfziger Jahren samt ihren Happenings veranstaltete. Achleitner, Artmann, Bayer, Rühm, Wiener – sie rannten gegen dumpfe Bürgerlichkeit an „mit umwälzenden Aktionen gegen so gut wie alles Bestehende.“ Der Großteil der Mitwelt begegnete ihnen (wie auch den bildenden Künstlern dieser Zeit) mit blankem Unverständnis.
Artmann wurde nach und nach nicht nur beschimpft (und von der Steuer verfolgt, von der Polizei wegen Randalierens mehrfach einkassiert). Sondern auch sehr berühmt, schrieb viele Bände mit Gedichten, viele kleine Theaterstücke, Balladen und Aufzeichnungen (die er „Montagen und Sequenzen“ nannte). Essays und Prosa. Immer wieder Übersetzungen: Der Anhang des Buches mit dem Werkverzeichnis ist lang.
Und irgendwann hielt er es im Wiener Kulturschickeria-Mief nicht mehr aus. Wenn es um seine ausführlichen Reisejahre geht, wird das Buch, das sonst so viel Detailliertes liefert, eher dürftig. Immerhin weiß man, dass London, Berlin, Stockholm Stationen waren, bevor er sich in Graz, in Salzburg und ganz am Ende wieder in Wien niederließ.
Im Lauf seines Lebens haben ihm fünf Frauen fünf Kinder geboren. Ehrungen häuften sich. Als er starb, war er ein anerkannter Dichter, wohl aber auch als Wiener Kuriosität eingeordnet. Durch Dialekt zur Poesie, zur Fantasie, zum Surrealen geführt zu haben, betrachtete er als seine Leistung. Er wollte die Leser einfangen, und bei vielen ist es ihm gelungen.
Immer spürt man bei diesem Buch, dass da neben der soliden Recherche die ungemeine Lebendigkeit des Berichteten steht. Wie mit einer Zeitkapsel taucht man in die Vergangenheit, wie sie einem lebendiger nicht entgegen kommen könnte.
Renate Wagner

