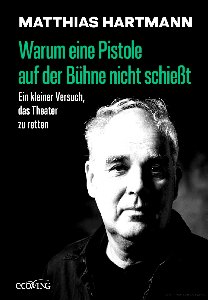
Matthias Hartmann:
WARUM EINE PISTOLE AUF DER BÜHNE NICHT SCHIESST
Ein kleiner Versuch, das Theater zu retten
192 Seiten, Verlag ecoWing. 2024
Glaubt man ihm jetzt endlich?
Es gab zwar vereinzelt Leute, die sich für ihn eingesetzt haben, aber es nützte nichts: Das Burgtheater hat die Karriere des Matthias Hartmann nachhaltig zerstört. Mittlerweile sind zehn Jahre seit seinem unrühmlichen Abgang von dem Haus vergangen, und nun schien es ihm an der Zeit, einige Dinge klar zu stellen.
Seine Memoiren, die er in Wien begreiflicherweise nicht am Burgtheater, sondern in den Räumen der Josefstadt vorgestellt hat, tragen den gewissermaßen „allgemeinen“ (und im Grunde nicht ganz glücklichen) Theatertitel; „Warum eine Pistole auf der Bühne nicht schießt“. Aber man greift – vor allem in Wien – natürlich aus anderen Gründen nach dem Buch.
Bevor man konkret über Hartmanns Burgtheaterzeit und den Finanzskandal nachlesen kann, der ihm das Genick gebrochen hat, obwohl seine Unschuld an unrechtmäßigen Zahlungsvorgängen später bewiesen und bestätigt wurde, zerbricht sich Hartmann den Kopf über die Theater heute. Ausführlich, Länge mal Breite. Das ist sein Thema, auch wenn er dann autobiographisch wird: Hartmann lässt den Leser an den schier unglaublichen Umwegen teilnehmen, die ihn zum Theater führten,
Zwar wollten in seinem Fall die Eltern, dass er Künstler werde, aber der 1963 in Osnabrück geborene Junge wollte das gar nicht (und mutete ihnen allerlei zu, bis er doch „Künstler“ wurde). Er war ein schlechter Schüler, ein träumerisches Kind mit wenig Realitätsbezug. Vier Jahre Internat in England, kurzzeitig Lehre als Maschinenschlosser (!), kurzzeitig in einem Öko-Laden, Herumtreiben in Italien („Lebte von altem Brot und geklauter Salami und landete vollkommen pleite auf der Insel Elba“). Wieder in der Schule in Deutschland (man braucht ja einen Abschluß), war es so weit – Jung-Hartmann gründete eine Theatergruppe. Und dann Schritt für Schritt: Schauspielhaus Hamburg, lernt an Schauspielern, lernt das Handwerk, Hospitanz in Berlin, an der Schaubühne bei Peter Stein. „Als ich wusste, dass ich ans Theater gehöre, habe ich versucht, jede verschlossene Tür aufzustoßen.“ So marschiert man mit Hartmann, locker erzählt, durch sein Theaterleben. Mit herrlichen Episoden – etwa den Umgang mit Peter Zadek…
Hartmann verschweigt nicht, wie viel man „intrigieren“ muss, um sich selbst auf einen Direktorensessel zu hieven. Freunde mobilisieren. Auf positive Berichte im Feuilleton hoffen. Und – beim Kulturdezernenten in Bochum direkt anrufen. Da bekam er den Job im Jahr 2000. Hartmann wollte als Intendant „funkeln und begeistern“ und schaffte es, das Publikum zu interessieren, indem er es herausforderte. Denn dass Menschen ins Theater kamen und wieder kamen und wieder kamen, war sein Credo (und ist es bis heute – was wenige Kollegen mit ihm teilen). Theatertheoretische Überlegungen spielen eine große Rolle in dem Buch, werden immer wieder ins Biographische hinein geschoben.
Ist man einmal Intendant, befindet man sich in einem Ranking-Spiel. Die Kryyptowährung, wie Hartmann sie nennt, heißt „Bedeutung“. Der Autor erklärt vieles über das „Drei-Blöcke-Kraftwerk– Fachjournalisten, Kulturpolitiker und Theaterstrategen“, die Karrieren machen und verhindern.
Für die Theatermacher besteht die Hierarchie in Hamburg, Berlin, München. Irgendwann auch Wien. Hartmann kam zunächst nach Zürich, dann endlich, ab September 2009, an das Burgtheater (wo sich damals auch Kusej beworben hatte und Breth und Baumbauer). Da fühlt man sich am Ziel.
Also erzählt Hartmann „noch mal die fucking Geschichte mit der Burg“, aus Vorsicht nicht immer mit Klarnamen. Interessiert es noch so sehr? In Hartmann wühlt sie natürlich, die große Ungerechtigkeit, die sein ganzes Leben umkrempelte und seine Karriere beendete (auch wenn er noch so hohe Worte für die Tätigkeit bei Mateschitz findet). „Entscheidend ist, dass ich am Ende rausgeflogen bin.“
Er will nicht pathetisch und larmoyant klingen, wenn er von der „schmerzenden Ungerechtigkeit“ spricht. Schließlich resümiert er: „Das Eigentümliche an der Burgtheater-Geschichte ist die Art, wie dieser Fall nicht aufgeklärt und alle Spuren aus der Vergangenheit verwischt sind.“
Schließlich erzählt er doch mit viel Ironie und in aller Ausführlichkeit vom Burgtheater. Das ganze Gemauschel inbegriffen. Und Interna, die den Umgang mit Schauspielern ebenso betreffen wie die Aktionen der „lieben Silvi“, die das Finanzielle regelte. Er erzählt von der Jagd, die „Profil“ und ORF auf ihn eröffneten, auf den vielen so unsympathischen lauten Deutschen. Ein Fest für die Medien, die sich überschlugen. Es liest sich fast wie ein Krimi. Dazu gibt es am Ende noch 20 Seiten mit Materialien zu der „Affäre“. Glaubt man Hartmann jetzt endlich, dass er an allen finanziellen Fehlverhalten der „Burg“ unschuldig und unbeteiligt war? Wenn man sein Buch gelesen hat – ja.
Und doch flog er ehrlos aus dem Job. Für den so tief Gefallenen wurde es schlagartig still. Es ist eine klassische Erfahrung. Vielen Kollegen hatte er geholfen. „In dem Moment, als ich jetzt dringend Hilfe brauchte, meldete sich niemand bei mir.“ Nur Dietrich Mateschitz fing ihn schließlich auf. Und da ist man schon in der Gegenwart.
Es ist ein Buch, dem man die Erleichterung des Autors nachfühlt. Endlich einmal die Meinung sagen dürfen. Nicht mehr in dem Pulk jener zu stecken, die sich nur behaupten können, wenn sie woke politische Korrektheit pflegen. Hartmann schreibt gegen etwas an, das er als Fehlentwicklung betrachtet, was aber derzeit so fest etabliert ist, dass kein Widerspruch mehr gewagt wird, auch wenn viele insgeheim genau so denken. Aber man hat gelernt, den Mund zu halten.
Hartmann, der gelegentlich in Italien Oper macht, hat, obwohl erst 61jährig, seine große Theaterkarriere an den deutschsprachigen Zentren vermutlich abgeschrieben. Allerdings – er wird zum Abschluß der Ära Föttinger an der Josefstadt den „Theatermacher“ inszenieren, einigermaßen sicher mit dem Direktor Föttinger selbst als Hauptdarsteller. Dann wird er zumindest solcherart im Geschäft sein, dass die Medien ihn wieder wahrnehmen – so wie jetzt anlässlich seines Buches.
Renate Wagner
ALSO SPRICHT MATTHIAS HARTMANN:
Ich bin ein treudoofer Niedersachse, ich kann diese geschmeidigen politischen Manöver nicht so gut
Theater ist das Fitnesscenter für die Fantasie.
Theater sind Orte, wo Narzissmus und Hybris oft die Grundmotivation für künstlerische Arbeit bilden.
Theater ohne Führung wird ein Ort, in dem Befindlichkeiten ausgelebt werden. Aus Angst spricht man inzwischen am Theater leise und vorsichtig. Nichts darf gesagt werden, was falsch interpretiert werden könnte. Ein Kompliment könnte übergriffig sein.
Man muss auch nicht Texte aus der aktuellen Kriegsberichterstattung mit einer antiken Tragödie verschränken, um zeitgemäß zu sein.
Das Problem ist das Theater der Wohlmeinenden. Für sie ist die gute Absicht schon der Beweis für Qualität. So wird Theater ein Versteck für Dilettanten, die sich hinter wohlmeinendem Konsens verschanzen. Sie machen das Theater zu einer Insel, auf der außer ihnen bald niemand mehr wohnt.
Warum hat das Publikum keinen anderen Hebel, als wegzubleiben? Wie kann man die Stimme des Publikums gleichwohl vernehmbar werden lassen?
Regisseure wollen Geschichten erzählen und Welten entwerfen. Natürlich, geschenkt, aber das ist nur die Hälfte. Sie wollen Publikum, sie wollen Menschen überzeugen, ihnen zuzuschauen, sie haben eine Sehnsucht nach Publikum. Mehr als Kunst ist Theater Kommunikation
Dass Bedeutung eine relevante Währung ist, ist nichts Neues, in den 70er-Jahren haben machthungrige intellektuelle Diskursführer wie Professor Henning Rischbieter und Dramaturg Ivan Nagel eine Krypto-Währung erfunden, mit der man für den Erfolg am Theater mit Bedeutung bezahlt wird. Die Kulturjournalisten boten den Theatern einerseits und den Kulturpolitikern andererseits die Plattform für deren Bedeutung.
Viele Theaterleute dieser (älteren) Generation haben einen Beißreflex, der instinktiv funktioniert. Claus Peymann, Peter Stein. Die ganze Generation hatte auf diesem Wege ihre Karrieren gemacht. Ihr theatralisches Talent war das eine, das andere war die brutale Ausübung von Macht. Nur darum ging es. Nicht um das Thema, nicht um Kunst, nichts Bewusstes übrigens, nur ein Reflex. Das Gerechtigkeitsgetöse, mit dem die Peymänner, die Steins und Flimms sich vermarkteten, stand im Widerspruch zum autoritären Führungsstil, mit dem sie ihre Theater drangsalierten.
Ich behaupte, dass es im deutschen Kulturraum höchstens eine Handvoll Regisseure gibt, die das technische Können besitzen, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu fesseln.

