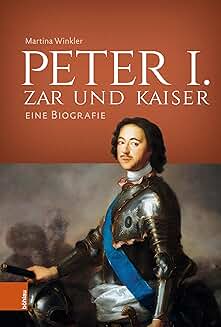
Martina Winkler:
PETER I.
ZAR UND KAISER
EINE BIOGRAFIE
545 Seiten, Verlag Böhlau, 2024
Die „Größe“ abgeschminkt
Es sind gar nicht so viele Herrscherpersönlichkeiten der Geschichte, die mit dem Beinamen „der Große“ versehen werden. Alexander der Große. Friedrich der Große, Katharina die Große. Ja, und auch „Peter der Große“. Nur, wie man erfährt – dieser Herrscher hat sich die Bezeichnung selbst gegeben… Und auch sonst ist eigentlich vieles anders gewesen, als man es kennt. Das zumindest ist das Ergebnis der neuesten Biographie aus der Feder der deutschen Historikerin und Osteuropa-Spezialistin Marina Winkler, die die Person von Peter, nicht nur in der russischen Biographik hoch geschrieben, „nach unten“ zurecht rücken will. Peter, die russische Symbolfigur für die Macht des Landes, vom Podest gestoßen.
Wenn eine Biographie über diesen Zaren nun schon im Titel einfach nur „Peter I.“ postuliert und auf den sicher wirkungs- und zugkräftigen Beinahmen verzichtet, ist das zweifellos Konzept. Martina Winkler stellt die Frage nach der fehlenden „Größe“ im Titel gleich im Vorwort. „Die Entscheidung gegen den spektakulären ‚Peter den Großen‘ fiel schnell. Sie hat viele Gründe, wissenschaftliche ebenso wie politische. (…) Wer in den Jahren 2022 und 2023 eine Biografie Peters schreibt, während Russland einen grausamen neoimperialen und genozidalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, muss sich viele grundsätzliche und kritische Fragen stellen:“
Wenn also Wladimir Putin, wie es heißt, sich diesen Zaren Peter als Vorbild nimmt, der in seinen Expansionsbestrebungen in den Norden (gegen Schweden) und in den Süden (gegen die Osmanen) so rücksichtslos vorging, färbt das offenbar auch auf heutige Wertungen ab.
Dabei ist Peter ja gerade in Deutschland eine singspiel-beliebte Figur, der Zar aus Lortzings „Zar und Zimmermann“, was zu dem reichen Anekdotenschatz zählt, mit der die Figur des Zaren popularisiert wurde. Wie entsetzt man in Europa über sein Verhalten war, als er und sein Hofstaat auf den hiesigen Höfen einbrachen, wurde hier nicht behandelt. Ein Barbar – dem ja dennoch ungeheures Interesse an der westlichen Welt nicht abzusprechen ist.
Wie brutal er seinen Fortschrittswillen durch setzte, ist (neben seinen Eroberungsgelüsten) für Nachfahren Putin, der mit seinen Feinden auch nicht glimpflich umgeht, zweifellos ein Element für Peter…
Und doch, ein Mann, der eine Stadt wie St. Petersburg begründete, deren Pracht, Schönheit und Eleganz bis heute überwältigt? Ganz abgesehen von vielen Leistungen auf verschiedenen Ebenen, ob er eine russische Flotte schuf, ob er die Grundlage für eine Akademie der Wissenschaften legte.
Kann man Peters Errungenschaften klein reden, weil heute nicht gefällt, dass ein Mann die absolute Macht, die er besaß, auch ausnützte? Und kann man unsere Moral, die zwar auf Putin anwendbar ist, auch auf das 17. / 18 Jahrhundert zurück brechen (bedenkt man etwa, wie rücksichtslos Friedrich „der Große“ seine Ländereien auf Kosten Maria Theresias erweiterte)? Zeitgeist urteilt anders als die Nachwelt. Und welcher Herrscher, der es sich leisten konnte, hat auf jene „Machtdemonstration, auf propagandistischen Selbstdarstellung und Mythos-Bildung“ verzichtet, die der Autorin an Peter so sauer aufstößt?
Unser „moralisches“ Denken von heute läuft Gefahr, schlechtweg ahistorisch zu agieren. Was selbstverständlich die kritische Betrachtung eines Mannes, den Rußland bis heute verherrlicht, nicht ausschließen soll (und die es in der russischen Literatur- und Geistesgeschichte, siehe Puschkin und viele andere mehr, ja auch schon gegeben hat).
Dem Bild Peters in der russischen Geschichtsschreibung, seine Instrumentalisierung, um die Großmacht Rußland zu definieren, widmet die Autorin breiten Raum im Vorwort, um ihre Neubewertung zu erklären. Dann erzähle Martina Winkler eine Lebensgeschichte ohne Superlative, kein „Großer“ als Programm, mit dem man Rußland selbst zu Heldenhaftigkeit, Stärke und Größe erhöhen kann, sondern ein Mann, der seine Chancen erkannte und sich gegen zahllose Widerstände durch setzte, wobei er schon als Kind in die wildesten Familienfehden geriet. Immer wieder hatte es Peter mit gewaltigen Machtblöcken zu tun, die er in Schach halten musste. Er führte einen Teil seines Lebens Kriege, lebte seine Vorliebe für das Meer militärisch aus, begann an seinem eigenen „Bild“ zu arbeiten.
Die Neugierde und der Wissensdurst, die ihn auszeichneten, kann man ihm nicht absprechen, die Lust am Lernen, Erforschen und den Wunsch, das er auch anderen zu vermitteln (seine Bildungsprojekte). Dennoch ging es vor allem um Macht – sollte Putin ja das Baltikum oder Finnland „zurückholen“ wollen, könnte er sich auf Peter berufen.
Keine messianische Strahle-Figur also, sondern ein Gewaltpolitiker. Kein anekdotenumrankter großer Staatsmann, sondern ein klarer Egozentriker. Der allerdings in eine Welt von so wilden Intrigen und Machtkämpfen eintrat, dass man ohne die nötige Härte gar nicht überleben hätte können. Feinde musste man beiseite räumen, selbst wenn es der eigene Sohn war. Ideen und die damit verbundenen Veränderungen wurden mit Gewalt durchgesetzt, Und wenn Peter zu Eroberungen auszog, nannte er es „Rückholung“ von russischem Gebiet (ein Argument, das schon mit der Krim und jetzt mit dem Ukraine-Überfall wieder gekehrt ist).
Und doch fragt sich der Leser – sind seine Leistungen, wie man sie bislang verbürgt glaubte, nur auf Propaganda zurück zu führen? Ist Peter einfach nur den Entwicklungen der Zeit gefolgt, hat er nur Taten gesetzt, die es ohne ihn auch gegeben hätte? Ist „sein“ Rußland nur Teil globaler frühneuzeitlicher Dynamiken? Die Autorin wagt die Überlegung, er sei in der Geschichte „dramatisch überschätzt“ worden. In ihren Augen ist das Bild von Peter als aktivem, mutigem, weltoffenem Herrscher schlechtweg falsch.
So steigt Zar Peter I. aus diesem Buch als Exempel des Totalitarismus. Einer, der seine absolute Macht nicht zum „Guten“ gebrauchte, sondern aus unserer Sicht zum gewalttätig Schlechten. Jedenfalls ein „starker Führer“. Ein Vorbild? Man weiß, wen die Autorin diesbezüglich kritisch im Auge hat. Der Leser hat die Möglichkeit angesichts dieser Interpretation nach eigenem Ermessen abzuwägen.
Renate Wagner

