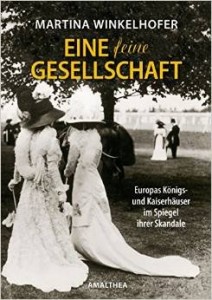
Martina Winkelhofer:
EINE FEINE GESELLSCHAFT
Europas Königs- und Kaiserhäuser im Spiegel ihrer Skandale
304 Seiten, Amalthea Verlag, 2014
Das Interesse für Geschichte erstreckt sich bei hehren Geistern auf große Entwicklungen und Zusammenhänge, während schlichtere Gemüter sich einfach für Menschen interessieren (was ja auch nicht so schlimm ist). Daraus erklären sich die vielen „Hintergrunds“-Berichte aus königlichen Familien und Betten, was wiederum im Niveau ganz unterschiedlich ausfallen kann. Die Arbeiten von Martina Winkelhofer basieren auf gründlicher Recherche der Quellen (sonst würde die Kulturabteilung der Stadt Wien hier nicht sponsern), und wenn manches, was sie zu berichten hat, auch auf geradezu journalistische Art spektakulär erscheint, so basiert es doch – und das ist tragisch – auf Tatsachen.
Diese besagen, was man inzwischen längst weiß (selbst die albernsten Teenager, die davon träumen, einmal „Diana“ oder „Kate“ zu sein), dass es nämlich kaum ein schlimmeres, undankbareres Schicksal gibt, als in eine Königsfamilie hineingeboren zu werden. Die Freiheiten sind (zumal für die Frauen) gleich Null, die Pflichten erdrückend, die Beobachtung, der man ausgesetzt ist, hört rund um die Uhr nicht auf. Wobei man hinzufügen muss, dass Martina Winkelhofer sich mehr oder minder auf das europäische 19. Jahrhundert beschränkt, wenn sie unter dem Titel „Eine feine Gesellschaft“ nicht weniger als „Europas Königs- und Kaiserhäuser im Spiegel ihrer Skandale“ darstellt. Manches davon mag, in variierter Form, noch heute gelten.
Zu den erschütterndsten Kapiteln zählt gleich das erste, Kindheit und Kinderstube, wobei es natürlich eine Pointe der grauenvollen Art ist, dass Queen Victoria einige ihrer Kinder einer Amme anvertraute, die ihre eigenen Kinder ermordet hatte… Nun, wie sollte man es wissen. Aber dass das Personal, das für die Kinderstuben engagiert wurde, keinerlei Befähigungsnachweis erbringen musste, und dass es Beispiele für geradezu sadistisches Verhalten gab (angeblich soll Englands Stotterkönig, der Vater von Queen Elizabeth II., von bösen Kindermädchen so terrorisiert worden sein, dass er dieses Trauma mit sich trug), das ist auch dann ein Kopfschütteln wert, wenn man verändertes Bewusstsein zugrunde legt.
Die wenigstens „Königskinder“ hatten eine glückliche Jugend, viele eine extrem unglückliche, manche sind bekannt und ausführlich recherchiert wie jene des Kronprinzen Rudolf, der von seinem Vater in männlich-soldatische Rollenklischees gepresst werden sollte, die seinem Charakter zuwider liefen, grausame Zwänge, die zweifellos in das weitere Leben negativ ausstrahlten.
So ist es auch kein Wunder, dass sich ein ganzes Kapitel den einigermaßen „missglückten“ Thronfolgern und Kronprinzen widmet, von denen nur Habsburgs Rudolf nicht auf den Thron kam, wohl aber Wilhelm II. in Preußen, Nikolaus II. in Russland und Edward VII. in England, wobei die Autorin die gerechtfertige Feststellung trifft, dass es ja keinerlei „Befähigungsnachweis“ für Königs gibt – das sind einfach Menschen, die in ihre „Rolle“ hineingeboren wurden und sie auszufüllen hatten, ob sie dazu imstande waren oder nicht.
Wobei Könige in Wartestellung, zumal bei langlebigen Eltern (wie Franz Joseph oder Queen Victoria) meist ein sinnlos hedonistisches Playboy-Leben führten, weil für sie ja keine richtige Aufgabe vorgesehen war. (Prinz Charles lebt es derzeit im Schatten der Queen vor – ein Mann, den keiner will und braucht und der ja doch einmal König sein wird, nur dass die Möglichkeiten, die Herrschern im 19. Jahrhundert noch offen standen, längst auf Null geschmolzen sind und sie heute nur noch Repräsentations-Marionetten für die Regenbogenpresse darstellen.)
Schlimmer noch als die Männer, die zumindest die „männlichen Freiheiten“ genossen, die ihnen die Ungleich-Gesellschaft damals zugestand, hatten es die Prinzessinnen, Erzherzoginnen, Großfürstinnen getroffen, die nur als Heiratsmaterial betrachtet und „wie Pferde begutachtet“ wurden, wie es heißt. Ehelosigkeit stürzte diese Frauen an den Höfen von Vätern und Brüdern in die Rolle hoffnungsloser Outcast, verachtet und belächelt, also ließen sich viele schweigend in „dynastische“ Beziehungen stecken, die ihr eigenes persönliches Unglück beinhalteten. Wollte eine Frau aber ein selbst gewähltes Schicksal leben – die Beispiele, dass es gelang (wie Therese von Bayern, die eine anerkannte Wissenschaftlerin wurde), sind in der Minderheit.
Wenn Menschen nun an den Ketten rüttelten und sich dynastischen Ehen und Pflichten nicht fügen wollten, wurden sie oft aus dem Familienverband ausgestoßen oder sorgten für die süffigsten Skandale (Zeitungen, die dergleichen breittraten, gab es damals schon). Wie viel Geld für Kurtisanen und leichte Damen ausgegeben wurde – nun ja, Fürsten sind auch nur Männer.
Vieles in dem Buch Dargestellte ist bekannt, Martina Winkelhofer hat sich aber auch über Schicksale, die weniger populär wurden, gekümmert, und man kann zweifelsfrei sagen, dass auch jene, die sich im Thema auskennen, hier so manches Neue und auch Relevante erfahren werden. Schließlich ist dieses einstige höfische Leben aus der historischen Entwicklung nicht wegzudenken und ein legitimer Teil der Geschichte und Geschichtsbetrachtung.
Renate Wagner

