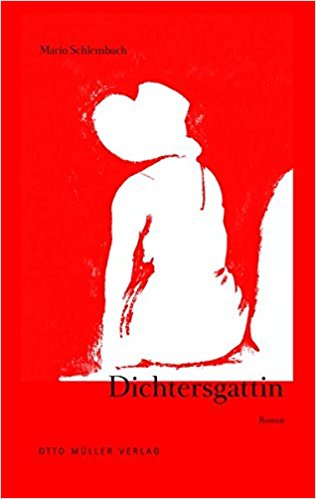
Mario Schlembach:
DICHTERSGATTIN
Roman
228 Seiten, Otto Müller Verlag, 2017
Man fühlt sich von Anfang an total vertraut mit Thema und Tonfall – als Leser springt man gewissermaßen in den Monolog einer Frau, die zu einer typisch österreichischen Schimpftirade ansetzt und diese ohne Unterbrechung durchzieht…. Offenbar ist sie mit ihrem Gatten Hubert, den sie dauernd anspricht, bei der Biennale in Venedig. Und dort gefällt ihr gar nichts, vor allem nichts von dem, was der Österreich-Pavillon zu bieten hat.
Von Seite 7, als das Buch beginnt, bis Seite 226 haben wir es mit etwas zu tun, das wir nur zu gut kennen, weil Bernhard bis Jelinek und viele Nachahmer dazwischen es immer wieder geliefert haben: ein geistig mittelbemitteltes, aber sich selbst so großartig, überlegen und unfehlbar vorkommendes bürgerliches Welt- und Kunstverständnis Wiener Prägung.
Das gibt Schmipftiraden über so gut wie alles, die Dame ist empörte Leserbriefschreiberin, nieder mit den Sozialschmarotzern, und früher war sowieso alles besser. Am wichtigsten aber ist die Kultur, wobei das Theater eine besondere, das Burgtheater gar die zentrale Rolle spielt. Wenn die Dame Hedwig allerdings auf die Ronacher-Zeiten (!) zurück blendet, fragt man sich, wann das spielt und wie alt die „Schimpferin“ ist. Erst am Ende erfährt man es: Sie ist 90, denn ihr eben verschiedener Gatte (ein „Tod in Venedig“, tatsächlich) war 85…
Dass Hubert während der Biennale stirbt und Hedwig den Monolog an seiner Leiche hält, ist eine „Pointe“ dieses Buchs von Mario Schlembach, die sich nach und nach herausschält. Hubert ist das Objekt ihrer lebenslangen Unzufriedenheit, denn er hat absolut nicht so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt hat. Als sie den jungen Mann aus dem Dorf in die Stadt holte, hielt sie ihn für einen potentiellen Dichter. Dichtersgattin wollte sie sein, er sollte ihre Träume erfüllen und das Burgtheater erobern. Aber er hatte eigentlich nur ein einziges Interesse im Leben, und das waren Begräbnisse: Er war Bestattungsangestellter, kein Dichter ist aus ihm geworden, ihr Hochkulturfanatismus konnte ihn nicht in ihre Richtung verbiegen. (Der Autor führt in seiner Vita übrigens auch die Berufe von Bestattungshelfer und Totengräber an, ist also Fachmann – für Hubert.)
Alles musste sie ihm beibringen, sprechen (der Dialekt!), essen, das Kulturleben. Unvorstellbar, mit welcher ermüdender Ausführlichkeit man das Burgtheater, die Burgschauspieler, die Burgtheater-Mentalität umkreisen kann, aber Hedwig tut es unaufhörlich, gewissermaßen ohne Luft zu holen. Da gibt es Meinungen aller Art, über Handke, Bernhard, Peymann (er hätte die nicht vorhandenen Stücke von Hubert inszenieren sollen!). Tatsächlich aber, sie macht sich nichts vor, hat sie den Gatten nur ins Burgtheater geschleppt, damit er da einschlafen konnte… (Und auf ihre Vorhaltungen hat er, wie es scheint, ohnedies gar nicht geantwortet…)
Natürlich kommt man auch auf den Faschismus, erst darf man Werner Krauss seine Juden-Figuren in „Jud Süß“ nicht übel nehmen, er hat sie ja nur gespielt, dann ihrem Vater nicht, dass er im Auftrag der Nazis Menschen vermessen hat.
Ja, und am Ende ist Hubert tot. So viel Arbeit hat sie in ihn hineingesteckt, und nichts ist aus im geworden. Soll man Hedwig jetzt bedauern? Wohl kaum, nachdem sie einem viele Lesestunden auf die Nerven gegangen ist. Und was die „Erkenntnisse“ betrifft, die sie der Welt mitzuteilen hat: Man hat das alles schon so oft gehört. Nicht nur einmal, viele Male zu oft. Und hier noch einmal…
Renate Wagner

