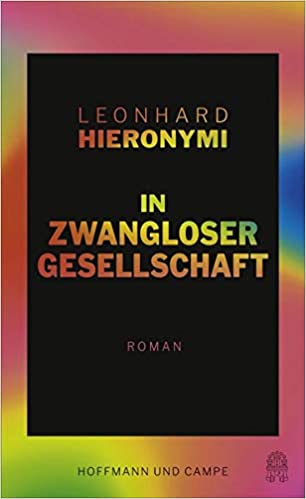
Leonhard Hieronymi
IN ZWANGLOSER GESELLSCHAFT
Roman
240 Seiten, Verlag HOFFMANN UND CAMPE, 2020
Wenn jemand sich vornimmt, innerhalb eines Jahres möglichst viele Dichtergräber zu besuchen, schmeckt das nach einem Sachbuch. Dieses wäre aber keinesfalls so locker zu lesen und auch so persönlich wie jenes geschriebene Road-Movie, das sein Autor Leonard Hieronymi als „Roman“ bezeichnet und das die Leichtigkeit seines Titels – „In zwangloser Gesellschaft“ – auf jeder Seite vermittelt.
Das auslösende Moment für dieses Gräber-Pilgern wirkt auf Anhieb vielleicht ein wenig albern, ist aber am Ende so gut wie jedes andere. Der Autor will einmal in der Katakombe des Heiligen Kallistus in Rom in einen solchen Lachkrampf verfallen sein, dass er die ganze Führung hier störte und sich nachher selbst genierte. Quasi zur Entschuldigung wollte er die Reise zu den „Unsterblichen“ und „Vergessenen“ antreten, indem er ihre Gräber aussuchte – Dichter und Schriftsteller wohl gemerkt, bei Mozart am St. Marxer Friedhof in Wien hielt es ihn nicht lange, der war schließlich Komponist.
Es ist keine trockene Aufzählung, die den Leser auf 240 Seiten erwartet, mitnichten. Leonhard Hieronymi, von Beruf Journalist, der hier seinen ersten „Roman“ vorlegt, streng eine Ich-Geschichte, ist mit Freunden und Verwandten unterwegs, erzählt locker auch von den Mühen des Reisens (und dem dazugehörigen Geplaudere), bevor man vor gesuchten Gräbern steht – oder auch nicht. Denn nicht alles hat er gefunden. Und oft war die Suche mühselig – was es natürlich noch spannender und unterhaltender macht, zumindest für den Leser. „Alle vergessen, alle tot“ – der Autor tut etwas dagegen.
Sein Radius war Europa, der Hamburger begann in Frankfurt, wo es genügend „Promis“ gibt, er aber wollte einen Vergessenen finden, Robert Gernhardt. Das macht er immer wieder, dass er die Berühmtheiten hintanstellt und jene sucht und besucht (ohne je Blumen zu bringen, wie er später erkennt), die ihm selbst etwas bedeuten. Er reflektiert rundum über die jeweiligen Begräbnisse, über das, was er über das Sterben der Besuchten weiß, über deren Beziehung zum Tod.
Das akkumuliert sich zu einer interessanten Fülle von Reflexionen zum Thema, gewissermaßen ist es auch ein Allerheiligen-Buch, wenn der Autor es nicht immer so locker nähme, so „zwanglos“, wie er die Gesellschaft der Toten empfindet. Selbst wenn er sich an Stephen Kings gruseligen „Friedhof der Kuscheltiere“ erinnert und der darin vertretenen Theorie der ewigen Wiederkehr. Der Tod ist ein Thema ohne Ende – solange man lebt.
In Hamburg-Ohlsdorf sieht er sich mit der unglaublichen Größe des Areals konfrontiert (da investiert man zur Orientierung wirklich besser in eine App am Smartphone) . Dort interessiert ihn vordringlich Roger Willemsen, über den er viel erzählt, und es ist – ja, es ist schön, dass jemand am Grabe Harry Rowohlts ein Fläschchen Johnny Walker deponiert hat, wenn es auch nur ein kleines und aus Plastik ist. Überhaupt – der Autor teilt mit jenen Lesern, die selbst mit Interesse auf Friedhöfe gehen, die Erkenntnis, worauf man stoßen kann, woran man sich erinnern kann, worüber man sich wundern kann…
Berlin, von Touristen überlaufen, die am Dorotheestädtischen Friedhof stur von einem Promi zum anderen wanken, wo doch jeder ein persönliches Gedenken wert wäre. (Immerhin ist auch Hieronymi Tourist, takes one to know one, aber er will nicht Namen abhaken, er will nachdenken.) Und als jungen Mann von heute interessiert den Autor nicht nur Brecht, sondern auch der „Tschick“- Wolfgang Herrndorf. Warum der sich wohl umgebracht hat? Und in Friedrichsdorf sucht Hieronymi Karl-Herbert Scheer, den Verfasser der Perry Rhodan-Romane: Man sieht, intellektueller Hochmut ist ihm fremd…
Man kann das Buch natürlich auch nach seinen eigenen individuellen Interessen lesen. Als Österreicher wird man den Kopf schütteln, wenn „Leopold Wölfling“, ein Habsburger aus der Toskana-Linie, als „Sohn von Kaiser Franz Ferdinand“ (einen solchen hat es nie gegeben) bezeichnet wird – aber immerhin erfährt man, dass dieser Aussteiger aus dem Kaiserhaus in Berlin-Kreuzberg gelandet ist.
Und wenn man sich selbst einmal nach Constanza durchgeschlagen hat, dem antiken Tomi, in der festen Hoffnung, das Grab von Ovid doch irgendwo zu entdecken – dann schildert Hieronymi hervorragend, wie absolut hoffnungslos solch ein Unternehmen im heutigen (diesbezüglich gänzlich desinteressierten) Rumänien ist. Aber bitte, es ist auch nicht leicht, in Prag dem Grab Kafkas in die Nähe zu kommen. Immerhin fand er andere Raritäten – Casanova auf Schloß Dux zum Beispiel, wen verschlägt es schon dorthin?
Dass ihn am Wiener Zentralfriedhof, der Fundgrube auch für Dichter, nur Ida Pfeiffer interessiert hat… nun, jede Auswahl ist individuell. Immerhin werden die Frauen nicht gänzlich vernachlässigt, auch mit Thea von Harbou beschäftig sich der Autor (Berlin-Westend, ein Prominentenfriedhof, wo er auch Gunter Gabriel findet, wie gesagt, auch Liedertexter werden mitgenommen.) Und in Mainz hat er immerhin – zum Thema Frauen – Ida Hahn-Hahn aufgesucht.
In Rom hat es begonnen, in Rom endet es, nicht nur am Protestantischen Friedhof bei Keats, Shelley und dem Goethe-Sohn (der echte Goethe und Schiller, der gar nicht neben ihm liegt, waren in Weimar immerhin einen Abstecher wert), sondern bei etwas Besonderem: Senecas Grab wird nicht jeder finden, aber Hieronymi hat dort einen ortskundigen Cousin…
Der Autor hat für den Leser viele Abenteuer bereit, schade, dass der Verlag sich nicht zu einem Register entschließen konnte – auch wenn es kein Sachbuch, sondern ein Roman ist, würde mancher Leser doch gerne schnell die Eintragungen über Thomas Bernhard finden (zumal der Autor überzeugt war, ihn eigentlich in der Straßenbahn gesehen zu haben – obwohl er doch schon lange tot war…) oder wie das war mit Fassbinder in Bogenhausen?
Aber man liest das Buch ohnedies vom Anfang bis zum Ende, und kann sich selbst Notizen machen – wenn man einmal hier und dort unterwegs ist, suchend auf Friedhöfe geht und den hier gewonnenen Anregungen folgen will.
Renate Wagner

