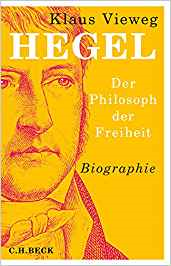
Klaus Vieweg:
HEGEL
Der Philosoph der Freiheit
Biographie
832 Seiten, Verlag C.H.Beck, 2019
Natürlich wird 2020 das Jahr von Ludwig van Beethoven sein, denn mit Musik erreicht man die Menschen der ganzen Welt nahezu umweglos. Aber auch ein anderer „Großer“, für die Nachwelt wie Beethoven ins Überdimensionale erstarrt, feiert seinen 250. Geburtstag, nur dass seine Zugänglichkeit beschränkt ist: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der „Großmeister neuzeitlicher Philosophie“. Der Mann, von dem schon Zeitgenossen bemerkt haben, seine Theorien seien eigentlich nicht zu verstehen. Der Mann, den andere in den Olymp hoben, als der Mann, der seine Philosophie auf den Grundpfeilern Vernunft und Freiheit errichtet habe.
Klaus Vieweg, Jahrgang 1953, Professor in Jena (wo Hegel von 1801 bis 1806 weilte), gilt als einer der profundesten Hegel-Kenner, hat Jahre seines Lebens damit verbracht, dessen Philosophie zu erforschen und zu interpretieren. Wenn er nun eine mehr als 800 Seiten schwere Biographie vorlegt (677 Seiten Text, der Rest Anhang), dann scheinen da mehrere Motive zu walten. Erstens, dem Interessenten Hegel wirklich nahezubringen – zuerst als Mensch, dann als Mensch in seiner Zeit, schließlich die Entwicklung seiner Philosophie, wie sie im Leben (das chronologisch behandelt wird) fortschreitet. Man mag als Leser Befürchtungen hegen, ein so schweres Buch sei auch in anderer Hinsicht zu schwer, aber Vieweg hegt offenbar auch eine Vorliebe für den Menschen Hegel und versucht den Mann, der von Gemälden nur mit ernstem, starrem Blick auf den Betrachter sieht, wirklich plastisch zu machen – und wenn er nur ausführlich über dessen Freude am Wein erzählt, das Trinken als Bestandteil des Wohlfühlens, die verschiedenen Weinsorten, die ihm mundeten. Und dass Hegel angeblich an jedem 14. Juli ein Glas Champagner auf die Französische Revolution gehoben haben soll… Anders als der gleichaltrige Beethoven (Hegel war 19, Beethoven noch 18, als die Revolution ausbrach), ist dem Philosophen der Fall des feudalen Systems, gleich gesetzt mit „Freiheit“, stets teuer geblieben, während der Komponist seinen Enthusiasmus für das Geschehene bald einbüßte.
Das Leben des Georg Wilhelm Friedrich Hegel nachzuzeichnen, ist spannender, als man für möglich halten sollte, einfach durch eine Bereitschaft zur Mobilität und steten Neuanfangs, die nicht jedem gegeben ist. Geboren am 27. August 1770 in Stuttgart als Sohn eines gehobenen Beamten und einer ungewöhnlich gebildeten Mutter (sie starb, als Wilhelm 13 war), erkannte man früh die außerordentliche Begabung des Jungen, der für die Theologie „zu schade“ schien. Seine Schulbildung war die beste, und er machte das Optimum daraus. Die erste Philosophie, die ihm sein damaliger Lehrer Jakob Friedrich Abel beibrachte, war die des „gesunden Menschenverstands“.
Wenn Hegel 1788 zu weiteren Studien nach Tübingen kommt, findet man den ersten der „feuilletonistischen“ Einschübe des Autors, wenn er – nach Quellen, aber doch fast romanhaft – einen Tag im Stift schildert. Ähnliche Darstellungen erscheinen nicht häufig, aber immer wieder in der Biographie, die auf Auflockerung der Schilderung bedacht ist. Apropos Tübingen, wo der wegen seines heiteren Wesens beliebte Hegel auch Mitglied in einem politischen Zirkel war. Erst die Nachwelt weiß wirklich zu bewundern, wenn hier drei junge Männer mit den Namen Hölderlin, Schelling und Hegel als Studenten ein Zimmer teilten – angesichts dessen, was sie alle für die deutsche Geistesgeschichte bedeuten sollten.
Nach den Tübinger Studienjahren war der 23jährige Hegel weit entfernt von seiner akademischen Zukunft. Die Biographie erklärt nicht wirklich, wie er zu seiner Stellung als Hofmeister bei einer reichen Berner Patrizierfamilie kam, nur dass es ihm dort sehr gut ging. Nach und nach nehmen „philosophische“ Zwischenkapitel größeren Raum ein, bevor es mit der Biographie weiter geht. 1794 verschaffte ihm Freund Hölderlin eine Stellung in der freien Reichstadt Frankfurt, als Hauslehrer in der Familie Gogel, die mit Wein ihr großes Geld machte. Auch hier ließ ihm die Stellung Zeit für seine philosophischen und anderen Studien. Der Tod des Vaters 1799 setzte Hegel in Besitz einer Erbschaft, die ausreichte, um sich endlich der ersehnten akademischen Laufbahn zuzuwenden. Wieder wechselte er den Schauplatz: 30jährig kam er nach Jena, „die Hauptstadt der Philosophie“, wo schon der ältere Freund Schelling zu finden war und Hegel in einem „paradiesischen Gartenhaus“ seine erste eigenständige Schrift verfasste, die „Differenzschrift“. Vom Winter 1801 an hielt er eigene Vorlesungen. Dass es in der deutschen Philosophielandschaft damals (wie immer) zu Spannungen kam, zeigte Hegels und Schellings gemeinsames Vorgehen gegen Fichte. Seine Begeisterung für Napoleon wurde auf eine harte Probe gestellt, als die Franzosen in die Stadt einmarschierten. Hegel, seit 1805 Professor, bewunderte die „Weltseele Napoleon“ und ergriff nichtsdestoweniger die Flucht, wobei in den Jahren in Jena – das Buch behandelt sie ausführlich – zahlreiche Denkkomplexe umrundet wurden.
Die folgenden zehn Jahre, von 1807 bis 1816, verbrachte Hegel in Franken, erst in Bamberg, wo er – nicht zum ersten Mal – in der Welt des Journalismus unterkam (hier allerdings als Brotberuf, anders als in Jena, wo er mit Schelling das „Kritische Journal der Philosophie“ herausgebracht hatte). Hier entstand die „Phänomenologie des Geistes“. Noch konnte er sich ohne Anhang relativ leicht bewegen. Als er in Nürnberg die eine Stellung als Rektor des Egidiengymnasiums angeboten bekam, das erste humanistische Gymnasium in Deutschland, heiratete er dann – immerhin schon 41jährig – die 20jährige Marie von Tucher. Es wurde eine glückliche, von Kindern gesegnete Ehe. Ein unehelicher Sohn aus einer früheren Beziehung noch in Jena bedeutete allerdings Unruhe, der Vater hat sich nicht gänzlich ordentlich verhalten. In Nürnberg entstanden dann vordringlich Schriften zur Logik.
Doch auch mit Familie scheute sich Hegel nicht, wieder einmal einen Ortswechsel zu vollziehen, wenn ihm beruflich bessere Möglichkeiten winkten. Als die Universität Heidelberg eine Stellung bot, setzte er sich sofort in Bewegung, das Angebot anzunehmen. Doch obwohl er sich hier sehr wohl fühlte – zwei Jahre später rief Berlin, das Ziel von jedermanns Wünschen. Nach nur zwei Jahren zogen die Hegels wieder weiter, und nun begann die letzte Lebensphase, die der Autor „Hegels Aufstieg zur Weltgeltung“ nannte, u,a, mit seinen Schriften zur Rechts- und Geschichtsphilosophie. Als Berliner Professor „dachte er seinen Zuhörern etwas vor“. Ob man ihn als systemerhaltenden preußischen „Staatsphilosophen“ interpretiert, liegt am Betrachter. Privat ist seine Eingebundenheit in die Berliner Kunstszene zu nennen, darüber hinaus nun zahlreiche Reisen, u.a. nach Wien, wo er reiche Eindrücke zu Kunst und Musik empfing, Grillparzer besuchte und das Theater in der Leopoldstadt, von den Wienern „Kasperltheater“ genannt – Hegel im Kasperltheater, welch eine Antithese…. Vor allem aber geht es für den Autor dieser Biographie nun darum, seinen philosophischen Kosmos zu runden.
Hegel starb gewissermaßen mitten aus dem Leben gerissen nach kurzer Krankheit unvermutet am 14. November 1831, viel bewundert, viel gescholten.
Was nun die deutsche Philosophie betrifft, so drängten sich innerhalb eines Jahrhunderts ihre großen Vertreter, beginnend mit Kant (geboren 1724), Fichte (geboren 1762), Hegel (geboren 1770), Schelling (geboren 1775), Schopenhauer (geboren 1788), wobei es Letztgenannter war, der Hegel für einen „Scharlatan“ hielt, der „bombastischen Unsinn und Humbug“ verbreite. Was Hegel zur Philosophie beigetragen hat, referiert das Buch in aller Ausführlichkeit – leicht verständlich zu machen, ist es nicht, schwer verständlich bleibt es.
Wenn man nach der Lektüre mit dem Bewusstsein scheidet, Hegels Lebensweg mit großem Interesse gefolgt, aber doch nicht in die vollen Tiefen seiner Erkenntnisse hinabgestiegen zu sein, kann der Autor nichts dafür. Und das Buch hat als fesselndes Porträt eines Menschen und seiner Epoche dennoch viel erreicht.
Renate Wagner

