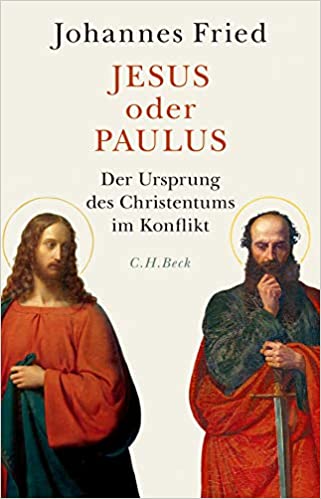
Johannes Fried:
JESUS ODER PAULUS
DER URSPRUNG DES CHRISTENTUMS IM KONFLIKT
200 Seiten, Verlag C.H.Beck, 2021
Johannes Fried meldet sich erneut zu Wort. Der streitbare emeritierte Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Frankfurt am Main hat vor zwei Jahren, auch im Beck Verlag, das Buch „Kein Tod auf Golgatha: Auf der Suche nach dem überlebenden Jesus“ veröffentlicht und dafür viel Schelte geerntet. Schließlich gehört er zu den Wissenschaftlern, die gegen den Strich der akzeptierten Überlieferung denken und behaupten, Jesus sei nicht am Kreuz gestorben.
So weit, wie mancher wenig seriöse Sachbuchautor, der Jesus bis Indien folgen wollte, ist er nicht gegangen, aber eines behauptet Fried felsenfest: Es gab keine Auferstehung, keine Himmelfahrt und damit keinen „Beweis“, dass man es mit dem „Sohn Gottes“ zu tun hat. Dass die Katholische Kirche dies selbstverständlich fest behauptet, ist gewissermaßen eine historische Notwendigkeit – wäre Jesus nur ein vazierender jüdischer Prediger und Wunderrabbi gewesen wie damals viele andere auch, er eignete sich wohl kaum als Fundament dessen, was die Kirche in Jahrhunderten zu stellenweise enormer Macht aufgebaut hat…
„Jesus oder Paulus: Der Ursprung des Christentums im Konflikt“ setzt nun das vorige Buch fort, das heißt, es wiederholt erst einmal die aufgestellte These – und das viele Male. Das mephistophelische „Du musst es dreimal sagen“ reicht Johannes Fried nicht, seine mantra-artigen Wiederholungen sind nachgerade ermüdend. Aber er muss dem Leser ja auch seine Überlegungen einhämmern, schließlich rennt er gegen eine einzementierte Denktradition an. „Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen“, behauptet er tapfer.
Erstens erklärt Fried steif und fest – und hat vielleicht nicht Unrecht damit -, dass man eine Kreuzigung überleben konnte. Dazu hat er in der Gegenwart zahlreiche Ärzte befragt, die ihm das teilweise bestätigen konnten. Für das Überleben von Jesus, der im Auge von Johannes Fried ein Mensch war und nichts anderes, war einiges nötig – der berühmte Lanzenstich des römischen Soldaten, der eigentlich seinen Tod bestätigen sollte, erwies sich als nötige „Punktierung“ des Lungenflügels, wodurch der Druck abgelassen wurde und man den ins Koma gefallenen scheinbaren Toten früh vom Kreuz nahm. Außerdem hat man ihm, so Johannes Fried, nur die Hände am Kreuz angenagelt. Für sein „Auferstehen“, das nur ein „Aufstehen“ vom Nicht-Tot-Sein war, erwies es sich sowohl als nötig, dass seine Füße nur ans Kreuz angebunden und nicht angelnagelt waren, wie auch, dass man ihm nicht die Beine gebrochen hat, was ja spätere Bewegung unmögich gemacht hätte.
Also – Jesus war nicht tot, fand sich nach seinem Erwachen im Felsengrab des Joseph von Arimathia wieder, kam irgendwie heraus und erschien ja laut Evangelien einer ganzen Menge von Leuten, In voller Körperlichkeit, falls nicht Dutzende, sogar Hunderte Menschen der gleichen Vision und Phantasie erlagen, ihn lebendig gesehen zu haben. Bis dahin war sein Schicksal gewissermaßen nichts Besonderes – Wanderprediger gab es sonder Zahl, Aufrührer in den nahöstlichen Provinzen auch, die von den Römern an die Kreuze genagelt wurden. Dass Jesus in keinem einzigen zeitgeschichtlichen Dokument vorkommt (und der eine Satz bei Flavius Josephus, den man auf ihn beziehen könnte, möglicherweise gefälscht ist), bezeugt nur, dass er damals ein Niemand war.
Und doch begründete sich an seiner Person eine Weltreligion. Wieso? Die Frage stellt nicht erst Johannes Fried, und dass sie zweifelsfrei zu beantworten wäre, ist wohl nie anzunehmen (das macht das Thema allerdings so unerschöpflich). Was geschah also, um Jesus als Religionsgründer „tauglich“ zu machen? Er konnte nicht einfach ein jüdischer Prophet sein, man musste den Sohn Gottes aus ihm machen. Mit „Auferstehung“, mit „Himmelfahrt“, mit „sitzet zur rechten Hand Gottes“, also selbst Gott als Gottes Sohn. Das ultimative Wunder, das Heilsversprechen ewigen Lebens auch für die armen Erdenmenschen. All das haben seine Jünger, seine Zeitgenossen nie behauptet. Aber eine neue Glaubensrichtung die in den Jahrzehnten nach ihrer Entstehung so uneins war, brauchte diesen „Gottessohn“ – ein normaler Mensch hätte es nicht getan.
Für die Uneinigkeit ist vor allem Paulus zuständig, meint der Autor, der an diesem Apostel (der Jesus nie begegnet ist) nicht viele gute Haare lässt. Tatsache scheint zu sein, nach der Sicht von Johannes Fried, dass dieser Saulus aus Tarsos unter vielen Visionen die eine hatte, die ihn zum Propagandachef des neuen Christentums machte – und der es gleich zu Beginn spaltete.
Denn da war noch die Welt der Jünger und jener, die Jesus gekannt hatten und ihm zu Lebzeiten gefolgt waren. Es handelt sich bei ihnen – wie bei Jesus selbst – um fromme Juden, die ihre Gesetze befolgten, und die nie vom „Sohn Gottes“ sprachen. Den hingegen fand Paulus – und erweiterte entscheidend den Interessenten-Kreis für die neue Religion (von der man noch nicht wissen konnte, dass sie Jupiter, Mithras, Baal und alle anderen Platzhalter des Römischen Weltreichs hinwegfegen würde). Nur, wenn er aus „Heiden“ Christen machte, wenn er den Juden Jesus zum Christus machte (und seinerseits ein „Opfer“ der Juden, was dem weltweiten Antisemitismus gewaltigen Aufschwung gab), konnte er die ganze damalige Welt erobern. Er „hellenisierte“ die neue Religion, löste sie von ihrem Judentum ab und öffnete ihr die internationalen Möglichkeiten, und die echten (jüdischen) Anhänger des historischen Jesus hatten angesichts dieser gewaltigen Bewegung keine Chance.
Paulus, der für seine Erfindungen den historischen Jesus weitgehend außer Acht ließ, war, man muss es bedenken, noch vor den Evangelisten an der Reihe: Erst als das Christentum wuchs, merkte man die Notwendigkeit, die Figur des Jesus plastisch zu machen, wozu gleich vier Evangelisten (in gewaltiger zeitlicher Distanz zum einstigen Geschehen) antraten – und ihre Widersprüche entzündeten (und entzünden) seither über Jahrhunderte und Generationen den Gelehrtenstreit, und jeder neue Fund zum Thema des Urchristentums macht die alte Geschichte von neuem interessant.
Und was sagt der Autor zu Jesus? Wo war der echte, kein „Auferstandener“, sondern ein „Überlebender“, dessen „Grabflucht“ (das Lieblingswort von Johannes Fried) ja nun auch eine weitere Geschichte haben musste? Zu erkennen geben konnte er sich nur seinen engsten Freunden, die schweigen würden, denn die Römer sollten besser nicht wissen, dass ein Verurteilter überlebt hatte. Allerdings konnte er sich, mach Meinung von Johannes Fried, ziemlich ungehindert bewegen, er war schließlich in den Augen der Besatzungsmacht ein „Niemand“, den man außerdem für tot hielt.
Nun, auch Fried behauptet nicht, wirklich zu wissen, was Jesus in den weiteren Jahren seines Lebens tat, vermutet aber, dass er umherzog und weiterhin predigte, ins Reich der Nabatäer kam, vielleicht auch nach Ägypten, vielleicht nach Jerusalem zurückkehrte… Aber während in seinem Namen eine Religion entstand, gibt es in keinem einzigen Dokument ein Wort über den „realen“ Jesus, dessen Existenz Johannes Fried so entschieden postuliert.
Wie das schon ist: Wenn man nichts Genaues weiß, kann man bestens spekulieren. Das tut auch dieses Buch, und wenn der Vorgänger ein Bestseller war, kann man erwarten, dass genügend Interessenten auch zu dieser Fortsetzung finden werden. Jesus ist schließlich einer der verbürgtesten „Reiz-Namen“ des Buchgeschäfts…
Renate Wagner

