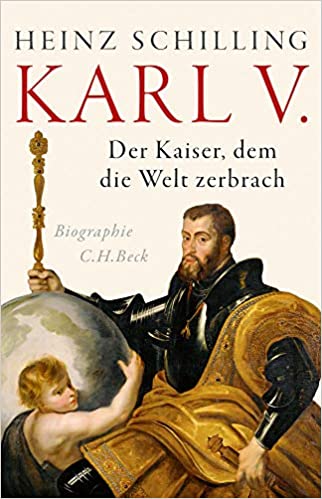
Heinz Schilling
KARL V.
Der Kaiser, dem die Welt zerbracht
464 Seiten, Verlag C.H.Beck, 2020
Er war der mächtigste Mann im Europa des 16. Jahrhunderts, und dennoch erfährt er nicht die Schätzung, die ihm gebührt. Nicht erst der Historiker Heinz Schilling, Professor an der Humboldt Universität in Berlin, stellt das fest. Die Rede ist von Kaiser Karl V., der nicht nur für das Haus Habsburg eine seiner bedeutendsten Persönlichkeiten ist, sondern für die Geschichte seiner Zeit. Woran liegt es, dass dieser Kaiser – über den es, das soll nicht verschwiegen werden, schon eine Reihe glänzender Biographien gibt – sich so am Rande des Interesses bewegt? Weil ihn eine Aura von Distanz umgeben hat, vermutet Schilling. Und hat nun ein wirklich bemerkenswertes Buch geschrieben, das dem Leser das Gefühl vermittelt, diesem Karl V. am Ende doch sehr nahe gekommen zu sein…
Heinz Schilling ist ein Mann, der das 16. Jahrhundert im kleinen Finger hat. Nach seiner Biographie über Martin Luther und seiner Analyse des neuralgischen Jahres „1517“ komplettiert er nun mit der Biographie von Karl V. sein zeitgeschichtliches Terzett dieser Epoche. Dafür, wie man ein so gänzlich zersplittertes Leben darstellen kann, hat er eine Methode von „Schwerpunkt-Kapiteln“ gefunden, die sich jedes Mal um entscheidende Daten des kaiserlichen Lebens ranken – und wo dann ein Aspekt dieser Geschichte abgehandelt wird. Das bringt für den Leser querschnittartig große Übersichtlichkeit. Hätte das Buch allerdings (was man vermisst) eine Zeittafel, so differenziert wie bei manchen Kollegen, dann wüsste man auch, dass Dinge, die hier getrennt behandelt werden, ganz eng beieinander lagen. So hat er etwa in dem Jahr 1526, als er Isabella von Portugal heiratete, sozusagen „nebenbei“ Krieg mit Frankreich geführt, und in Ungarn starb der dortige König bei der Schlacht von Mohacs gegen die Türken… alles einzelne Kapitel. Dennoch: Die Methode überzeugt.
Im Ganzen rundet sich das Bild eines Mannes, der – man darf das so flapsig ausdrücken – der Nachwelt einen ungeheuren Gefallen getan hat: Durch ein Geburtsdatum, das „1500“ lautet, weiß man immer, ohne lange nachzurechnen, wie alt er jeweils ist. Und dieser Karl war unendlich jung, als er zu „erben“ begann – durch Zufälle, Unglücksfälle, Tode, zu denen er nichts beigetragen hatte. Aber der der frühe Tod seines Vaters, des Herzogs Philipp „der Schöne“ von Burgund, machte den Sechsjährigen bereits zum nominellen Herrscher dieses Erbes. Seine Mutter, „Johanna die Wahnsinnige“, wurde durch den frühen Tod ihres Bruders die Erbin von Kastilien und Aragonien – Karl wurde sechzehnjährig König dieser Länder, der „Burgunder“, den die Spanier erst einmal akzeptieren mussten. Und dann starb sein Habsburgischer Großvater, Kaiser Maximilian I., und Karl „erbte“, was eigentlich nicht zu erben war, denn die Kurfürsten wählten bekanntlich – und doch erhielt Karl die Kaiserwürde, die in der Folge – mit ganz wenigen Ausnahmen – bis zum Ende im „Besitz“ seiner Familie, der Habsburger, blieb.
Eine unglaubliche Machtfülle für einen Mann, dem Machtrausch und persönliche Eitelkeit fremd waren, was man von seinen Zeitgenossen, den zügellosen Renaissance-Bündeln Franz I. von Frankreich und Heinrich VIII. von England, nicht sagen konnte. Karl, von tiefer Frömmigkeit und großem Sendungsbewusstsein und Verantwortungsgefühl geleitet, wollte immer das Beste – und ist dennoch, wie der Untertitel von Schillings Biographie besagt, „Der Kaiser, dem die Welt zerbrach“.
Liest man sich durch sein Schicksal, so weiß man, dass er keine Chance hatte. Frankreich, eingeklemmt von Karls spanischen und niederländischen Besitzungen und dessen (allerdings sehr wackliger) Macht im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, führte schier ununterbrochen Kriege gegen ihn – und fühlte sich nie an Verträge und Versprechen gebunden (ebenso wenig wie etwa Moritz von Sachsen, der sich Karl V. gegenüber als Verräter verhielt). Aus dem Osten drängten die Osmanen herbei (1529 fand die „erste Türkenbelagerung Wiens“ statt), und in Deutschland zerbrach die Welt, an die Karl glaubte, als er 1521 im Reichstag zu Worms einem Augustinermönch gegenüber stand, der sich anschickte, die Sicherheit der katholischen Welt, als deren Repräsentant sich Karl empfand, zu zersprengen…
Der Kaiser soll sich noch, so schreibt Schilling, in seinem „Sterbe-Exil“ in Yuste Vorwürfe gemacht haben, dass er das für Martin Luther ausgehandelte „freie Geleit“ damals akzeptierte – vielleicht hätte er die Spaltung der Kirche verhindern können. Aber er vermochte ja auch nicht, das Rad in England zurück zu drehen, als Heinrich VIII., mit Karls Tante Katharina von Aragon verheiratet, sich von Rom löste, um sich scheiden zu lassen – und die Hoffnung, dass ihre Tochter Maria Tudor durch die Heirat mit Karls Sohn Philipp, dem späteren König Philipp II. von Spanien, den Katholizismus wieder auf die Insel bringen könnte, war vergeblich. Es ist die Religiosität des Kaisers, die dieses Buch geradezu „durchwirkt“, weil sie nach Meinung von Heinz Schilling das stärkste Motiv seines Handelns war…
Und so liest man sich durch die 58 Lebensjahre dieses Mannes, der ein „Reisekaiser“ war (wie jene des Mittelalters), der kein Zentrum und keine Residenz besaß und innerhalb der riesigen Dimensionen seines „europäischen“ Herrschaftsgebiets ununterbrochen unterwegs war, erst im Sattel, später (von der Gicht geplagt) in der Sänfte. Als Diplomat agierend, ununterbrochen Briefe mit Anweisungen schreibend, und dann auch auf dem Feld an der Spitze seiner Truppen teils erfolgreich, teils verlierend. Immerhin, Tizian hat ihn hoch zu Roß festgehalten, als er 47jährig in die „Schlacht von Mühlberg“ ritt und die Protestanten besiegte. Ohne Nachhaltigkeit, wie er auch trotz seiner Siege in Nordafrika die Osmanen nicht aufhalten konnte. Erst sein „natürlicher Sohn“, Don Juan d’Austria, den er als „Pagen“ in den letzten Monaten seines Lebens in Yuste um sich hatte, konnte später in der Schlacht bei Lepanto einen entscheidenden Sieg gegen diese Feinde aus dem Osten feiern.
Habsburger-Geschichten sind Familiengeschichten, und trotz einer glücklichen Ehe wird Karl V. für den Leser nicht zum weichen Gatten, Vater, Bruder. Sein Denken war – wie es in den großen Herrscherfamilien noch bis ins 19. Jahrhundert galt – dynastisch, Schwestern, Töchter, Nichten wurden strategisch verheiratet und meist nicht glücklich, und dennoch hingen sie ihm in Treue an. Die Frauen des Hauses, klug, gebildet, verlässlich (wenn es nicht darum ging, dass sich das Gift des Protestantismus in das eine oder andere Hirn hineinfraß), waren für Karl V. verlässliche Statthalterinnen und Stellvertreterinnen, Philipp war der Sohn, dem er Spanien und die Niederlande übergeben konnte – und die einzige, tiefgreifende Verstimmung mit seinem Bruder Ferdinand, der ein Fels in der Brandung war, gab es, als Karl für Philipp auch die Kaiserwürde wünschte, die dann an Ferdinand und in der Folge an dessen Sohn ging. Das Reich war zu groß, die Teilung in die spanische und die österreichische Linie (später x-mal nahezu blutschänderisch verbunden) sorgte dafür, dass man über die gewaltigen Machtgebiete die Übersicht behalten konnte.
So vieles spielt in diese Geschichte hinein, die Kolonien, die Cortez und Pizarro für Spanien eroberten (samt ihren Schätzen), die Problematik der Eingeborenen (die Karl nicht versklavt wissen wollte…). Neben den politischen Schwerpunkten – Frankreich, die Protestanten, die Osmanen – berichtet Schilling, was man nur weiß über den „privaten“ Karl, auch wenn es nicht viel ist, weil er keinerlei exhibitionistisches Ausstellung seiner Gefühle pflegte. Schilling erzählt ganz nah an der Person des Kaisers (keine ausufernden, sich verlierenden Selbstzweck-Analysen, was Historikern gelegentlich passiert), er ist anschaulich und stellt heutige Fragen, ohne heutige Urteile zu fällen. Man kann Menschen schließlich nur aus ihrer Zeit begreifen.
Wie sie dann in Biographien auf den Leser zukommen, das entscheidet allerdings der Autor. Und Heinz Schilling geht mit bewundernswertem Respekt mit der Figur von Karl V. um.
Renate Wagner

