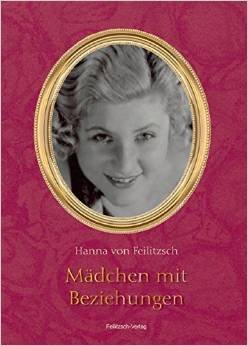
Hanna von Felitzsch:
MÄDCHEN MIT BEZIEHUNGEN
352 Seiten mit anschließendem Bildteil. Felitzsch Verlag, 2014
Am Umschlag ist eines jener „süßen“ Frauengesichter zu sehen, wie sie der deutsche Film der dreißiger Jahre pflegte, ein bisschen Lilian Harvey, aber man kennt die Dame nicht. Der Titel des Buches von Hanna von Felitzsch lautet „Mädchen mit Beziehungen“. Und erfährt man aus der Schutzumschlag-Biographie, dass die Autorin schon mehrere Bücher über Leo Slezak geschrieben hat, wird der Zusammenhang klar: Es handelt sich um Margarete, die Tochter von Leo Slezak. Ihr Wunsch, ein großer Star (wie der Papa) zu werden, hat sich nicht erfüllt. Aber dass ihre Geschichte nun doch erzählt wird – zumindest so weit hat sie nun die Nachwelt erreicht.
Geboren 1901 in Breslau als Tochter des Opernsängers Leo Slezak und seiner (jüdischen) Gattin Elsa Wertheim, war Margarete eines der beiden Kinder des Paares – Bruder Walter kam im Jahr darauf zur Welt. Seine Karriere sollte sich später vor allem als Komiker in US-Filmen als nachhaltig erweisen. Margaretes Künstlerblut war zwar auch ausgeprägt, aber an den Ruhm von Vater Leo reichte keines der Kinder heran.
Das Buch beginnt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, als Leo Slezak sowohl an der Wiener Hofoper wie in New York Triumphe feierte, wohin ihn seine Familie stets begleitete. In den Sommermonaten lebte man in Egern (Rottach-Egern in Bayern), und man erlebt mit Margarete eine ausgesprochen idyllische Kindheit.
Dem Vater in der Luxuwohnung der Familie im Wiener Heinrichshof beizubringen, dass sie ihre eigene Karriere als Sängerin schon in die Wege geleitete hatte, führt zu vielfachem Familiengeschmolle, ebenso ihre erste Ehe mit Hermann, der sie allerdings am liebsten mit Tochter Helga in bürgerlichem Hausfrauendasein eingesperrt hätte. Margarete sprengte allerdings die Ketten und ging nach München.
Nun hat Autorin Hanna von Felitzsch einen für den Leser gar nicht so geheimnisvollen jungen Mann schon mehrfach ins Spiel gebracht – als glühenden Verehrer Slezaks an der Wiener Oper, als gewissermaßen aufstrebenden jungen Politiker, der die feinen Damen von Egern wie ein Rattenfänger einfing, und nun begegnete Margarete diesem Adolf Hitler wieder, als sie am Theater am Gärtnerplatz in München auftrat. Es wird Wert darauf gelegt, dass Leo Slezak diesem Herrn gegenüber als Politiker und Mensch stets Distanz wahrte, während Margarete ihn sich gewissermaßen als Verehrer gefallen ließ… Hitlers Wunsch nach stets neuen, komischen Slezak-Anekdoten erfüllte sie gern, und dass er Namen wie „Gustav Mahler“ nicht gerne hörte, wurde von ihrer Seite her offenbar nicht sonderlich wahrgenommen.
Ein künstlerisches Mittelklasseschicksal entrollt sich – eine lukrative Tournee durch Südamerika (im 20. Jahrhundert zum Geldverdienen so üblich, wie die Stars des 19. Jahrhunderts zu diesem Zweck nach St. Petersburg und Moskau fuhren), das schlechte Gewissen der Mutter, die Tochter so lange bei ihren Eltern zurück zu lassen, Wiedereinstieg in Deutschland, Revuestar im Berliner „Wintergarten“, schließlich Studium als Opernsängerin und Engagement an den Berliner Opernhäusern, Eintauchen in die wilden dreißiger Jahre, in diesem Fall mit Nachtleben und Alkohol.
Und stets im Dunstkreis des Mannes, der nun schon „der Führer“ war, ihr ein „lieber, guter Freund“, dem sie ein „herzliches Weihnachtsbusserl“ schickte. Der Vater warnte, aber Margarete hatte andere Sorgen – ihre Karriere.
Italien-Tournee, mäßige Erfolge in der Oper, Filme, ohne in die erste Reihe vorzudringen –auch in der Filmkarriere war das Vater, der nun (am Ende der Sängerkarriere) als Komiker vor die Kamera ging, ihr weit überlegen (der Schwerpunkt von Margaretes Filmarbeit lag dann mit Nebenrollen in den fünfziger Jahren), und dann, als es mit dem Dritten Reich ganz ernst wurde, der Druck der jüdischen Mutter (da ließ man doch eher das Gerücht verbreiten, Margarete sei das Kind von Slezaks Seitensprung mit einer deutschen Köchin…). Hitlers schützende Hand lag über ihr, die offenbar sein unveränderter Jugendschwarm war.
Margarete heiratete dann in zweiter, glücklicher Ehe den Tenor Peter Winter aus Köln, sang nun das große Fach (Tosca, Desdemona) in der Oper, bis ihr die jüdische Mutter wieder auf den Kopf fiel und sie, jetzt in stolzer Erkenntnis, wer Hitler wirklich war, nicht mehr um seine Protektion bitten wollte…
Ihre Mutter starb 1944, ihr Vater nach Kriegsende 1946, das Haus am Tegernsee war immer Rückzugsgebiet. Auch Margarete hatte nicht mehr lange zu leben – sie drehte Filme (allerdings nur Nebenrollen, einige in Heinz-Rühmann-Lustspielen), gab das „Lebensmärchen“ ihres Vaters heraus, richtete ein Leo Slezak Museum ein. Skurrile Marginalie am Ende: Nach Margaretes Tod 1953 wurde ihr Mann bekennender Homosexueller und zog mit einem alten Freund eheähnlich zusammen…
Als Quellen gibt die Autorin Margarete Slezaks eigene Erinnerungen „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ (in den fünfziger Jahren erschienen, längst vergriffen und vergessen im Gegensatz zu den Büchern über den Vater), die Leo Slezak-Literatur und einiges über Hitlers Privatbeziehungen an. Faktisches, vor allem im Hinblick auf Margaretes musikalische Karriere, erfährt man kaum.
Tatsächlich bietet das Buch außer einem kleinen Anhang historischer Fotos (immerhin mit dem Faksimile eines pathetischen Hitler-Briefs von 1929) wenig, das für den Leser als real beweisbar fassbar wäre (ein Brief an den „Hochverehrten Führer“ 1939, auf Seite 229 abgedruckt, wird ja wohl echt sein).
So interessant und vielfältig das Schicksal der Margarete Slezak auch gewesen sein mag, so kann der Leser, den vordringlich Zeit und Umfeld interessieren, doch Einwände haben. Denn indem die Autorin in der Schilderung das Genre des historischen Romans wählt, wird das Töchterchen, das gegen den Willen der Eltern Künstlerin wird; die geplagte Ehefrau des (ersten) Gattin, der sich als so böse herausstellt; die unschuldsvolle Künstlerin, die sich vom Diktator bewundern lässt usw. ja dann doch zur Courths-Mahler-Figur, betulich vor allem in den Dialogen.
Mit allem, was die Autorin zweifellos weiß, hätte sie hier ein zeitgeschichtliches, zeitrelevantes und theater- und filmgeschichtlich haltbares (Sach-)Buch schreiben können. Das hätte Margarete Slezak doch noch um ein Stück interessanter und als historische Person fassbarer gemacht.
Renate Wagner

