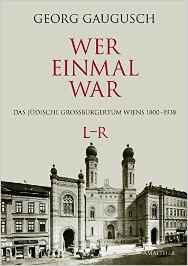
Georg Gaugusch:
WER EINMAL WAR L – R
Das jüdische Großbürgertum Wiens 1800-1938
Ca. 1400 Seiten, Amalthea Verlag, 2016
Es hat eine zeitlang gedauert (an die fünf Jahre), aber das Meisterwerk, das Monsterwerk wurde fortgesetzt. Und nicht in einem Band, wie man 2011 erwarten konnte, als Georg Gaugusch den ersten Band über das Jüdische Großbürgertum Wiens von A bis K vorlegte. Nun ist er bis R gediehen, und man kann sich vorstellen, dass S bis Z (samt vielen Nachträgen) wieder ein ähnlich voluminöser Band wird, den man nur am Schreibtisch sitzend, das Buch vor sich liegend, lesen und benützen kann…
Die Geschichte der Juden Wiens ist mit der Stadt so eng verwebt, dass jede Kenntnis das Gesamtbild unendlich bereichert. Menschen binden sich – bei den Juden vielleicht noch stärker als anderswo – in Familien, und nach diesen geht Gaugusch vor. Wie viele Namen kennt man hier, teils bis heute, die Landesmanns beispielsweise, wie viele Namen haben Wirtschafts- und Sozialgeschichte mitgeschrieben (die Mautners etwa), wie faszinierend den Picks, Pollaks, Poppers oder Redlichs nachzuspüren, wo einzelne Familienmitglieder fest in der Geistesgeschichte des Landes stehen.
Zuerst gibt es zu den einzelnen Namen eine Übersicht über die ganze Familiengeschichte, das zumindest ist purer Lesestoff, berichtet über erstaunliche Leistungen (sehr oft auf wirtschaftlichem Gebiet, denn viele Juden waren begnadete Unternehmer), wobei viele Familien äußerst kinderreich waren und in viele „Zweige“ zerfielen (die gelegentlich auch durch Heirat wieder zusammen geführt wurden).
Dann geht es um die einzelnen Menschen – Daten, Orte, Adressen, Berufe, Lebensumstände, Lebenspartner, Tod (möglichst mit Todesursache), letzte Ruhestätte. Und die Nachkommen und deren Nachkommen… und oft steht man vor dem Schnitt, den das Jahr 1938 bedeutete, das Ende der Menschen und der Firmen, die sie geschaffen hatten. Und manchmal steht, es ist besonders beklemmend, hinter „gest.“ (gestorben) nur Punkt, Punkt, Punkt. Gestorben wann und wo? Welches Konzentrationslager?
Jeder Leser wird seine persönlichen Interessen hegen, aber wenn man beispielsweise rund um Arthur Schnitzler forscht, findet man gleich zu Beginn bei den Lackenbachers Details über jene Rebecca, die die Gattin von Carl Markbreiter und damit eine angeheiratete Tante von Schnitzler wurde – und auch heute am Zentralfriedhof dort zu finden ist, wo sich alle Gräber der riesigen, verzweigten Familie zusammen scharen, als wollte man auch im Tode mit den Verwandten eng beisammen sein… Und wenn man bei den Lackenbachers weiter liest (es ist grenzenlos interessant), erfährt man nicht nur, dass einer der Lackenbacher mit hoher Wahrscheinlichkeit Mozart 1000 Gulden geborgt hat, sondern findet auch eine andere Lackenbacher-Tochter, Fanny, die mit Philipp Freiherr Schey von Koromla verheiratet war und damit auch ein Mitglied der größeren Schnitzler-Familie wurde. Die familiären Netze sind auch durch die oft hohe Anzahl von Nachkommen (18 Kinder kamen vor) zu erklären: Da versprengen sich die Namen und Familien schier ins Unendliche.
Oder die Familie Lieben – verbunden mit den Königswarter, den Auspitz, den Schey von Koromla, den Todesco, kurz, wer diesem Buch verfällt, findet nicht so schnell wieder heraus.
Zusammen gesucht wurde das Material aus Genealogien und Sekundärliteratur, aus Archiven und Friedhöfen, aus Zeitungen und neuerdings auch aus dem Internet, wo ebenso starke wie erfolgreiche Bemühungen herrschen, jüdische Geschichte zusammen zu tragen. Es ist ein Nachschlagewerk, aber wer es zu benützen weiß, wird hineinfallen wie in einen großen Roman.
Ja, man wartet auf den dritten Band. Und irgendwann muss wohl auch das Gesamtregister erscheinen. Denn das ist eine Welt für sich.
Renate Wagner

