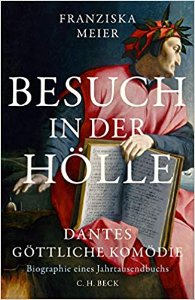
Franziska Meier
BESUCH IN DER HÖLLE
Dantes Göttliche Komödie
Biographie eines Jahrhundertbuchs
214 Seiten, Verlag C.H.Beck. 2021
England hat Shakespeare, Deutschland hat Goethe, Spanien hat Cervantes und Italien hat Dante – einer muss, ja soll der „Nationaldichter“ sein. Und wer an die größten Leistungen der Literatur denkt, sagt bald nach der „Odyssee“ sicherlich „Die göttliche Komödie“.
Für Dante, ihren Schöpfer, geboren 1265 in Florenz, jährt sich am 14. September 1321 sein Todestag im Exil in Ravenna zum 700male. Italien feierte das „Dante Jahr“, in deutscher Sprache erschien ein Buch, das sich mit der langen Geschichte der „Comedia“ (wie sie ursprünglich hieß) befasst – also die Biographie nicht ihres Schöpfers, sondern seines Werks, des „Jahrtausendbuchs“, wie es im Untertitel heißt.
Autorin ist Franziska Meier, Professorin für Romanische Literaturwissenschaft und Komparatistik an der Georg-August-Universität in Göttingen, wo sie den Lehrstuhl für französische und italienische Literaturwissenschaft inne hat. Mit dem „Besuch in der Hölle“ ist ihr ein Buch gelungen, das wissenschaftlich fundiert, aber dabei für alle Leser zugänglich ist. In 14 Kapiteln schneidet sie eine Unzahl von Fragen und Themen an, wobei sie die siebenhundert Jahre, die hier zu behandeln sind, fest im Blick hat.
Sie beginnt allerdings mit der Gegenwart – warum „Dante“ über den Namen hinaus ein Begriff der kulturellen Identität Italiens geworden ist, der bis in die Trivialkultur reicht. „Café Dante“ gibt es zahllose, Petrarca und Boccaccio haben das nicht geschafft. Man erfährt kuriose Dinge, etwas dass in Italien auch eine Klopapier-Sorte „Dante“ heißt – identitätsstiftender ist vermutlich, dass die italienische Version der Zwei-Euro-Münze sein Bild trägt.
Die „Comedia“ galt schon kurz nach ihrer Erstveröffentlichung 1472 als besonderes und aufsehenerregendes Werk – sowohl in ihrem Umfang (100 Gesänge mit über 14.000 Versen) wie in der für damals absolut revolutionären Tatsache, dass sie nicht in der Gelehrtensprache Latein, sondern in der italienischen Umgangssprache verfasst wurde.
Da Dante hier durch Hölle, Fegefeuer und Paradies schreitet (wobei ihm berühmte Figuren der Weltgeschichte begegnen, nebst ungezählten anderen), gab man der Comedia den Beinamen „Divina“, obwohl der Autor damit vor allem zum „Fachmann für Höllenreisen“ wurde. Dass das Werk auch zum Problem der Kirche wurde, die es zeitweise verbot, versteht sich.
Die Autorin steigt sofort in den Kontroversen über das Monsterwerk ein, das stets heiß umstritten war. Vielfach wurde die Behauptung aufgestellt (unter anderen von Voltaire), dass das Buch ohnedies von niemandem gelesen würde – dem widerspricht die Erkenntnis, dass es Zeitgenossen Dantes gab, die das Buch für sich selbst abgeschrieben haben sollen, dass noch zu Dantes Zeiten „winzige“ Ausgaben davon hergestellt wurden, damit man es in der Tasche bei sich tragen konnte.
Dass die „Comedia“ nicht nur als Werk galt, das alle denkbaren Schrecken ausmalte, sondern auch als Erbauungsbuch – es gibt nichts, was man in der Dante-Interpretation nicht finden könnte. Auch Informationen, die ein Lächeln hervorrufen – angeblich sollen Michelangelo und Leonardo darüber gestritten haben, wer der größere Dante-Kenner sei…
Dennoch ist der Gedanke (auch von der Autorin) nicht abzuweisen, dass viele Leute die „Divina Comedia“ bestenfalls partiell kennen und dass das allgemeine Wissen über die Inschrift am Höllentor („Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate“) und der Figur der Francesca da Rimini (die Paolo liebt und von ihrem Mann dafür ermordet wird) nicht hinausgeht.
Allein an dieser Frauenfigur, die Dante so bewegend schildert, kann die Autorin eine ganze Kulturgeschichte des Frauenbildes durch die Jahrhunderte knüpfen, so verschieden wurde die Sünderin, die Liebende gesehen und auch instrumentalisiert, etwa gegen die Zwangsehe (!) – und auch immer wieder komponiert, wie man weiß, von Liszt, Thomas, Tschaikowsky, Zandonai, Blacher und anderen.
Voltaire war es auch, der erklärte, die „Divina Comedia“ sei unübersetzbar – dem stehen Übersetzungen in alle Weltsprachen gegenüber. Die Rezeption war unterschiedlich, ob in der deutschen Romantik, ob im China von heute, der Weg, den das Werk nahm, ist weit. Die Wissenschaftler aller Sprachen haben sich krumm und schief daran interpretiert, Dantes Geburtsstadt Florenz, die ihn ins Exil getrieben hat (weil er sich der falschen Partei angeschlossen hatte), tat alles, ihn zurück zu bekommen – obwohl Dante später auf seine Heimatstadt gar nicht gut zu sprechen war. (Dieses Kapitel samt der Rolle, die Lorenzo de‘ Medici im Versuch der „Wiedergewinnung“ spielte, ist besonders interessant.) Ebenso wurde Dante später von Garibaldi propagandistisch für die Einigung Italiens benützt.
Wie gesagt, findet die Autorin Dante-Bezüge in allen Welten und allen Zeiten, und der Dante-Kult hat auch bizarre Blüten getrieben. Ob sie Dante-Motive in Romanen aufspürt (die Höllenvisionen bis in Joseph Conrads „Herz der Finsterns“, wenn die Reise zu Kurtz geht), ob sie darauf aufmerksam macht, dass Rodins „Kuss“-Statue eine Darstellung von Francesca und Paolo ist. Ob sie an die Dante-Lesungen des Schauspielers Roberto Benigni erinnert, der den alten Dichter in Pop-Star Höhen treibt, ob sie Dante in japanischen Manga findet, ob sie in einem Clint Eastwood-Film Parallelen aufspürt (an die an sich niemand gedacht hätte).
„Dante und Shakespeare teilen sich die Welt, es gibt keinen Dritten“, urteilte einst T.S. Eliot. Dante überall, und das mehr als 700 Jahre alt. Fast ein Literatur-Krimi.
Renate Wagner

