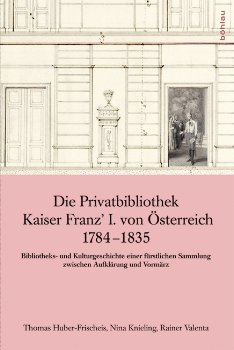
Thomas Huber-Frischeis, Nina Knieling, Rainer Valenta Hsg.
DIE PRIVATBIBLIOTHEK KAISER FRANZ’ I. VON ÖSTERREICH 1784-1835
Bibliotheks- und Kulturgeschichte einer fürstlichen Sammlung zwischen Aufklärung und Vormärz
640 Seiten, Böhlau Verlag, 2015
Es war ein großes Unternehmen, die Bibliothek von Kaiser Franz I. aufzuarbeiten, und entsprechend dick ist das Buch geworden, das Thomas Huber-Frischeis, Nina Knieling, Rainer Valenta als Herausgeber vorlegen. Der Band besteht zwar aus vielen Artikeln einzelner Autoren, ist aber ein Ganzes, das sich meist auch gut liest – wenn auch nicht alles für jedermann in diesen 640 Seiten gleich interessant ist.
Wenn im Vorwort bedauert wird, dass es noch keine moderne, kritischer Geschichtswissenschaft verpflichtete Biographie von Kaiser Franz I. gibt, dann ist dieses Buch jedenfalls ein idealer Zulieferant.
Von dem einen Spezialaspekt der Privatbibliothek ausgehend, wird hier eine Unzahl von Fragen aufgeworfen, deren Antworten im Ende immer rückbezüglich auf die Person des Kaisers anzuwenden sind – denn die Bücher, ihre Auswahl, ihre Betreuer, ihre „Lagerung“, das „Leben“ dieser Bibliothek, alles steht in engem Zusammenhang mit Franz persönlich und wird auch solcherart behandelt. (Da es kaum persönliche Aussagen von ihm gibt, muss man sich an die sekundären Quellen halten.)
So erfährt man, dass Franz von frühester Jugend an mit Büchern „gelebt“ hat, denn sie bedeuteten seinem Vater, der damals noch der Piero Leopoldo, Großherzog der Toskana, war und mit seiner Familie im Palazzo Pitti in Florenz lebte, unendlich viel. Wie an vielen Adelshöfen herrschte auch hier eine große Liebe zu Büchern, als Sammelobjekte, als Bildungsideal und nicht zuletzt als praktisches Lehrmittel – Allerneuestes wurde erworben, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Die „Aufklärung“ fand nicht zuletzt mit Hilfe von Büchern statt.
Erzherzog Franz als ältester Sohn und seine Brüder wurden mit einem Übermaß an Büchern erzogen. (Interessanterweise zieht Adam Wandruszka zur Schilderung von Franz’ Wesen als „eng, trocken, verschlossen“ als Erklärung „das geradezu ungeheure Übermaß an Erziehung und Unterricht“ heran, „das die Söhne Leopolds und besonders Franz als der künftige Kaiser über sich ergehen lassen mussten.“) Dazu kam, dass Joseph II., der den Neffen auch als seinen Nachfolger sah, seinerseits noch in die Erziehung eingriff – mit anderen Prioritäten. Jedenfalls stand das Lesen in der aristokratischen Gesellschaft grundsätzlich hoch im Kurs, schon um die geistige Überlegenheit der höheren Stände zu garantieren.
Gelesen wurde am Hofe von Florenz und in den Klassenzimmern der Erzherzoge auf Deutsch, Italienisch, Französisch und Latein (wobei Franz Deutsch am besten konnte). Klassiker, Theologie, Mathematik, Rechtswissenschaften, Physik, Geschichte, Belles Lettres, Staatsrecht und militärische Schriften standen auf dem Lehrplan – wobei Franz, als er später selbst über Bucherwerb entscheiden durfte, sein besonderes Interesse der Botantik zuwandte und gerade auf diesem Gebiet auffallend viele Bücher erwarb. Der finanzielle und verwaltungstechnische Aufwand der Bücherbeschaffung war jederzeit hoch.
Als Franz 1784 (er war 16 Jahre alt) nach Wien zu Onkel Joseph II. übersiedelte, nahm er einen Teil seiner Bücher mit, darunter den Tacitus und den Plutarch. Joseph hielt weniger von Büchern als Leopold und ließ Franz auch seine Lern-Zeit nach eigenem Ermessen einteilen. Die Sammelleidenschaft von Franz, die Joseph duldete, wurde durch die Auflassung von Klöstern erleichtert, wo große Buchbestände „frei“ wurden („Gebete, Andachtsbücher, Legenden und theologische Ungereimtheiten“ waren auf Wunsch des Kaisers einzustampfen…).
Franz arbeitet ab seinen Wiener Jahren bewusst an der Erstellung einer eigenen Bibliothek, die er anfangs auch selbst betreute. Bekanntlich starben Joseph II. im Jahr 1790, Franz’ Vater, der ihm als Leopold II. nachfolgte, 1792, und der 24jährige, der nun Kaiser wurde, hatte nicht mehr ausreichend Zeit, sich seinen Büchern zu widmen.
Von da an gab es mehrere Angestellte, die im Buch sowohl als Personen die auch in ihrer Tätigkeit ausführlich geschildert werden, wobei sich – etwa im Fall von Peter Thomas Young, dem ersten Vorsteher der kaiserlichen Privatbibliothek, einem höchst kompetenten Mann – auch tragische Aspekte ergeben: Offenbar hat er aus persönlicher Not in die Kasse gegriffen. Auch andere Mitarbeiter werden behandelt, Listen geben Einblick in Finanzielles.
Franz sammelte nicht nur Bücher (in vielen Sprachen), sondern auch Landkarten, Porträts, Kupferstiche, Handzeichnungen, Münzen, und er erwarb die Sammlung des Wissenschaftlers Lavater und einige andere mehr. Er gab der Verwaltung seiner Bibliothek eine fixe Donation, wobei die Kosten einen beachtlichen Teil der gesamten Monatsausgaben ausmachten und auch unter Franz (wie es schon sein Vater getan hatte) Neues geradezu druckfrisch erworben wurde. Sammelschwerpunkt waren, nun da der Kaiser selbst entscheiden konnte, u.a. Werke über Botanik.
Nicht nur Wiener Buchhändler lieferten, es wurde auch im Ausland bestellt. Familienmitglieder (seine Tante Maria Elisabeth) vermachten dem Kaiser ihre Bibliotheken, andere wurden gekauft, oft ganz, manchmal nur einzelne Werke.
Es hat Franz vermutlich tragisch berührt, als 1826 die Privatbibliothek von König Maximilian I. Joseph von Bayern unter den Hammer kam, nicht nur, weil es sich dabei um seinen damaligen Schwiegervater handelte. Der Kaiser erkannte, was aus persönlichen Schätzen wird, wenn nach dem Tod niemand Interesse daran hat.
Kaiser Franz I. hat am 1. März 1835, das war tatsächlich ein Tag vor seinem Tod (!), verfügt, dass seine Bibliothek in die Rechtsform einer „Primogenitur-Fideikommiss“ überzuführen sei. Das bedeutete, dass sie als Ganzes in der Familie zu erhalten sei, dass niemand sich daraus bedienen durfte, sie nicht zerstückelt und veräußert werden durfte, dass die Bibliothek immer nur in die Verantwortlichkeit des regierenden Familienoberhaupts weiterzugeben sei (was nicht immer geschah).
So kam die Bibliothek dann über Ferdinand I. und dessen Sohn Franz Karl an Kaiser Franz Joseph, und auch dieser, der als „Geistesmensch“ einen schlechten Ruf genoß, hat sich von Anfang an sehr für die Bibliothek interessiert, andere Sammlungen der Familie jener von Kaiser Franz hinzugefügt, das Unternehmen zur „k.k. Familien-Fiedeikommissbibliothek“ erweitert und alle diesbezüglichen Beschlüsse selbst getroffen.
Die exzellente Quellenlage, die dieses Buch ermöglichte, wird von den Wissenschaftlern betont und schaut gewissermaßen aus jeder Seite heraus – unglaublich, wie viel an „Akten“ zu jedem Detail erhalten blieb (der Beamtenstaat hat auch seine Vorteile – zumindest für Wissenschaftler). So „durchschreitet“ man die Geschichte einer Sammlung mit allen Detailaspekten wie (außer dem genannten) Aufbewahrung, Katalogisierung, inhaltliche Schwerpunkte. Und am Ende hat man einen gewichtigen Beitrag zur noch zu schreibenden wissenschaftlichen Biographie von Kaiser Franz.
Renate Wagner

