CD: JOSEPH HAYDN: MISSA CELLENSIS IN HONOREM BEATISSIMAE VIRGINIS MARIAE; Alpha
René Jacobs, die Zürcher Sing-Akademie und das Kammerorchester Basel: Start einer Serie von vier Alben mit sieben Messen von Joseph Haydn
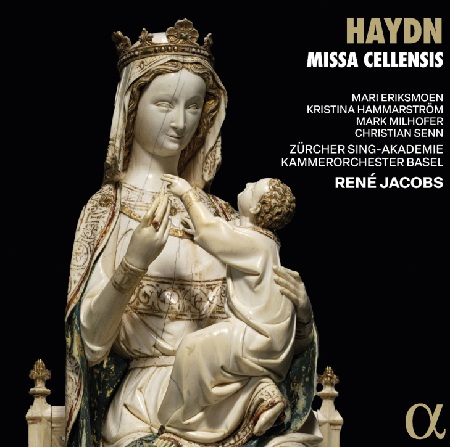
Die auch unter dem Namen „Cäcilienmesse“ bekannte, umfangreichste Messkomposition von Joseph Haydn, Hob. XXII:5, erfordert einen vierstimmigen Chor, ein groß besetztes Orchester mit Pauken und Trompeten und vier vielfach eingesetzte Gesangssolisten. Es handelt sich um eine jener unglaublich jubelnden, Zuversicht ausstrahlenden geistlichen Werke, die uneingeschränkt glücklich machen. Das neue Album reiht sich in eine illustre Schar an Gotteslob, Spiritualität und Virtuosität gleichermaßen feiernden Aufnahmen, von denen ich diejenigen unter Eugen Jochum (Deutsche Grammophon), Simon Preston (Decca) und Justin Doyle (harmonia mundi) besonders hervorheben möchte.
Über die Entstehung der dem Gnadenbild der Allerheiligsten Jungfrau Maria (Magna Mater Austriae) in der Wallfahrtskirche im steirischen Mariazell gewidmeten Missa Cellensis in honorem Beatissimae Virginis Mariae ist viel spekuliert worden. So könnten die prächtigen Abschnitte Kyrie und Gloria nach Kenntnis einer nur fragmentarisch erhaltenen autografen Partitur zunächst 1766 geschrieben worden sein, dem Jahr, in dem Haydn nach dem Tod des Kapellmeisters Gregor Joseph Werner zum neuen Chef der Esterházy’schen Hofkapelle avancierte. Von Nikolaus Esterházy in Auftrag gegeben, ist diese Missa solemnis die dritte von vierzehn Messen, die Haydn im Laufe seines Lebens schreiben sollte.
Der Name Missa Sanctae Caecilia begann sich Ende des 18. Jahrhunderts zu etablieren, vielleicht, weil die Messe von der Cäcilien-Congregation zu Ehren der Jungfrau Maria im Wiener Stephansdom anlässlich des Festes der heiligen Cäcilia aufgeführt worden ist. Wie auch immer. Fakt ist, dass Haydn zwei Mariazeller- Messen (die zweite stammt aus dem Jahr 1782) und keine der Cäcilia gewidmete Messe geschrieben hat.
Wie viele andere Nummern- oder Kantatenmessen ist auch diese Missa Cellensis in etliche, jeweils Inhalt und Ausdruck geschuldete, differenziert besetzte Einzelteile, kontrastierende Tonarten und dynamische Vorgaben unterteilt. 17 Abschnitte zählt sie, diese Missa Cellensis, wobei alleine dem „Gloria“ sieben (Gloria in excelsis Deo, Laudamus te, Gratias agimus tibi, Domine Deus, Qui tollis peccata mundi, Quoniam tu solus Sanctus und Cum Spirito Sanctu – In Gloria Dei Patris) zufallen.
René Jacobs kann in seiner die Dramatik des Stücks betonenden Interpretation auf die vorzüglichen Kräfte der Zürcher Sing-Akademie und des Kammerorchesters Basel zählen. Schon im lichten Kyrie gibt Jacobs mit seiner lebendigen, dynamisch ausgetüftelten und artikulatorisch detailfreudigen Lesart die Gangart für das Folgende vor. Im von anderen Kollegen flehender gestalteten Christe eleison lässt Mark Milhofer mit einem eher kompakten denn lyrisch einschmeichelnden Tenor (unvergleichlich Martyn Hill bei Simon Preston) zunächst nur laue Stimmung aufkommen. In der Fuge des Kyrie II hingegen brilliert die Zürcher Sing-Akademie mit selbstverständlicher Präzision, gut ausbalancierten Stimmgruppen und federndem Schwung. In der Arie ‚Laudamus te‘ des Gloria lässt Mari Eriksmoen ihren leichtgewichtigen, aber schön timbrierten und verzierungsgewandten lyrischen Koloratursopran vernehmen. Nach der anspruchsvollen, vom Chor textlich-expressiv gestalteten ‚Gratias agimus‘-Fuge überrascht Haydn mit einem harmonisch ungewöhnlichen Terzett (neben Mark Milhofer sind die sonor orgelnde Altistin Kristina Hammarström und der hell timbrierte Bass des Christian Senn zu hören). Die jauchzend funkelnde Koloraturarie ‚Quoniam tu solus sanctus‘ und die Fuge ‚Cum Sancto Spiritu‘ bilden den Abschluss der längsten Gloriavertonung aus der Feder Haydns.
Nach dem in ausgelassener Stimmung sopransolo-gestützten Beginn des Credos erreicht die unheimlich vorwärtsdrängende Musik mit dem vor allem von einem ausgiebigen Tenorsolo (zu dem sich in Kreuzigung und Grablegung Alt und Bass gesellen) erfüllten, auf über acht Minuten sich erstreckenden ‚Et incarnatus est‘ an Dramatik und schmerzreicher Abgründigkeit der letzten Dinge.
Der sonnigste Moment des Chors schlägt in der Auferstehung, im so prunkvoll klangkörpergewinnenden, von Jacobs sehr flott genommenen ‚Et resurrexit‘. Nach einem mit 1,36 Minuten extrem kurzen „Sanctus“ (ohne der üblichen ‚Osanna-Fuge‘) weiß das Kammerorchester Basel im „Benedictus“ vor den bestürzend aufgerauten vokalen Passagen rein instrumental von ebenso bewegend Aufwühlendem zu berichten. Nachdem der Basssolist im „Agnus Dei“ die Barmherzigkeit Gottes und Frieden für Sünder angerufen hat, endet die Messe mit dem kontrapunktisch beschwörenden ‚Dona nobis pacem‘ in himmlischem C-Dur.
Fazit: Der Anfang ist mit dieser großartig expressiven, klangtechnisch aufregend direkten und brillanten Wiedergabe der Missa Cellensis in honorem beatissimae Virginis Mariae gesetzt. Freuen wir uns schon jetzt auf die Fortsetzung des bis 2028 geplanten Haydn-Messen-Projekts im Zusammenwirken von René Jacobs, dem Kammerorchester Basel, der Zürcher Sing-Akademie und Alpha Classics, das noch die sechs letzten von Haydn komponierten Messen umfassen soll.
Dr. Ingobert Waltenberger

