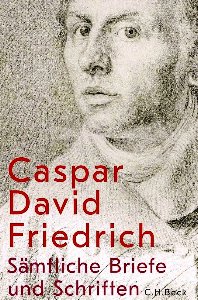
CASPAR DAVID FRIEDRICH
SÄMTLICHE BRIEFE UND SCHRIFTEN
Die komplette Edition in einem Band
Zum 250. Geburtstag am 5. September 2024
821 Seiten, Verlag C.H.Beck. 2024
„Meine Gedanken auf der Leinewand hingepinselt“
Das „Caspar David Friedrich-Jahr“ seines 250. Geburtstags ist vorbei, geblieben ist, was sich zwischen Buchdeckeln findet – Biographien, Kataloge zu Ausstellungen, die irgendwann ja schließen müssen, und ein Buch, das Interessenten des großen Malers vermutlich überrascht hat: Dass man über 800 Seiten benötigt, um seine Briefe und Schriften herauszugeben – allerdings in der kompletten Edition, wie es dem großen Anlass eines solchen Jahrestages gebührt.
Die drei Herausgeber (Johannes Grave, Petra Kuhlmann-Hodick und Johannes Rößler, tätig in Jena, Dresden und Bonn – unendlich fleißig auch in den Anmerkungen) nehmen einen Einwand, der wohl kommen muss, in ihrer Einleitung vorweg: „Auf den ersten Blick ist es nicht gerade naheliegend, sich dem Werk Caspar David Friedrichs über die Beschäftigung mit schriftlichen Äußerungen des Malers anzunähern.“ Bilder, die Friedrich selbst zeigen, geben keinen Hinweis auf Papier und Bücher. Auf Umwegen ließ sich allerdings schließen, dass er sehr wohl gelesen haben muss – wie hätte er sonst Skizzen zu Schillers „Räubern“ schaffen oder Goethes Gedichte als Inspiration nehmen können. Auch weiß man, dass er regelmäßig neu erschienene Zeitschriften las.
Anzunehmen ist auch, dass Friedrich in seiner Jugend in Greifswald eine profunde Bildung erhielt, dass die Aufenthalte in Kopenhagen und Dresden ihn intellektuell weiter schärften – kurz, all das bringt die Herausgeber zu der Annahme, dass C.D. Friedrich nicht nur selbst schrieb, sondern sogar „ nicht auszuschließen ist, dass Friedrich darüber nachdachte, eigene Texte oder Gedichte mit bildlichen Darstellungen zu kombinieren“.
Erhalten sind von Friedrich zahlreiche Briefe, die er vor allem an die Familie in Greifswald schrieb, wo man sie aufbewahrte (und sie 1924 erstmals publiziert werden konnten). Dazu kommen Schreiben an Freunde, Auftraggeber oder Institutionen. Die vorliegende Korrespondenz umfasst die Jahre von 1800 bis 1836, von dem 26jährigen bis vier Jahre vor seinem Tod.
Und da kann man auch auf fröhliche Albernheiten des jungen Mannes stoßen: „…vor einiger Zeit kamm ich auf einen Dollen Einfall, ich wollte nemlich wissen obs woll möglich wäre wenn ich mich recht hertzhaftin mein Bette würfe durch und durch zufallen, ich probierte es, und glücklich ich brach durch, über diese Leichtfertigs⟨keit⟩ wurde unsre Madam orndlicher Weise ein bischen böse.“
Das zeigt dem Leser, worauf er sich einlässt, nämlich eine Sprache, die in ihrer gelegentlichen Steifheit und Geschraubtheit eben doch an die 200 Jahre von uns entfernt ist, was die Lektüre mühsam macht. Wobei angesichts mancher Formulierungen und Schreibweisen natürlich zu bedenken ist, dass es zu dieser Zeit (was auch die Brüder Grimm beklagten) keine verbindliche Orthographie der deutschen Sprache existierte.
Über die Briefe hinaus bietet das Buch Texte zu kunstkritischen und kunsttheoretischen Fragen, was ja auch nicht von allen Künstlern überliefert ist. Das langste Manuskript darunter trägt den umständlichen Titel „Äußerungen bei Betrachtung einer Sammlung von Gemählden von größtentheils noch lebenden und unlängst verstorbenen Künstlern“.
Die Herausgeber berichten weiters: „Daneben sind kleinere Texte überliefert: die bereits erwähnten Gedichte, tagebuchartige Aufzeichnungen und aphoristische Notizen sowie ein etwas längerer Prosatext, Eine Sage, in der Friedrich einen mehrfach überlieferten legendenhaften Erzählstoff um einen Kelch wiedergibt.“ Dazu ist richtig zu bemerken, dass das nicht wenig Schriftliches von einem Künstler ist, der sonst mit Zeichenstift und Pinsel agierte.
Letztendlich war Friedrich ja doch ein Künstler, der „meine Gedanken auf der Leinewand hingepinselt“ hat, wie er einmal formulierte. Widerspruch und Zweifel, ob man überhaupt versuchen sollte, Kunst mit Worten zu definieren, hat er in einem Brief auch hinterlassen: „Ich bin keiner von den sprechenden Mahlern deren es jetzt so viele giebt, so im stande sind vierunzwanzig mal in einem Athem zu sagen was Kunst ist werent sie nicht imstande gewesen in 24 Jahren ein einzig mal in ihren Bildwerken zu zeigen was Kunst ist.“
Andererseits resümiert Johannes Grave, der im Vorwort in der Interpretation von Friedrichs Texten sehr weit geht und auch Bezüge zu Dichtern seiner Zeit (etwa Novalis) herstellt: „Als Texte, die nicht nur Informationen enthalten, sondern auch in ihrer eigenen sprachlichen Gestalt über den Künstler, sein Denken und seine Arbeit Auskunft geben, sind Friedrichs Schriften und Briefe noch immer zu entdecken. Sie werden für die Beschäftigung mit seinen Bildern insbesondere dann neue Perspektiven eröffnen, wenn ihnen selbst etwas zugetraut wird.“
Spezialinteresse an der Person von C.S Friedrich voraus gesetzt, haben die Bewunderer des Künstlers hier Gelegenheit, jenseits der Bilder in seine Geistes- und Gedankenwelt einzutreten. Und dennoch, um sich selbst auch hier zu widersprechen – wenn am Ende des Buches Hauptwerke von C.D. Friedrich wiedergegeben werden und ihre unglaubliche Wirkung auch in der Reproduktion entfalten, fühlt man sich auf die alte Erkenntnis zurück geworfen: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Renate Wagner

