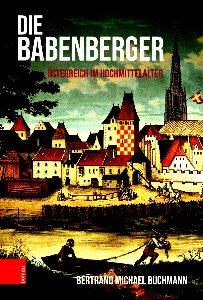
Bertrand Michael Buchmann
DIE BABENBERGER
ÖSTERREICH IM HOCHMITTELALTER
248 Seiten, Böhlau Verlag, 2024
Sie schufen „Österreich“
Natürlich waren die Habsburger länger da, und für den Tourismus lässt sich mit ihnen, ihren Schlössern, ihren farbigen Gestalten besser werben. Aber das Geschlecht, das für sie die Herrschaft bereitete, indem sie österreichische Kernlande als politische Einheit schufen, waren die Babenberger.
Von 976 bis 1246 – also immerhin 270 Jahre lang -. machten sie aus damals unwirtlichen, bewaldeten Gebieten von Niederösterreich und Oberösterreich bewohnbares Land für die Menschen, sorgten für Städte, Verkehrswege, Klöster, für Lebensverhältnisse und Kunst und Kultur. Nach wechselnden Residenzen wurde Wien zu ihrem Zentrum. Eine Leistung über neun Generationen mit zwölf Vertretern der Familie, von denen sechs Leopold, je zwei Heinrich und Friedrich und je einer Adalbert und Ernst hießen. Heute stehen sie mit ihren Beinamen in der Geschichte, die ihnen erst später von Historikern verliehen wurden, so wie sich die Babenberger selbst noch gar nicht so nannten.
Der früher an der Wiener Universität tätige Historiker Bertrand Michael Buchmann verfügt außer über einen höchst lebendigen Erzählstil über eine ganz wichtige Eigenschaft: Er kann historisch denken, Dinge aus ihrer Zeit heraus begreifen. So weiß er, dass wir uns Menschen und Lebensform der spätmittelalterlichen Epoche in unserem digitalen Zeitalter einfach nicht vorstellen können. Also war ihm, als er „noch ein Buch über die Babenberger“ schrieb, besonders wichtig zu versuchen, das Verständnis für diese Zeit und Welt den Lesern zu vermitteln.
Dabei wirft der Autor schon im Vorwort die heute immer wieder gestellte Frage auf, wie legitim es ist, die Geschichte der Menschen anhand ihrer Herrscher zu erzählen. Aber sie waren es schließlich, die die Macht hatten, etwas zu gestalten, und das haben so gut wie alle Babenberger zielbewusst getan. Bis heute ist der „Bürger“, egal, welchem Beruf er nachgeht, ob reich, ob arm, abhängig davon, wie die Politik ein Land lenkt. Insofern ist es sogar nötig, von den Herrschenden zu erzählen – die Schicksale einzelner Menschen liegen dann eher in der Hand (und der Phantasie) der Romanschreiber.
Jedenfalls sind die Babenberger, wie der Autor resümieren kann, „in Summe gesehen, als durchaus positiv zu würdigen“, wobei sie erst am Ende, bevor das Geschlecht ausstarb, dunklere Züge annahmen… Wie sie als Menschen waren, weiß man nicht, diese Art von Quellen gibt es nicht. Man kann sie nur an ihren Taten messen, aber auch an ihren Beziehungen, ihren Ehen, ihrer Einbindung in das Heilige Römische Reich, an dessen östlicher Grenze sie sich befanden.
Leopold I., der auch der Erste der Babenberger in „Ostarrichi“ war, wurde von Kaiser Otto II. im Jahre 976 als Belohnung für treue Dienste hier als „Markgraf“ eingesetzt. Leopolds Familie kam aus dem fränkisch-bayerischen Raum und hatte sich nun im Osten zu bewähren, wo die Ungarn drohten, während im Norden die Polen nahe waren.
Ältere Österreicher werden sich noch erinnern, wie aufgeregt im Jahre 1996 mit der Tausend-Jahr-Feier der „Ostarrichi“-Urkunde quasi das Gründungsdokument Österreichs begangen wurde – denn da hieß es „ in regione vulgari vocabulo Ostarrîchi dicitur“. Die Urkunde, die zwar in die Babenberger-Zeit fiel, aber mit ihnen nichts zu tun hatte, weil es um die Schenkung eines Gebietes an den Bischof von Freising ging (und beweist, dass Bürokratie schon damals blühte), fixiert den Namen – später von den Nationalsozialisten als „Ostmark“ umgedeutet.
Es war tatsächlich die Mark im Osten des Reichs, die nun von den Babenbergern – immer in die Geschichte des Heiligen Römischen Reichs einbezogen, sehr auch an den Kreuzzügen beteiligt – entwickelten, vergrößerten, stabilisierten. Der Autor erzählt das chronologisch von Persönlichkeit zu Persönlichkeit und kann auch viele „Grausamkeiten“ der Epoche erklären.
So starb der erste Leopold bei einem Attentat, das dem Manne galt, mit dem er sich gerade unterhielt – der Schütze hatte (die Lichtverhältnisse waren wohl nicht besonders) daneben geschossen und den Babenberger getroffen der solcherart 54jährig in Würzburg starb, aber genügend Nachkommen hinterließ. Der Autor erzählt auch von der Ermordung des später „heiligen“ Koloman, ein irischer Mönch, der auf der Rückreise aus dem Heilligen Land in Stockerau für einen Spion gehalten wurde, den man folterte und henkte und erst später, als an seinem Grab Wunder geschahen, zum „Heiligen“ erklärte (er war der Patron Niederösterreichs, bis Leopold III. auch er ein „Heiliger“, ihm den Rang ablief). Aber man muss die Ermordung Kolomans einfach aus einer Welt begreifen, wo die Bedrohung von außen stets virulent war und die Menschen meist in Angst lebten und solcherart zu brachialen Maßnahmen griffen…
Vor den Babenbergern mussten sich die Bewohner ihrer Länder (die sie klug ausweiteten) erst fürchten, als es zu dem letzten Vertreter der Familie kam, zu Friedrich II,, dem Streitbaren, dessen „glorreicher“ Vater Leopold (nicht als Erster der Familie übrigens) mit einer byzantinischen Prinzessin verheiratet war. Die spektakulärste Babenberger-Ehe war allerdings jene von Leopold III. mit Agnes, der Tochter eines Salier-Kaisers, die hochkarätige Verwandtschaftsbeziehungen mitbrachte. (Die „Schleier“-Geschichte zur Gründung Klosterneuburgs wurde später erfunden.)
Ihr Sohn Heinrich II, der bayerische Gebiete (die der Kaiser an Heinrich den Löwen zurückgab – es ging wild zu im Mittelalter) gegen den Herzogstitel tauschte, erhöhte damit Österreich vom Markgrafentum zum Herzogtum. Von dessen Sohn, Leopold V., kennt auch ganz England die Geschichte, wie er nach einem Streit bei dem Kreuzzug König Richard Löwenherz in Dürnstein festsetzen ließ und dafür eine gigantische Summe lukrierte.
Nach dem Tod des letzten Babenbergers, Friedrich II., der kinderlos starb, heiratete der Böhmenkönig Ottokar dessen Schwester Margarete und erhob Anspruch auf Babenberger-Lande – aber wie es weiter ging, wissen wir ja von Grillparzer: Auftritt der Habsburger, die dann von hier aus ihre gewaltige Monarchie errichteten und außerdem jahrhundertelang die Kaiserwürde im Heiligen Römischen Reich okkupierten. Die Basis-Arbeit für diesen Aufstieg hatten ihnen allerdings die Babenberger abgenommen, denen man in diesem Buch höchst lebendig begegnet.
Renate Wagner

