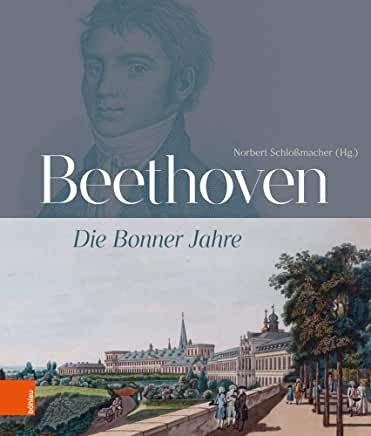
Norbert Schloßmacher (Hg.)
BEETHOVEN
DIE BONNER JAHRE
560 Seiten, Verlag Böhlau, 2020
Das Beethoven-Jahr ist noch nicht vorbei, wenn es auch durch die Corona-Pandemie fast untergegangen ist. Nicht auszudenken, wie man unter „normalen“ Umständen den Meister gefeiert hätte! Immerhin hat es sich die Stadt Bonn nicht nehmen lassen, ihren berühmtesten Sohn (denn ganz „einwienern“ kann man ihn ja doch nicht) ausgiebig zu würdigen – und damit selbst.
Das ist nämlich das Besondere an dem voluminösen Band, der „Beethoven. Die Bonner Jahre“ behandelt – von der Stadt selbst gefördert, mit jeglicher Bonner Unterstützung (auch in der herausragenden Bebilderung) gestaltet, geht es zwar natürlich um Beethoven, aber auch um die Stadt selbst, die damals trotz des „Kleinstadt-Charakters“ in Bezug auf die rund 10.000 Einwohner umfassende Bevölkerung dennoch ein geradezu strahlendes kulturelles Zentrum war.
Und Beethoven hat Kindheit, Jugend und junges Mannesalter hier verbracht, bis er 22 war, und ohne die Prägung und Ausbildung, die er hier erfuhr, hätte er sich in einer so anspruchsvollen Stadt wie Wien nicht dermaßen (und auch dermaßen schnell) durchsetzen können. Es lohnt sich also, den Blick auf dieses Bonn gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu werfen – und sich zu fragen, wie Beethoven hier geprägt wurde. Es gibt viele neue Ansätze und interessante Antworten, und Herausgeber Norbert Schloßmacher, Leiter des Bonner Stadtarchivs, wird seinem Versprechen im Vorwort gerecht, dass hier wahrlich nicht immer derselbe alte Wein in neuen Schläuchen kredenzt wird. Dieses Buch geht weit darüber hinaus, in allen Artikeln wissenschaftlich akribisch genau gearbeitet, aber auch für Laien absolut rezipierbar.
Einzelbetrachtungen setzen sich mosaikartig zu einem Bild von Bonn in der Beethoven-Zeit zusammen. Schon bevor der Habsburger Maximilian Franz (1756-1801) hier das Amt des Kurfürsten übernahm, war die Stadt – die faktisch ganz von dem kurfürstlichen Hof geprägt wurde, der Arbeitgeber für viele Untertanen und viele Künstler war – ein „aufgeklärtes“ Zentrum unter dessen Vorgänger, dem Kurfürsten Max Friedrich (1708 -1784), der in seiner Eigenschaft als Kurfürst von Köln und Fürsterzbischof von Münster auch vorwiegend in Bonn residierte und ein aufgeklärtes Regime führte, um das man nach seinem Tod fürchtete.
Aber Maximilian Franz, der als sein Nachfolger nach Bonn kam, war ganz der Bruder von Joseph II., seinerseits ein toleranter, volksnaher Aufklärer, der seine Sparsamkeit nicht bei der Kunst zur Anwendung brachte und etwa als Sammler von Musikhandschriften und Drucken berühmt war, abgesehen davon, dass er – wie alle Habsburger damals – Musik aktiv aufübte, als versierter Bratschist, als Pianist und Sänger, der auch zum Vergnügen und nicht nur zur Repräsentation selbst musizierte . Ein eigener Artikel befasst sich nur mit der enormen Bedeutung der Musik für diesen Kurfürsten, was die ganze Welt um ihn herum prägte, und mit seiner allseits anerkannten persönlichen Kompetenz in Bezug auf dieses Thema. Die Musikbibliothek, die er nach Bonn mitbrachte, umfasste mehrere tausend Werke. Klar gestellt wird auch, dass die Vorliebe dieses Fürsten nicht, wie oft behauptet, Mozart, sondern vielmehr Haydn galt, der mehrfach in Bonn Station machte.
Beethoven befand sich immer im Fokus des Kurfürsten, der (wie später sein Neffe, Erzherzog Rudolph, in Wien) als Förderer dieses Musikers gelten kann, der damals dennoch nur ein Talent unter sehr vielen war. Wer weiß, dies als Gedankenexperiment, zu dem dieses Buch anregt – vielleicht wäre Beethoven nach Wiener Jahren wieder in das überschaubarere und glanzvolle Musik-Biotop Bonn zurück gekehrt, hätten die Napoleonischen Kriege das nicht unmöglich gemacht – 1794 (Beethoven war gerade zwei Jahre in Wien) wurde das Rheinland von französischen Truppen besetzt, Frankreich einverleibt, das ganze Leben (zumal rund um den Hof) brach zusammen, der Kurfürst musste nach vergeblichen Kämpfen letztendlich resignieren und verbrachte den Rest seines Lebens bis zu seinem Tod 1801 vergessen in Wien…
Bonn erweist sich (in Spezialartikeln) als Stadt, in der gezielt und auf Bildung ausgerichtet gelesen wurde, es gab erstaunliche Privat-Bibliotheken, es gab Möglichkeiten, dass interessierten Bürgern (von denen es offenbar viele gab) stets das neueste Wissen zur Verfügung stand. Die 1787 gegründete Bonner „Lesegesellschaft“ (kurz „Lese“, ihre Bestände finden sich heute im Beethoven-Haus) gelangte zu einiger Berühmtheit. Als Kurfürst Maximilian Franz nach Bonn kam, brachte er eine persönliche Bibliothek von erstaunlicher Reichhaltigkeit mit (alles detailliert aufgeführt).
So wichtig wie das Lesen und die Musikliteratur waren die Instrumente, die den Musikern zur Verfügung standen, und da befand sich Bonn auf einem hohen Standard. Behandelt wird auch, welches Instrumentalmusik-Repertoire dem jungen Beethoven hier begegnete. Entscheidend für das Geistesleben Bonns waren schließlich zahlreiche intellektuelle Gruppierungen, zu denen zeitweise auch die Freimaurer und die Illuminaten (die an die Weltverbesserung durch Erziehung glaubten) zählten.
Beethoven-nahe sind Artikel wie jene über seine Vorfahren und seine Eltern, wo das gern und locker verstreute Vorurteil vom desolaten Heim, in dem er aufwuchs, widerlegt wird. Man liest über die Geburt und die Taufe des „Ludovicus“ am 17. Dezember 1770, was den 16. Dezember als seinen Geburtstag nahe legt (und das Buch nützt die Gelegenheit, sich auch mit der Taufkirche St. Remigius näher zu befassen). Man setzt sich auf die Spuren seiner Jugendfreunde, von denen einige lebenslang für ihn wichtig waren, man erfährt Detailliertes etwa über die Musikerfamilie Ries (drei Generationen Musiker, wie auch bei den Beethovens), die für das Musikleben von Bonn und das daneben liegende Godesberg (ein weiterer kurfürstlicher Residenzort) entscheidend waren: Nur in einer aktiven, hochrangig besetzten Musik-Landschaft konnte Beethoven schon in der Jugend zu seinem eigenen Rang empor wachsen.
Interessant Franz Gerhard Wegeler, Jugendfreund, später Arzt (und als solcher brieflich konsultiert), Beethoven lebenslang im Briefverkehr verbunden, verheiratet mit Eleonore von Breuning, Tochter aus jener Familie, die für Beethoven in Bonn so wichtig gewesen war. Wegeler und Ferdinand Ries (der in Wien eine zeitlang als Beethovens Getreuer fungierte) haben nach dem Tod des Komponisten die wohl wichtigsten persönlichen Zeugnisse an ihn hinterlassen. Behandelt wird auch der Jugendfreund Johann Joseph Eichhoff (der später beruflich beim Wiener Kongress zu tun hatte und Beethoven dabei wieder sah), Und es gibt eine hochinteressante Studie zum unsteten Leben des Grafen Waldstein (mit der Erklärung, was der böhmische Adelige eigentlich in Bonn zu suchen hatte, der sich mit der Formulierung „Mozart’s Geist aus Haydens Händen“ ewig in die Beethoven-Geschiche eingeschrieben hat), wobei seine Rolle als beschenkter Günstling des Kurfürsten nicht gänzlich aufzuklären ist.
Besonders interessant ist der Versuch von Autor Helmut Loos, Christian Gottlob Neefe in seiner (selbst berichteten) Bedeutung als Beethovens Lehrer in Frage zu stellen. Allerdings behandelt jeder Autor, auch wenn er andere Informationen hat und beisteuert, im Grunde dasselbe Grundmaterial (das nur für Interpretationen offen ist), und so wird man Neefe in einem anderen Artikel (von Dieter Haberl) voll in der Eigenschaft, die er sich zuschreibt, anerkannt finden… Interessant auch die Beziehung zu Nikolaus Simrock, anfangs musikalischer Kollege Beethovens in Bonn, später als Verleger, der es mit dem (damals allerdings nicht in unserem Sinn existierenden) Urheberrecht nicht so genau nahm, mit Beethoven oft im Clinch war.
Mit besonderer Akribie wird Beethovens erste Reise nach Wien, die ihn mindestens vier Monate von Bonn fern hielt, untersucht. Schließlich geht es immer wieder um die nach wie vor nicht zu beweisende Frage, ob Beethoven damals wirklich Mozart getroffen hat. Indem die Schritte des jungen Mannes zwischen Ende 1786 und wohl Mai 1787 so lückenlos wie möglich verfolgt werden und man ja auch Mozarts Aufenthalte kennt, ist zumindest zu beweisen, dass beide sechs Wochen lang zugleich in Wien geweilt haben, was ein persönliches Treffen ermöglicht hätte. Die Forschung ist noch nicht zu Ende – nun müssten die Wiener Quellen für Beethovens ersten Aufenthalt noch penibler betrachtet werden. Auch ein Forschungswerk geht nie zu Ende…Wie Bonn, wo man verspätet vom Tod seines ja wohl doch berühmtesten Sohnes erfahren hat, Beethoven nachtrauerte, wird jedenfalls noch ausführlich geschildert.
Von der Logistik des „Buchmachens“ her hat dieser an sich großartige Band einen schweren Fehler: Die Anmerkungen, die – und das ist lobenswert – hinter jedem Artikel angebracht sind, was großes Blättern erspart, sind (vermutlich, um sie deutlich vom Fließtext abzutrennen) allerdings so hell gedruckt, dass es schlechtweg unmöglich ist, sie zu lesen (und es gibt Leute, die sich für Anmerkungen interessieren). Weitgehend kompensiert wird dieses Manko durch ein exzellentes Layout und opulentes Bildmaterial: das Bonner Beethoven-Haus und die anderen Institutionen der Stadt haben nicht nur bildliches, sondern auch dokumentarisches Material der Art beigestellt, aus dem man Faktisches erschließen kann.
Das Ergebnis des Buches: Ludwig van Beethoven kam aus einer Welt, die im Kleinen das Große und Beste seiner Epoche abbildete.
Renate Wagner

