
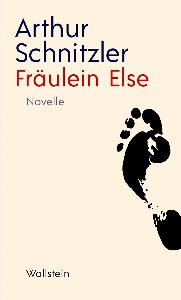
Arthur Schnitzler: Doktor Gräsler, Badearzt
Hg., kommentiert und mit einem Nachwort von Michael Scheffel
189 Seiten, Verlag Wallstein, 2025
Arthur Schnitzler: Fräulein Else
Hg., kommentiert und mit einem Nachwort von Michael Scheffel
133 Seiten, Verlag Wallstein, 2025
Beide Bände erscheinen in der Reihe:
Arthur Schnitzler. Kommentierte Studienausgabe
Mit Gewinn neu gelesen
Viele große Dichter haben von der Nachwelt und der Wissenschaft historisch-kritische Ausgaben ihrer Werke erhalten. Arthur Schnitzler nicht. Zwar hat die Akademie der Wissenschaften in jahrzehntelanger bewundernswerter Arbeit seine Tagebücher in zehn Bänden heraus gebracht (allerdings nur Text und Personen-Register, ohne Anmerkungen), es gibt auch eine in allen Handschriften dokumentierte „Liebelei“, aber sonst muss man sich bei ihm an Einzelausgaben oder (auch schon sehr alte) Gesamtausgaben halten.
Der deutsche, in Göttingen beheimatete Wallstein Verlag hat nun das Projekt einer „kommentierten Arthur Schnitzler Studienausgabe“ zwischen Buchdeckeln (basierend auf einem digitalen Forschungsprojekt) gestartet. Der Verlag hat schon ein Kompendium mit Schnitzlers „Träumen“, den Briefwechsel mit Hermann Bahr und eine Sammlung von zeitgenössischen Artikeln über den Dichter herausgebracht. Nun folgten, als erste Bände der „kommentierten Studienausgabe“, die in Nachworten das „aktuelle Wissen“ zu Schnitzler berücksichtigen wollen, „Doktor Gräsler, Badearzt“ und „Fräulein Else“.
Es handelt sich bei diesen beiden Werken um eine gewissermaßen künstlerisch umstrittene Novelle – und um ein singuläres, zu allen Zeiten bewundertes Meisterwerk.
Umstritten war der „Doktor Gräsler“ schon bei den Zeitgenossen, wenn selbst ein so notorisch liebenswürdiger Kollege wie Stefan Zweig seine Zweifel äußerte. Und dieser deutsche Arzt mittleren Alters, der in den Sommern in Ferienorten (wie etwa Lanzarote) und im übrigen in kleinen deutschen Badeorten ordiniert, ist einfach ein ziemlich unsympathischer Zeitgenosse – die Charakteristik als geborener Junggeselle, Sonderling, Egoist und Philister geht keinesfalls an der Figur vorbei.
Nachdem seine Schwester, von der er eigentlich nichts wusste, die aber seinen Haushalt führte, verstorben war (durch Selbstmord übrigens), zeigen seine Begegnungen mit gewissermaßen „typischen“ Frauen – der „Mondänen“ Sabine, die weibliche Selbständigkeit fordert, und einer kleindeutschen Version des „süßen Mädels“ -, dass der Arzt beziehungsunfähig ist.
Der deutsche Germanist Michael Scheffel, der gemeinsam mit Wolfgang Lukas das Forschungsprojekt „Arthur Schnitzler. Digitale historisch-kritische Edition (Werke 1905-1931)“ leitet (wobei man sich fragt, warum ab 1905 – davor ist doch eine Menge Essentielles und auch Meisterliches entstanden!), hat für beide Bücher die Nachworte geschrieben.
Zuerst geht es um die Entstehungsgeschichten, wobei es Schnitzler der Wissenschaft leicht macht, da er in seinen Tagebüchern sehr ausführlich über Ideen, deren Ursprünge und deren Entwicklung berichtet hat. In der Interpretation geht es dann um das Psychogramm jenes männlichen Egoismus, der letztendlich zur Einsamkeit führt (wofür einem Gräsler deshalb leid tun sollte?).
Mit „Fräulein Else“ hat sich die Mitwelt und die Nachwelt stets leichter getan, dieser „innere Monolog“ (im Stil von Schnitzlers „Leutnant Gustl“) wurde bei seinem Erscheinen 1924 sofort als Meisterwerk erkannt und bejubelt, mit dem leisen Erstaunen vielleicht, wie sich ein über sechzigjähriger Dichter in die Seele einer verwirrten Neunzehnjährigen einfühlen konnte.
Mochte die Novelle bei ihrem Erscheinen das Hautgout des Skandalösen (bei Schnitzler stets immanent) gehabt haben, präsentiert sich die Heldin doch nackt in der Hotelhalle allen Gästen – ein grandioser Akt feministischen und gesellschaftlichen Protests schon damals -, so sehen wir heute andere Aspekte in dem Werk, die Michael Scheffel in seinem Nachwort allerdings kaum am Rande berücksichtigt. Ganz abgesehen davon, dass Geld die Gesellschaft beherrscht (und Else keine Stellung darin zu erwarten hat, wenn ihr Vater wirklich verarmt oder gar als Defraudant ins Gefängnis muss), geht es doch um einen erschütternden Akt von Ausbeutung durch den eigenen Vater. Denn als dieser die Tochter anfleht, bei dem reichen Herrn von Dorsday eine größere Summe für ihn zu leihen, weiß dieser genau, dass der alte Lebemann sich dafür bezahlen lassen wird – und schickt die Tochter gleichsam in das Nutten-Schicksal.
Auch in der Welt von #metoo erzählt Else von dem an ihr begangenen Unrecht (in heutiger Sicht: Nötigung und damit ein Verbrechen). Und der Text liest sich unvermindert spannend. Wobei man auch den „Doktor Gräsler“ mit vielleicht etwas milderem Blick auf den Egoisten mit Gewinn neu lesen kann.
Renate Wagner

