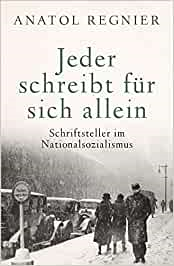
Anatol Regnier
JEDER SCHREIBT FÜR SICH ALLEIN
Schriftsteller im Nationalsozialismus
366 Seiten, Verlag C.H.Beck, 2020
Anatol Regnier, Jahrgang 1945, stammt aus einer Künstlerfamilie: Seine Mutter, die Schauspielerin Pamela Wedekind, war die Tochter des Dichters Frank Wedekind, sein Vater der bekannte Schauspieler Charles Regnier. Er selbst erlebte schon in der frühen Nachkriegszeit das Gefühl, dass er nicht gern ein „Deutscher“ war – eine Verkrampfung, die sich erst im Lauf der Jahre löste.
Es war die Lektüre von Hans Falladas „Jeder stirbt für sich allein“, die ihn erst spät in seinem Leben auf die Spur der Dichter im Nationalsozialismus brachte (und dessen Titel er für sich variierte). Er ist dem Thema jahrelang gefolgt (u.a. im Deutschen Literaturarchiv in Marbach) und hat ein bemerkenswertes Buch darüber geschrieben (an dem man nur bedauert, dass es nicht ein einziges Bild enthält – und da wäre doch so manches auch zu zeigen gewesen).Wenn übrigens Tilly Wedekind (hier in ihrer Eigenschaft als Geliebte von Gottfried Benn) immer wieder auftaucht, erwähnt der diskrete Autor mit keinem Wort, dass es sich um seine Großmutter handelt..
Grundsätzlich ist Regnier nicht den einfachen Weg gegangen, ein Schicksal nach dem anderen abzuhandeln (er tut es nur ausnahmsweise in einem Fall, bei Jochen Klepper). Vielmehr erzählt er die Geschichte chronologisch von 1933 an, bis über den Krieg hinaus, wo dann die Schriftsteller, die sich als teils glühende Anhänger des Regimes bekannten, ihre Rechtfertigungen verfassten und erwarteten, dass man ihnen ihr Leugnen glaubt…
Anfangs blendete Regnier immer wieder in die Sitzungen der Preußischen Akademie der Künste, die nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten systematisch von Juden und politischen Gegnern (und es gab viele „linke“ Schriftsteller) gesäubert wurde. (Goebbels verkündete schon 1935 triumphierend, im Kulturleben des Volkes sei kein Jude mehr tätig.)
Dann verschränken sich die Einzelschicksale, wobei einige Dichter in dem Buch eine zentrale Stellung einnehmen, vor allem Hans Fallada und Gottfried Benn. Nur einer fehlt gänzlich unbegreiflich in dem Buch (bis auf ein paar nebenbei fallen gelassene Bemerkungen): Gerhart Hauptmann, der bekanntlich erst 1946 gestorben ist, zwar versucht hat, sich vom Nationalsozialismus fern zu halten, aber zumindest als Künstler, der vereinnahmt wurde, hier seinen Platz gehabt hätte (immerhin nahm ihn Hitler unter die „Gottbegnadeten“ auf).
Die deutsche literarische Landschaft entfaltet sich in großartiger Dichte, viele Einzelpersönlichkeiten werden charakterisiert, ihr gänzlich unterschiedlicher Zugang zu Hitler und seiner Welt geschildert, von schrankenloser Zustimmung bis zu vorsichtigem, opportunistischem Lavieren. Und manche haben einfach Ungeheuerliches an Verdrängung geleistet, um nicht auf das reagieren zu müssen, was rund um sie geschah.
Regnier steht keinesfalls mit der Rute da, er äußert zwar immer wieder Erstaunen (etwa im Fall von Ina Seidl, die immer wieder ausführlich im Mittelpunkt steht), weiß aber auch, dass Menschen, die nicht emigrieren wollten, dann schlicht und einfach überleben mussten. Sie lebten in einer Welt, wo zumindest vor dem Krieg ein Großteil der Bevölkerung hinter dem Regime stand. Als Otto Flake, mit einer halbjüdischen Frau verheiratet, eine „Grußbotschaft“ an Hitler unterzeichnete (er und weitere 87 deutsche Autoren), notierte er: „Wenn ich mir durch die Unterschrift Ruhe und meiner Frau Schutz verschaffen konnte, warum nicht.“
Natürlich kommen auch jene vor, die Haltung bewahrten, aber unter den Emigranten sind es vor allem Thomas Mann und sein Sohn Klaus (der mit einer wütenden Emigranten-Zeitschrift viel Unruhe verbreitete, aber bald damit scheiterte), die als leidenschaftliche Gegner des Regimes ins Zentrum rücken. Sie haben sich solcherart bei ihren Landsleuten weder während des Krieges noch danach beliebt gemacht – Thomas Mann wurde nach seiner Rückkehr nach Deutschland mit ablehnender Distanz empfangen, während man Gustaf Gründgens demonstrativ zujubelte, als er wieder auf die Bühne durfte…
Auch an die Opfer des Regimes wird gedacht, Juden, die sich so „deutsch“ fühlten und denen man den Boden unter den Füßen wegzog: Jakob Wassermann, Lion Feuchtwanger, Ludwig Fulda, und andere Gegner, die gewissermaßen zu Tode gehetzt wurden wie etwa Kurt Tucholsky.
Da waren also die Jubler: der Dramatiker Hanns Johst, Hans Grimm, Will Vesper (ganz am Ende des Buches besuchte Regnier dessen Tochter, um dort auf die Spuren von Vespers Sohn zu treffen, der ein Genosse von Gudrun Ensslin war…), Börres von Münchhausen, Rudolf G. Binding, Werner Beumelburg, Ernst Wiechert (der sich später ganz auf die „innere Emigration“ zurück gezogen haben wollte), Agnes Miegel, würdevolle Anhängerin Hitlers. Frank Thiess, anfangs selbst Nationalsozialist, hat nach dem Krieg all die Kollegen, die ihre Taten unter den Tisch kehren wollten, mit wilden Attacken und mit genauen Beweisen, „was sie im Dritten Reich gelobt und gefeiert“ hatten, zur Rechenschaft gezogen.
Und, wie gesagt, Gottfried Benn, dem seine verbrecherische Zustimmung zum Dritten Reich (mit dem Plädoyer gegen unwertes Leben) allerdings auf die Dauer nicht gut bekam, der aus der Gunst der Nazis fiel – und nach dem Krieg seine zweite Karriere machte… Der Fall Hans Fallada (der keinesfalls zu glorifizieren ist) lag anders, aber auch er bog und verbog sich, um sein Überleben zu sichern, und er plante noch mitten im Krieg einen antijüdischen Roman (der ihn, wäre er erschienen, für die Nachwelt vernichtet hätte) – und der dann mit „Jeder stirbt für sich allein“ den gültigen Roman aus der Zeit des Nationalsozialismus geschaffen hat. Erich Kästner plante es auch, tat es aber dann nicht – er gilt bis heute als der „anständige Deutsche“, der sich durch die Zeit durchlavierte, ohne sich die Hände schmutzig zu machen (was der Autor dann allerdings auch in Frage stellt).
Nach dem Krieg gab es kaum Einsicht, aber jede Menge Verteidigungsstrategien. Damals, unmittelbar danach, ist es manchem noch gelungen, seinen Beitrag zu dem Mörderregime zu bagatellisieren. Wie wir heute wissen, hat die Nachwelt nicht vergessen. Aber dass weit mehr zu erzählen (und auch zu bedenken) ist, als ein paar Einträge in Online-Netzen vermuten lassen, das beweist dieses Buch, das reichlich und anschaulich auf Originalzitate zurück greift.
Renate Wagner

