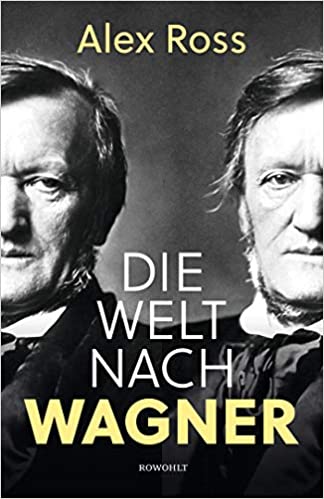
Alex Ross
DIE WELT NACH WAGNER
Ein deutscher Künstler und sein Einfluß auf die Moderne
Übersetzt von Gloria Buschor und Günter Kotzor
Originaltitel: „Wagnerism“
908 Seiten, Rowohlt Verlag, 2020
Dieses Buch reflektiert die alt bekannte Erkenntnis, dass jeder, der in den Bann von Richard Wagner gerät, seinen eigenen Wagner sucht und findet, dass jeder sich von ihm nimmt, was ihm persönlich konveniert, und dass das Angebot in dessen Werk (und dem wilden, widersprüchlichen Leben) so breit ist, dass sich damit scheinbar alles (und dessen Gegenteil) beweisen lässt.
Das wird am Beispiel von Einzelmenschen, Nationen und Ideologien nachgezeichnet. Richard Wagner – die ultimative Projektionsfläche. Noch nie hat man so viel darüber erfahren wie von dem Amerikaner Alex Ross, bekannter Musikkritiker in den USA, der nun ein Mammutwerk zu diesem Thema vorlegt.
Der deutsche Titel, „Die Welt nach Wagner“, trifft es allerdings nicht exakt, der „Wagnerism“ des Originals ist treffender. Denn über weite Strecken wird noch Wagners Wirkung auf die Zeitgenossen behandelt, da ist der Komponist (und die umstrittene Persönlichkeit, die er war) noch sehr am Leben. Allerdings beginnt das Buch mit dem „Tod in Venedig“, womit man nach seinem letzten Atemzug sofort mit dem „Nachleben“ einsetzen kann. Dieses erklärt der Autor auch zu seinem Ziel: der „Wagnerismus“, wie er auf schier alle Ebenen des Lebens hinein gewirkt hat, Wagner der Sozialist, der Feminist, der Wagner der Schwulen (was, wenn man sein Nachwort richtig versteht, auch für den Autor persönlich wichtig war), der Wagner für die Schwarzen, die Theosophen, die Satanisten, die Dadaisten, die Filmemacher – und natürlich der Wagner in der Politik, links, rechts, überhöht, radikal, alle haben nach ihm gegriffen. Dafür braucht man schon fast 800 Seiten Text plus Anhang.
Vieles „spielt“ noch zu Wagners Lebzeiten, die Auseinandersetzung mit Nietzsche (er, Wagner, der „Ring“, der Übermensch, das war die Mischung, die viele anbetungswürdig fanden und viele infernal). die tremolierende Begeisterung mancher Zeitgenossen, die Beziehung zu König Ludwig II., präzise auf den Punkt gebracht: Auch als sich die anfängliche gegenseitige Begeisterung legte, konnten sie ohne einander nicht leben – Ludwig nicht ohne Wagners Musik, Wagner nicht ohne Ludwigs Geld… Dieses Thema gehört allerdings auch noch zu Wagner als Ikone der Schwulen, ein Hetero, der dennoch viele Saiten anschlägt, die Homosexuelle erfühlen. Schließlich hatte der Dichter / Komponist seinen kriegerischen Anhängern mit Siegfried den rücksichtslosen Helden, mit Parsifal den anderen das ephebenhaft zarte Geschöpf geschenkt…
Auseinandersetzungen rund um Wagner wurden und werden stets mit höchster Emotionalität geführt (es scheint irgendwie nie abzuflauen, dass er eine „Erregung“ darstellt), Ausbrüche von extremer Hysterie waren nicht selten. Wie viele Verehrer sind, metaphorisch gesprochen, nicht selig in seine „endlose Melodie“ eingetaucht (und möglicherweise darin ertrunken).
Er hat nicht nur „Normalmenschen“, Musikfreunde, Opernfreaks erregt, er hat auch Künstler aller Genres inspiriert und beeinflusst. Dichter haben, sich auf Wagners Todessehnsucht beziehend, ihre Figuren in hektische Liebestode (und –Morde) geschickt. Man hat Wagner knieschlotternd verehrt und verächtlich abgetan – von der Parteien Gunst und Haß verwirrt… Ein „Gott“ war er für Stephane Mallarmé, „absolute shit“ für W.H. Auden.
Auf dem Gebiet der Literatur ist Alex Ross besonders ergiebig, unglaublich, wo er da Beziehungen findet und etwa beweist (ehrlich, wer hätte das gewusst, zumal das Buch ja als unlesbar gilt), dass es in „Finnegans Wake“ von James Joyce 178 Anspielungen auf den „Ring“ und 242 auf „Tristan“ gibt? Nun, der Autor hat über Joyce dissertiert, aber er wird auch bei Gott und der Welt der Literatur Wagner-fündig, bei Virginia Woolf ebenso wie in Romanen, die in den USA über Sänger (und oft Wagner-Sängerinnen) geschrieben wurden… auch ein neues Feld für viele, die meinten, sich bei Wagner auszukennen. Und wie endlos kann man sich, obwohl das Thema weit bekannter ist, mit Thomas Mann und seinem Wagner-Bild auseinander setzen, desgleichen mit dem kritischen und doch sehr Wagner-affinen G.B. Shaw – und bei Bert Brecht, der nach jugendlicher Wagner-Begeisterung vom Meister Abstand nahm, findet man seine Modell-Inszenierungen auf den Spuren von Wagners Gesamtkunstwerk. Interessant der Charaktervergleich beider, den der Autor anstellt – beide Schufte, die ihre Umwelt ausbeuteten, beide opportunistische Wendehälse der Politik, wie sie es gerade brauchten. Treffend gesagt,
In 15 Kapiteln, die in den Titeln Wagner-Werke oder –Begriffe ins Zentrum stellen, schweift der Autor Wagner-fündig durch die Welt. Nationen haben bei ihm immer wieder innere und äußere „Verwandtschaft“ gesucht – die Franzosen fanden sie in seiner Modernität, die Engländer im Grals-Mythos, der aus ihrem König Artus-Sagenkreis stammt, aber auch die Katalanen (angeblich in Besitz der Gralsburg Monsalvat) beanspruchten ihn für sich, in Brüssel spielte man besonders gern „Lohengrin“, ist dessen Ort der Handlung doch Antwerpen.
Ein Buch im Buch ist das Thema Wagner-Musik im Film – quasi eine filmwissenschaftliche Arbeit von großer Ausführlichkeit, die weit über den Hubschrauber-Angriff zum Walkürenritt in dem Vietnam-Film „Apocalypse Now“ hinaus geht…
Der Autor führt auch in Bereiche, an die man gar nicht gedacht hätte – es gibt auch eine afro-amerikanische Wagner-Community, an die sich die Rassismus-Frage knüpft, nicht gänzlich identisch mit der des Antisemitismus.
Dieser bekommt allerdings breiten Raum: Nie kann man die Tatsache vergessen, dass er eine Generation lang „Hitlers Wagner“ war. Wie alle Interpreten, die selbst keine Deutschen sind, also nicht von Scham und Haß der eigenen Vergangenheit herumgetrieben werden, kann Alex Ross da die Dinge nüchterner sehen, ohne Geifer im Mund, ohne Entschuldigung auch, in voller Ambivalenz (auch wenn es um Wagner in Israel heute geht): „Ein Künstler, der wie Aischylos oder Shakespeare universelle Anerkennung in greifbarer Nähe hatte, wurde erfolgreich auf eine kulturelle Abscheulichkeit reduziert – auf die Begleitmusik des Genozids.“ Tatsächlich erzählt der Autor von KZ-Insassen, die dort mit Wagner-Musik empfangen wurden. „Und doch überlebte der Wagnerismus Hitlers Liebe.“
Wagner und die Juden ist einer der größten Themenkomplexe, der lange vor Hitler zurück geht: Richard Wagner war in seiner Ablehnung des Judentums allerdings (auch wenn das nichts entschuldigt) Erbe einer Jahrhunderte alten deutschen Tradition (nicht zu denken, wie Luther gegen die Juden hetzte), kam aber in eine Periode, wo der „Antisemitismus“ quasi neu erfunden wurde – zum Argument der Christusmörder und der Kapitalisten kam das Rassen-Denken, das die Unterschiede zu den anderen „wissenschaftlich“ begründen wollte. Jedenfalls waren die Juden für Wagner eine lebenslange Obsession, wenn er auch nie (wie auch in seinen politischen Ansichten) eine einheitliche Linie fuhr: Das macht ihn ja so schwer greifbar.
Die Wunsch-Vorstellung liberaler Wagnerianer, dass Wagner zwar theoretisch über Juden geschrieben hatte, es aber keine Juden in seinem Werk gäbe, beendete Theodor W. Adorno, als er Alberich, Mime und Beckmesser zu Juden erklärte (und eine nimmer endende Diskussion anheizte).
Die Instrumentalisierung Wagners für politische und militärische Zwecke begann schon im Deutsch-Französischen Krieg des 19. Jahrhunderts, setzte sich im Ersten Weltkrieg fort, und wenn dort die „Siegfried-Linie“, die „Wotan-Stellung“, das „Unternehmen Alberich“ und der „Plan Hagen“ von Kriegsfakten erzählten, so war es im Zweiten Weltkrieg nicht anders.
Hitlers Liebe zu Wagner (und dessen von niemandem bestrittene intensivste Detailkenntnis des Werks) war, so meint Ross, allerdings ein privater Spleen, über den sogar gelächelt wurde, abgesehen davon, dass starren Ideologen der „Tannhäuser“ und der „Parsifal“ zu „katholisch“ waren, was im Dritten Reich unerwünscht war. Hitler war das egal, für ihn konnte Wagner nichts falsch machen. Dass es Bilder von ihm als „Lohengrin“ kostümiert gab, kam ihm wohl kaum lächerlich vor, die Gleichstellung Hitler=Wagner (die heute wieder vor allem in der deutschen Interpretation verankert ist) kann ihn nur beglückt haben. Dass seine Liebe das Wagner-Bild, immer schon umstritten, für die Nachwelt endgültig besudelt hat, daran ist wohl nichts zu ändern. Aber man sollte den klugen, distanzierten Blick des Autors gelten lassen und die „Schuld-Frage“ (ohne Wagner kein Holocaust?) vielleicht doch differenzierter betrachten.
Es ist ausgeschlossen, auch nur anzudeuten, was man in diesem Buch noch alles zum Thema Wagner findete. Die Lektüre ist ungemein anregend in in ihrer Vielfalt, in der schier unglaublichen Fülle von Wissen, das hier transportiert wird. Der Autor ist Wagner geradezu überall hin gefolgt und hat die erstaunlichsten Erkenntnisse und Ergebnisse zu Tage gefördert. Ein Monumentalwerk – die Sache will’s. Für Wagnerianer ein Geschenk und unverzichtbar.
Renate Wagner

