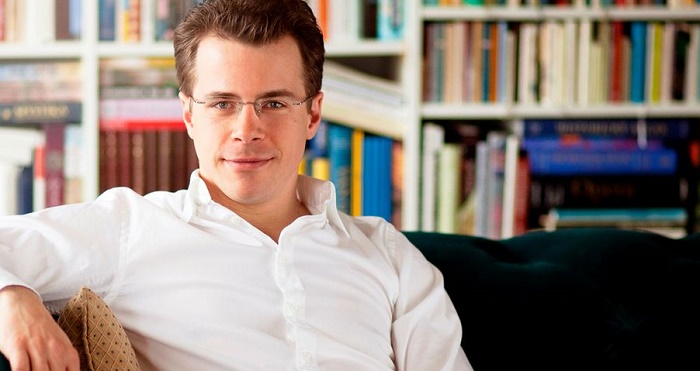
Jakub Hrusa. Foto: Petra Klackova
WIEN/MUSIKVEREIN: Ein Konzert der Wiener Philharmoniker wurde zum Gedenken an Mariss JANSONS
1.12. 2019 (Karl Masek)
Mit Mariss Jansons ist ein ganz Besonderer, ein ganz Großer am 1.12. 2019 im Alter von 76 Jahren in St. Petersburg gestorben. Selten habe ich so viele berührende Nachrufe über einen Künstler, einen Musiker, gelesen wie an diesem Tag. „Mit ihm öffnete sich der Himmel“, titelte der KURIER. Ein Denker und Mahner, ein Humanist war er – und ein grandioser Dirigent, der ungezählte musikalische Sternstunden bereitet hat. Dabei ein Fragender, ein Zweifler, ein Perfektionist, ein Insistierer. Aber alles auf eine besonders liebevolle Art, wie Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer in seinem Nachruf betonte.

Foto: Fritz Krammer
Beklommen, von Trauer erfüllt, die Stimmung an diesem Montagabend, als Musikvereinsintendant Thomas Angyan mitteilte, dass die Wiener Philharmoniker diesen Abend des Ehrenmitglieds der Gesellschaft der Musikfreunde mit W.A. Mozarts Mauereischer Trauermusik, KV 477, gedenken würden. Man spielte ohne Dirigent – und während der anschließenden Trauerminute konnte man die berühmte Stecknadel fallen hören…
Jansons sollte an diesem Wochenende wieder Konzerte der Wiener Philharmoniker leiten. Doch gesundheitliche Probleme, zusätzlich ein Riss der Achillessehne, zwangen den Maestro schon vor Wochen zu erneuter Absage. Schon die Konzerte der Wiener Festwochen und schließlich bei den Salzburger Festspielen 2019 mussten ausfallen, weil der Maestro auf dringendes ärztliches Anraten eine „Auszeit“ nahm. Man konnte den in Brünn geborenen Jakub Hrůša, derzeit Chefdirigent der renommierten Bamberger Symphoniker, für die Übernahme der aktuellen Konzerte mit teilweise geändertem Programm gewinnen.
Béla Bartók und Peter Iljitsch Tschaikowskij standen auf dem Programm – dieselben Komponisten, die Jansons bei seinem Debüt mit den Wiener Philharmonikern Mitte der 90er Jahre furios dirigiert hat: Die „Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ und die „Pathétique“. Ich saß damals im Konzerthaus auf einem Platz in Orchesternähe. Nie werde ich vergessen, mit welcher Konzentration „an der Sesselkante“ gespielt wurde und mit welcher Anspannung vor allem die Schlagzeuger bei den vertrackten Rhythmen des Béla Bartók mitgezählt haben!
Diesmal das Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll (Jansons hätte das 3. Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow auf dem Programm gehabt) und das Konzert für Orchester, Sz 116, aus Bartóks letzten Lebensjahren im amerikanischen Exil.
Für das monumentale Tschaikowskij-Klavierkonzert, ein beinahe zu oft gespieltes „Schlachtross“ der Klassikprogramme, fand man, so hatte ich den Eindruck, erst so nach und nach zusammen. Denis Matsuev, geboren im sibirischen Irkutsk, spielte den Stirnsatz noch eher al fresco, mehr mit roher Kraft als mit Differenzierung. Erst im Andantino semplice fand man zu gleich gestimmtem Musizieren und poetischer Klangmalerei. Vollends im Konzertalltag angelangt waren Dirigent, Solist und Orchester schlussendlich beim zündenden Allegro con fuoco.
In der Pause naturgemäß der Gedanke, Jansons hinterlässt eine riesige Lücke, die nicht so bald zu schließen sein wird. Und auch die Traurigkeit darüber, was man noch alles von ihm gerne gehört hätte. Vor allem Opern, nicht zuletzt nach den fulminanten Salzburger Aufführungen von Pique Dame sowie Schostakowitschs Lady Macbeth….“! Aber nach jedem Ende – so traurig es auch sein mag – kommt ein neuer Anfang. Die Binsenweisheit, das Leben muss weitergehen…
Mit Jakub Hrůša und den Philharmonikern könnte sich nach dem Konzertdebüt mit Bartóks „Opus summum“ eine erfreuliche Zusammenarbeit entwickeln, deutet man die starke Akklamation seitens der Musiker nach Ende des Konzerts. Da war viel Wertschätzung zu spüren. Man spielte das fünfsätzige Meisterwerk mit äußerster klanglicher Raffinesse, rhythmischer Prägnanz. Man gab dem Einspringer für sein souveränes Dirigat (klare Schlagtechnik, ausgeprägter Gestaltungswille) alle orchestralen Farben der Klage in der zentralen „Elegie“, alle Sehnsuchtstöne nach der verlorenen Heimat, aber auch tänzerische, federnde Leichtigkeit im 2. Satz, die wundersamen Valeurs der Flöten, Fagotte, Harfen, seidigen Streicherklang, den geheimnisvollen Choral des Blechs. Aber auch das parodistische Element, wenn völlig überraschend und ansatzlos Lehárs Lustige Witwe wie ein banaler Gassenhauer zitiert wird, und schlussendlich die klanglichen „Amerikanismen“ im Finale (Pesante-Presto).
Dennoch, man war in Gedanken an diesem Abend bei dem Verstorbenen. Der Applaus war herzlich. Zum Jubeln war jedoch kaum einem zumute.
Karl Masek

