Amilcare Ponchielli: I Lituani ◊ Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras ◊ Vorstellung: 10.09.2025
(4. Vorstellung ◊ Premiere am 05.09.2025)
Historische Oper brandaktuell
: Mit der ersten litauischen szenischen Aufführung von Ponchiellis Dramma lirico «I Lituani» ist dem Litauisches Nationaltheater für Oper und Ballett ein grosser Wurf gelungen. Hugo de Ana zeichnet für die szenische Umsetzung die Verantwortung.
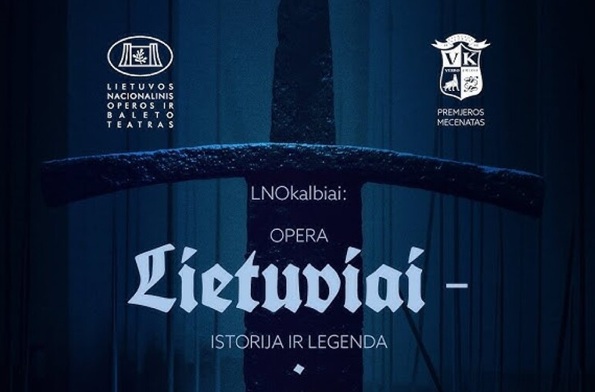
Amilcare Ponchielli gehört zum grossen Kreis jener Komponisten, die dem Publikum heute nur noch mit einem Werk bekannt sind.
Geboren am 31. August oder 1. September 1834 in Paderno Fasolaro (heute zu des Komponisten Ehren Paderno Ponchielli), gehört Ponchielli zur Generation der Komponisten zwischen Verdi (*1813) und Puccini (*1858). Nach erstem Musikunterricht durch den Vater begann er mit 9 Jahren mit einem Freiplatz das Kompositionsstudium am Mailänder Konservatorium. Zwei Jahre nach seinem Abschluss wurde 1856 am Teatro Concordia in Cremona seine erste Oper «I promessi sposi» uraufgeführt. Hier hatte er sich niedergelassen und verdiente mit verschiedenen Stellungen seines Lebensunterhalt. Die überarbeitete Fassung von «I promessi sposi» wurde zum Wendepunkt seiner Karriere: Die Sängerin der Lucia, Teresa Brambilla, wurde zwei Jahre später seine Gattin, und der Erfolg des Werks veranlasste Giulio Ricordi (nachdem Verdi abgelehnt hatte) Ponchielli den Kompositionsauftrag zu «I Lituani» zu geben. Mit der Uraufführung am 7. März 1874 im Teatro alla Scala konnte Ponchielli einen Achtungserfolg verbuchen; die Uraufführung der überarbeiteten Fassung (6. März 1875, Teatro alla Scala) wurde dann zu einem durchschlagenden Erfolg. Mit «La Gioconda» feierte am 8. April 1876 (Teatro alla Scala; Uraufführung der endgültigen Fassung am 12. Februar 1880 in Mailand im Teatro alla Scala) jenes Werk seine Uraufführung, das die grosse Mehrheit heute noch kennt.
«I Lituani» steht wie die übrigen Opern Ponchiellis im Schatten von «La Gioconda» und so ist die Aufführungsgeschichte überschaubar. Aufführungen sind aus Brescia, Cremona, Mailand (Teatro da Verme), Rom, Turin, Triest und St.Petersburg (1884; dort auf Grund der zaristischen Zensur unter dem ursprünglich vorgesehenen Titel «Aldona») überliefert. Bevor die Litauer für längere Zeit von den Spielplänen verschwanden, dirigierte Arturo Toscanini 1903 drei Vorstellungen an der Scala. 1939 war eine Aufführung in Vilnius geplant, die dann aber der Zweite Weltkrieg zunichtemachte. Mit einer konzertanten Aufführung entriss Gianandrea Gavazzeni 1979 in Turin das Werk der Vergessenheit. In der Folge kam es 1981 und 1983 zu Aufführungen durch die Lithuanian Opera Company of Chicago, 1981 in Toronto und 1984 in Cremona. 1991 kam es zu einer Kooperation von der Lithuanian Opera Company of Chicago und dem Litauischen Nationaltheater für Oper und Ballett mit Aufführungen im Mai in Chicago und im Herbst, nach der Anerkennung der Souveränität der drei baltischen Staaten durch die Sowjetunion, in Vilnius. Zum Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung Litauens (1009 in den Quedlinburger Annalen) wurde «I Lituani» 2009 auf der Wasserburg Trakai und zum 80. Geburtstag der Litauischen Nationalphilharmonie in Vilnius aufgeführt (2025 beim Label accentus erschienen; hier https://onlinemerker.com/cd-amilcare-ponchielli-i-lituani-lietuvos-nacionalinis-simfoninis-orkestras-modestas-pitrenas/ von Kollege Krobot besprochen). Von 2021 bis 2025 wurde die Oper jährlich am Nationalfeiertag (6. Juli) im Hof des Grossfürsten-Palast gegeben.
Die Idee aus dem Epos «Konrad Wallenrod» des polnischen Schriftstellers Adam Mickiewicz eine Oper zu machen wurde von Salvatore Farina, Schriftsteller und seit 1869 Redakteur der «Gazzetta Musicale di Milano», an seinen Dienstherren Tito I Ricordi herangetragen. Farina, Mitglied der Künstlervereinigung «La Scapigliatura», seit den 1870ern mit seinen Romanen auch in Deutschland erfolgreich und bis 1914 dreimal (vergeblich) für den Nobelpreis für Literatur nominiert, war zu beschäftigt das Libretto zu verfassen, und so beauftragte Ricordi Antonio Ghislanzoni, den Librettisten der überarbeiteten Fassung von «La forza del destino» und «Aida», mit der Abfassung. War Mickiewicz Vorlage schon nicht historisch, sondern frei gestaltet, so verloren im Laufe der Umarbeitung des Epos zum Opernlibretto die Charaktere an Tragik (aus Charakteren werde Archetypen) und die Handlung an Stringenz. Die «historische Genauigkeit» tritt hinter die romantischen «Motive», als da wären Emotionen, «exotische» Schauplätze, Freiheitskämpfe, Chor- und Tanz-Szenen und den Chor als Symbol der Nation, zurück. Ein entscheidendes Kriterium wird im Europa der entstehenden Nationen die Vergleichbarkeit gegenwärtiger Situationen mit der Vergangenheit. Im frisch vereinigten und jetzt unabhängigen Italien waren die in den Lituani geschilderten Emotionen besonders gut nachvollziehbar. Auch wenn das Kriterium der «bürgerlichen Repräsentation» fehlt, sind die Parallelen zur französischen Grand Opéra nicht zu übersehen. Was er hier in «I Lituani» vorbereitet, wird er dann in «La Gioconda» zur Meisterschaft führen.
Die Handlung von «I Lituani» spielt im 14. Jahrhundert in Litauen und auf der Marienburg, der Hauptburg des Deutschen Ordens in Pommern (in der Nähe der Stadt Danzig). Regisseur Hugo de Ana (Regie, Bühnenbild und Kostüme) erzählt die Geschichte eng am Libretto und hält den Handlungsraum abstrakt, um die Archetypen gut erkenntlich herausarbeiten zu können. Schon die «Sinfonia» weist auf seine universelle Sicht hin: Das Video (Videos: Sergio Metalli) führt von der Erdkugel zur Geschichte der Oper und zurück ins Weltall. Schon hier fällt auf, dass die Helme der Ordensritter (in den Übertiteln bis zum letzten Bild konsequent als «Teutonen» bezeichnet) deutlich an die deutschen Stahlhelme des zweiten Weltkriegs erinnern. Den Bühnenraum gestaltet de Ana mit kassettierten Wandelementen, Stahlsäulen und Videoeinblendungen. Das Mittelalter ist so im Kopf des Zuschauers immer präsent, aber nie staubig-museal, sondern lebendig und offen für andere Interpretationen. Der Freiheitskampf und die Emotionen führen als roter Faden (als überdimensioniertes Knäuel real auf der Bühne präsent durch den Abend). Mit wenigen Versatzstücken gelingen so starke, beeindruckende Bilder, wie Arnoldo, der als Gefangener sein Leid einem überlebensgrossen Christus auf dem Kreuz klagt. Ob die Erscheinung des Helden Corrado, der Liebe und Leben opfert, um Litauen zu befreien, als «Cristo morto», mit langen Haaren und starken Gesichtszügen, gewollt ist oder nicht bleibt unklar. So wird der Archetyp des Erlösers beeindruckend deutlich. Im Laufe der Geschichte, in der sich der Litauer Walter mit List als Corrado zum Hochmeister des Deutschen Ordens wählen lässt und dann Leben und Liebe opfert, um seine Heimat zu befreien, gelingt es de Ana mustergültig den Gegensatz zwischen Massenszenen und intimen Momenten herauszuarbeiten. Besonders eindrücklich beginnt der dritte Akt. Eine Video-Collage mit einer Feuerwalze und Ordensrittern (der Leser möge sich an das zu den Helmen gesagt erinnern) vor einer Kirche der Backstein-Gotik illustriert die laufende Schlacht, die der Deutsche Orden schliesslich verlieren wird. Und hier wird jetzt erschütternd eindrücklich der Stellenwert der Freiheit klar: Was im Mittelalter geschehen ist und sich 1945 wiederholt hat, kann heute genauso wieder geschehen. Es droht ein übermächtiger Feind das kleine Land zu überfallen. Nun wird für den Mitteleuropäer klar, warum sich die Litauer (wie die übrigen Balten und die Polen) so eminent bedroht fühlen. Die wegen «verstärktem militärischen Luftverkehr» verspätete Anreise bestätigt den Eindruck nur noch. «Es ist nicht notwendig, die Umgebung zu realistisch darzustellen, damit sie die Bedeutung von Leid und Krieg im Leben der Helden und der gesamten Menschheit verstehen» (Hugo de Ana im Programmheft): Mit dieser Arbeit ist de Ana ein grosser Wurf gelungen.
Dem Choreographen Michele Consentino gelingt es vorzüglich, die grosszügig besetzten Kollektive von Statisterie, Ballett und Chor auf der riesigen Bühne zu arrangieren. Die Szene wirkt nie überladen, denn die Akteure haben reichlich Bewegungsfreiheit. Die Beleuchtung durch Vittorio Alfieri fügt sich nahtlos in das stimmige Konzept ein.
Das Orchester des Litauischen Nationaltheaters für Oper und Ballett unter musikalischer Leitung von Ričardas Šumila spielt grandios auf und lässt Ponchiellis Partitur spannungsgeladen in den schillerndsten Farben erklingen. Kritik auf hohem Niveau wäre es anzubringen, dass die Tempi etwas rascher und die Lautstärke etwas differenzierter sein könnten.
Der Chor des Litauischen Nationaltheaters für Oper und Ballett (Künstlerische Leitung: Česlovas Radžiūnas) legt klingendes Zeugnis ab, warum die Wende im Baltikum auch als «Singende Revolution» bezeichnet wird. Gerade in einer «patriotischen» Oper laufen die Sänger zu Hochform auf. So bleiben keine Wünsche offen, denn hier ist exquisiter Chorgesang der Sonderklasse zu erleben!
Viktorija Miškūnaitė gibt mit grossem, vollen Sopran die Aldona, die Geliebte Walters/Corrados und Schwester Arnoldos. Die Stimme trägt im Grossen Haus tadellos und überzeugt in den lyrischen wie dramatischen Szenen. Zwischenzeitlich schlichen sich in den Höhen leichte Schärfen ein. Denys Pivnitskyi nimmt die Rolle des Walter/Corrado Wallenrod mit vollem szenischen Einsatz in Angriff. Mit heldentenoraler Attitüde spielt er mit überzeugender Bühnenpräsenz. Auch bei ihm sind kurzzeitig Ermüdungserscheinungen zu erkennen. Tadas Girininkas gibt den Barden Albano mit eindrucksvollem charakteristischen Bass. Eugenijus Chrebtovas gibt den Arnoldo mit gut geführtem, ansprechenden Bariton. Bei der Klage seines Schicksals am Kreuz läuft er zu grosser Form auf. Konstantin Toman ergänzt das Ensemble als Verschwörer Vitoldo, der Walters/Corrado Wallenrods Position beim Deutschen Orden ins Wanken bringt.
Fazit: Hier ist grosse Oper zu erleben. Der Abend zeigt, wie eine «historische Oper» plötzlich brandaktuell sein kann.
Weitere Aufführungen: 30.01.2026, 18:30; 31.01.2026, 18:30; 01.02.2026, 18:00.
12.09.2025
La Marchesa d’Obigny

