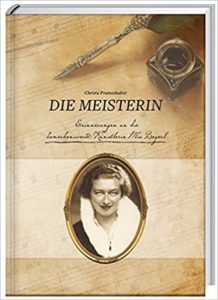
Christa Prameshuber:
DIE MEISTERIN
Erinnerungen an die bemerkenswerte Künstlerin Mia Beyerl
112 Seiten, Trauner Verlag, 2018
Der Titel „Die Meisterin“ erweckt hohe Erwartungen – als bekäme man eine vergessene Größe der Vergangenheit präsentiert. Vielleicht hätte es Maria Anna „Mia“ Beyerl (1900-1989) mit ihrer schönen, wenn auch nicht allzu großen Altstimme auch tatsächlich zu einer Karriere auf Opernbrettern gebracht – aber da kam 1929 eine Diphtherie-Erkrankung dazwischen, die diesen Traum zerstörte. Tatsächlich kehrte die Linzerin danach von Wien in ihre Heimatstadt zurück und konnte ihre musikalischen Fähigkeiten nur noch als Klavier- und Gesanglehrerin verwenden – von ihren Schülern liebevoll „die Meisterin“ genannt.
Eine besondere Bewunderin hatte Mia Beyerl in ihrer Großnichte Christa, mit der sie die letzten 20 Jahre ihres Lebens in einem Haus wohnte und auf die sie besonderen Einfluß hatte. Die Beyerl waren eine Familie, in der man der eigenen Historie besondere Aufmerksamkeit schenkt. Darum konnte Christa Zihlmann-Prameshuber über die eigenen, ausführlichen Erinnerungen hinaus auf jede Menge Material zurückgreifen (eine handschriftliche, über 500 Seiten dicke Familienchronik ist vorhanden, außerdem jede Menge Familienfotos, von denen man viele sieht), um bis zu den Ururgroßeltern hinab und über Mia im besonderen zu erzählen. Wobei es vielleicht noch Linzer gibt, die sich an das pompöse Spielwarengeschäft „Heinrich Beyerl“ am heutigen Hauptplatz erinnern…
Tante „Mia“, die sich selbst diesen Namen gab, als sie nach Wien ging, um ihrem musikalischen Talent die nötige Ausbildung angedeihen zu lassen, war von Anfang an Rebellin, im Gegensatz zu ihrer „braven“ Schwester (der Großmutter der Autorin), die nie aus der Reihe tanzte und das Familiengeschäft übernahm. Mia hätte auch – sagt die Großnichte – Dirigentin werden können, wäre damals schon die Zeit dafür reif gewesen. Später konnte sie ihre Individualität nur durch allseits bewunderte Exzentrik ihrer Existenz beweisen – den Aufstieg in die Künstlerkreise verhinderte das Schicksal, aber ihre Persönlichkeit, ihr Selbstbewusstsein waren ungebrochen.
So kann die liebende, bewundernde Großnichte nur die Eigenheiten – man kann auch sagen: Marotten – der verhinderten Künstlerinnen-Tante schildern, die sich elegant anzog und Schmuck anlegte, wenn eine Radioübertragung aus der Staatsoper anstand, die sie dann selbst „mitdirigierte“ und harsche Urteile fällte (Karajan versteht nichts von Mozart!).
Ihr Liebesleben war nicht glücklich, der Mann, der ihre große Leidenschaft war, erzählte ihr nichts von seiner Frau und seinen vier Kindern, und im übrigen wahrte sie Diskretion (so wie in der Familie auch absolut nie über das Dritte Reich gesprochen wurde). Immerhin – unkonventionell, wie sie war, legte sie doch auf gutes Benehmen großen Wert. Die Großnichte, die ihr in diesem Buch ein so schönes Denkmal setzt, scheint ihr einiges zu verdanken.
Renate Wagner

