CD WOLFGANG AMADEUS MOZART – Symphonien Nr. 39-41, KAMMERAKADEMIE POTSDAM, ANTONELLO MANACORDA; Sony
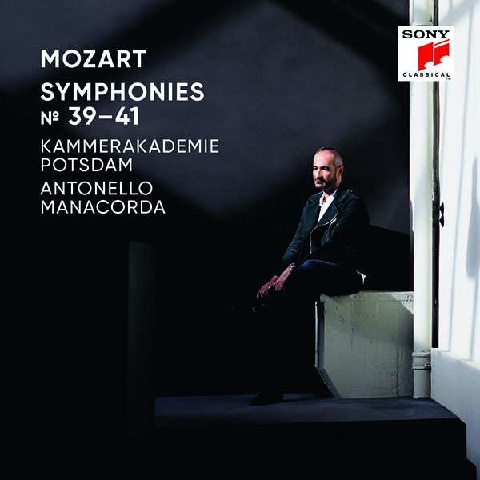
Es ist ja das Wesen der historisch informierten Aufführungspraxis, auch Symphonisches als dramaturgisch bühnenähnliche Performance mit in den einzelnen Instrumentengruppen dialogisierend aufschäumenden Akzenten, kämpferischen Bogenstrichen und softer blubbernden Bläsern aufzufassen. Natürlich beschränkt sich der sogenannte „Originalklang“ und all das, was dazu gehört, nicht auf die Auswahl eines historischen Instrumentariums (so viele alte Instrumente gäbe es ja gar nicht), sondern verlangt vor allem nach spezifischen Spielweisen, denen eine ganz besondere geschärfte Klangvorstellung zugrunde liegt, und womit eine originär verstandene, unverwechselbare Ausdrucksskala erzeugt wird. Man könnte fast sagen, so viele Ensembles, so viele Herangehensweisen.
Die Kammerakademie Potsdam feiert 2021 ein doppeltes Jubiläum: Das 20-jährige Bestehen, und die zehnjährige Position des Antonello Manacorda als Chefdirigent und als künstlerischer Leiter. Aus diesem besonderen Anlass heraus hat man sich wohl die drei letzten Sinfonien von Wolfgang Amadeus Mozart vorgeknöpft. Und hat grosso modo ein durchaus dem Anlass würdiges Ergebnis erzielt.
Als „Instrumental-Oratorium“ empfand Nikolaus Harnoncourt die Symphonien Nr. 39 bis 41 in seinem letzten Anlauf dieser Gipfelwerke für Tonträger. „Mozart ist ein Theaterkomponist“, meint hingegen Manacorda. Die Statements taugen als übergeordnete Überlegungen, greifen aber insgesamt, Gott sei es gedankt, zu kurz. Denn natürlich ist auch bei Mozart weder alles Bühne, Oper noch spiritueller Raum, sondern einfach symphonischen Gesetzen gehorchende Experimentierfelder. Anm.: Die drei Symphonien wurden im Sommer 1788 in zwei Monaten komponiert. Mozart vollendete die Es-Dur-Sinfonie K 543 am 26. Juni, die g-Moll-Sinfonie KV 550 am 25. Juli und die Jupiter-Sinfonie K 551 am 10. August..
Freilich weiß Manacorda um die verführerische Kraft der Rhythmen, um das „eroicahaft“ Widerborstige, welche das Allegro im ersten Satz der Symphonie Nr. 39 in Es-Dur geradezu marktschreierisch propagiert. Im Andante gelingt Manacorda, im besonderen was die Dynamik anlangt, ein bezauberndes Spiel und Wechselspiel an Stimmungen, an Licht-Dunkel-Kontrasten, die überhaupt die Faszination seiner Interpretation ausmachen. Beim Scherzo überschreitet Manacorda nicht die protokollarischen Limits höfischer Eleganz, die Klarinette mischt sich dennoch solistisch als fescher Bauer ins tänzerische Treiben. Im Finale genießen ein stürmisches Tempo und ein schwelgerischer emotionaler Überschwang ihren Auftritt.
Ein atmosphärisch bedeutsamer Gegensatz zu der metaphysischer angelegten Symphonie in g-Moll ist greifbar, wo von der ersten Sekunde an eine vorfreudige Erregung, eine seltsam erotisch getönte Seelenunruhe vorherrschen. Ich spüre weniger von all der Trauer und Tragik, die vielen Kommentaren gemäß – aus biographischen Details abgelesen – dieser Musik anhaften soll. Manacorda und die Kammerakademie Potsdam lassen den Kopfsatz vor Binnenspannung und dramatischer Emphase bersten. Sie ziehen die Tempi jedoch sehr strikt durch, was aus meiner Sicht das einzige wirkliche Manko ausmacht. Eine etwas flexiblere und fantasiereichere Temporegie hätte aus dem Außergewöhnlichen das Ereignishafte erstehen lassen. So haftet dieser Interpretation ein wenig die Rigidität einer geheimnisarmen Erdenhaftung an. Gerade beim Andante hätte man sich hie und da mehr an Atemholen, an Fluidum, ein Mehr an himmlischer Geduld wünschen dürfen. Das Allegro assai wiederum gibt Gas, ohne wiederum den kleinen melancholischen Enklaven allzu viel Ruhe zu gewähren.
Hingegen gelingen das Kaiserlich-Zeremoniöse sowie der „exaltierte Jubel“ im Allegro vivace der Jupiter Symphonie in C-Dur überaus beeindruckend. Da formen sich Inhalt und Form, dick aufgetragene Kontrastfarben und die Liebe zum instrumentalen Details zu einem straff und stimmig gespannten Regenbogen. Für das Andante hat Harnoncourt eine schöne Überlegung formuliert: „Natürlich bauen sich auch hier von Anfang an Probleme auf. So wird im langsamen Satz das Einlassbegehren ins Heiligtum, wie später in der ,Zauberflöte‘ zweimal durch heftiges „Zurück“ abgewehrt, bevor beim dritten Mal das Tor weit geöffnet wird.“ Manacorda lässt die Themen und Motive sich frei entfalten und blühen, comme il faut. Das Menuett feiert gar kecke Urständ, hier überrascht das preußische Orchester mit gar wienerisch subtilen Töne an unberechenbarer Launenhaftigkeit. Das Molto Allegro entführt den Hörer direkt in den siebenten, wirbelwindigen Mozart-Himmel.
Fazit: Abgesehen von der allzu temporigiden g-Moll Symphonie dürfen Sie sich auf ein großes Mozart-Fest freuen.
Dr. Ingobert Waltenberger

