CD WOLFGANG AMADEUS MOZART „IMPERIAL HALL CONCERTS“ – Bislang unveröffentlichte Live-Mitschnitte 1954 bis 2020 des Bayerischen Rundfunks (BR) aus der Residenz zum 100-jährigen JUBILÄUM des MOZARTFESTS WÜRZBURG; ORFEO
Die Wahrheit ist keine Tochter der Zeit
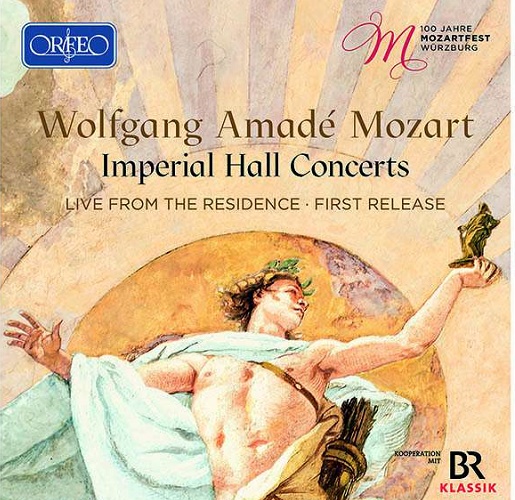
Seit 1921 gibt es das Würzburger Mozartfest schon und feiert somit heuer sein 100-jähriges Bestehen. Es will auch Raum für eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit Mozarts Musik schaffen. Konzerte mit Instrumental-, Vokal- oder Kammermusik stehen im Zentrum der rund 70 Veranstaltungen pro Jahr. Die Würzburger Residenz, Kirchen, Klöster, Weingüter, Schlossgärten oder Industriedenkmäler bieten dafür die stimmungsvollen Kulissen. Die Jubiläumssaison vom 28. Mai bis 27. Juni 2021 soll ein Spiegel von 100 Jahren Mozartfest sein und richtet den Blick auf Mozartbilder im Wandel der Zeiten. Die Ausstellung IMAGINE MOZART | MOZART BILDER, die Konzertreihe „Mozarts Europa“, die Vortragsreihe „Wie viel Mozart braucht der Mensch?“ und der Ideenwettbewerb „100 für 100“ sind zentrale Projekte des Jubiläumsprogramms. Auftragswerke von Ulla Hahn, Jüri Reinvere und Anno Schreier werden Uraufführung. Für nähere Infos siehe https://www.mozartfest.de/
Der Bayerische Rundfunk und das Label Orfeo bescheren uns zu diesem 100. Geburtstag des Mozartfests in der Würzburger Residenz eine Mozart-Box, die einen beeindruckenden Querschnitt des Konzertgeschehens bereit hält. Auf sechs CDs werden Aufnahmen des 21. Jahrhunderts hauptsächlich solchen aus den 50-er bis 80-er Jahren gegenübergestellt, die 90-er sind mit der Sinfonie Nr. 41 mit dem SO des BR unter Lorin Maazel und der Konzertarie „Ch‘io mi scordi di te?“ Non temer, amato bene“ KV 505, mit Krassimira Stoyanova und den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Christian Zacharias vertreten.
Das Grandiose an der Zusammenstellung der bisher unveröffentlichten und technisch durchwegs exzellenten Aufnahmen ist, was ein direktes Aneinanderreihen von Mitschnitten der letzten 70 Jahre offenzulegen vermag: Beim Wunder um gültige Interpretation und eine historisch kontinuierliche Mozart-Rezeption geht es nicht um die Frage „Historisch informierte Aufführungspraxis“ oder nicht. Die Übergänge sind fließender und verschwommener, als einer denken möchte. Die Fragen der Artikulation, des Bogenstrichs, der Akzente, der Rhetorik, der Tempi, der Dynamik sind eher in einem ganzheitlichen Kontext von Raum und vor allem musikalischem Genius zu prüfen. Und so verwundert es nicht, dass etwa Joseph Keilberth mit den Bamberger Symphonikern 1959 in seiner Lesart der Sinfonie Nr. 30 in D-Dur, KV 202, vielleicht anders motiviert als Sigiswald Kuijken mit seiner „La Petite Bande“ ebenso schroffe und grelle Akzente zu setzen wusste, mit denen auch Harnoncourt seine Freude gehabt hätte. Auch Rafael Kubelik ist für seine strukturbetonte Annäherung etwa an Mahler bekannt (und hier Boulez ziemlich nahe), bei ihm beben die musikalischen Vulkane in der Tiefsee des Unterbewussten. Es ist also nicht so einfach lückenlos nachzuweisen, der oder der Dirigent kommt von der Romantik und verdirbt den Mozart-Brei mit einer dicken Streichersoße bzw. andersrum sieht Mozart ausschließlich durch die strenge Brille des Barock. Die Wahrheit ist vielfältiger und
Hand aufs Herz: Letztlich geht es doch darum, ob uns eine Wiedergabe anspricht, welche Saiten sie in unserer Seele zum schwingen bringt, wie sehr sie zu berühren vermag und was wir als Hörer daraus schöpfen. Da kann nur gestaunt werden, wie sehr ein großer Musiker wie Reinhard Goebel 2014 mit dem WDR-Orchester eine sprühende „Posthorn-Serenade“ KV 320 hinlegt und Rafael Kubelik mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und einem in bester Götterlaune disponierten Alfred Brendel 1981 das Klavierkonzert Nr. 20 in d-Moll, KV 466 auf einem zeitlosen Olymp ansiedeln. Bei der virtuosen und dennoch magisch geheimnisvollen Kadenz im „Allegro assai“ wird überhaupt so mancher Mund offenbleiben.
Der vielleicht berührendste Beitrag stammt von Eugen Jochum (mit dem Kammerorchester des BR) und dem späten Edwin Fischer mit dem 1954 aufgenommenen „Rondo für Klavier und Orchester“ in D-Dur, KV 382. Der Schweizer Pianist und Brendel-Lehrer gibt eine Lehrstunde in subtilstem Klavierspiel am schmalen Grat zwischen Himmel und Erde, Klang gewordener Güte und demütiger musikalischer Dienerschaft.
Die vierte CD bringt drei unveröffentlichte Mitschnitte aus dem Konzertsektor, die an Stimmung und Intensität viele Studioeinspielungen links liegen lassen. Das Konzert für Violine und Orchester Nr. 5 in A-Dur, KV 219 mit Ana Chumachenco, dem SO des BR unter Sir Colin Davis 1987, das Klavierkonzert Nr. 21 in C-Dur, KV 467, mit Robert Casadesus, dem SO des BR unter Rafael Kubelik 1971, und dem historischen Mitschnitt des Violinkonzerts Nr. 3 in G-Dur, KV 216 mit Johanna Martzy, dem SO des BR unter Eugen Jochum.
Freunde schöner Stimmen dürfen sich auf CD 5 freuen. Hier zeigt sich besonders, wie unvergänglich vokal überwältigende Interpretationen sind. Ob Christoph Prégardien in der großen Arie des Titus „Del piu sublime scoglio“ (mit der Camerata Salzburg unter Heinrich Schiff 2004), das Mozart Traumpaar Erika Köth und Leopold Simoneau im Duett „Welch ein Geschick“ aus der „Entführung aus dem Serail“, KV 384 (mit dem SO des BR unter Eugen Jochum), die alleine schon wegen des außerordentlich edel getönten Timbres wieder zu entdeckende Elly Ameling mit der Konzertarie „Vado, ma dove, oh Dei!“, KV 583 (mit dem SO des BR unter Zdenek Mácal 1973), sie alle führen unwiderleglich vor, dass Mozart-Gesang nur dann nach den Sternen greift, wenn neben stilistischem Können auch die Qualität der Stimmen das Herz höher schlagen lässt. Und da werden wir mit wundersam und aufregend betörenden Darbietungen nahezu überschüttet: Irmgard Seefried mit der 1956 aufgenommenen Konzertarie „Non piu. Tutto ascoltai… Non temer, amato bene“, KV 490 (mit Wolfgang Schneiderhan Violine, dem SO des BR unter Eugen Jochum), das Quartett Elsie Morison, Marga Höffgen, Eric Tappy und Kieth Engen im ,Agnus Dei‘ der „Krönungsmesse, KV 317, (unter Rafael Kubelik), die wahrlich jedem historischen Vergleich stand haltende Krassimira Stoyanova mit der bereits erwähnten Arie KV 505 und Lucia Popp mit einem überirdischen „Et incarnatus est“ aus der Messe in c-Moll, KV 427 aus dem Jahr 1981, wieder unter Rafael Kubelik. Den würdigen Abschluss der CD macht eine jubelnde Diana Damrau mit lyrischer Emphase und blitzsauberen Höhen: Dieses grandiose „Exsultate, jubilate“, KV 165 (mit dem Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt unter Andrew Parrott aus 2001) sollte sich niemand entgehen lassen.
Auch Kammermusikfans kommen nicht zu kurz: Das Schumann Quartett 2018 mit dem Divertimento in F-Dur, KV 138 und das Koeckert Quartett 1977 mit dem Streichquartett Nr. 14 in G-Dur, KV 387 setzen die Klammer. Dazwischen erfreuen Kit Armstrong mit der Suite in C-Dur, KV 399, Ragna Schirmer mit der Klaviersonate Nr. 8 in a-Moll, KV 310, sowie Julian Prégardien mit dem Lied „Abendempfindung“, KV 523 mit Kristian Bezuidenhout am Hammerklavier 2018.
Im großen informativen Aufsatz „Ansichten über Mozart“ von Wolfgang Stähr wird das Gebotene in einen historischen Kontext gesetzt und ein goldener Faden durch die sieben Jahrzehnte an Interpretationsgeschichte gezogen. Sehr empfehlenswert.
Jetzt bleibt nur noch zu sagen: Die Geburtstagstorte ist gelungen, die Kerzen sind entzündet, jetzt kann gefeiert werden.
Zur Geschichte des Fests: Initiator 1921 war der Leiter des Bayerischen Staatskonservatoriums Hermann Zilcher. Vom 17. bis 26. Juni 1922 veranstaltet er die erste exklusive „Mozartwoche“. 1923 wird die Konzertreihe erstmals als „Mozartfest“ betitelt. Ab 1931 gehören auch konzertante Opernaufführungen ins Programm. 1944 findet unter dem Namen „Mozartsommer“ das letzte Mozartfest statt vor Schließung der Theater in Deutschland am 1. September 1944 und dem Bombenangriff auf Würzburg am 16. März 1945. Nach sechsjähriger Unterbrechung wird das Mozartfest 1951 wieder aufgenommen. Eugen Jochum übernimmt als Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks die künstlerische Gesamtleitung des Mozartfestes. Rafael Kubelík wird 1961 neuer Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und übernimmt ab 1962 die Leitung der Konzerte seines Orchesters beim Mozartfest. Als der Kaisersaal der Würzburger Residenz in den Jahren 1963 bis 1967 restauriert wird, muss sich das Mozartfest für vier Jahre im Wesentlichen auf die Nachtmusiken im Hofgarten beschränken. 1975 richtet das Mozartfest zum ersten Mal einen eigenen Wettbewerb aus. Ab 1977 wird der Mozartfest-Wettbewerb ausschließlich im Fach Gesang ausgetragen. Im gleichen Jahr gewinnt Waltraud Meier den Ersten Preis. Das siebte Jahrzehnt des Mozartfestes bringt erstmals Nikolaus Harnoncourt und erntet mit seinen Ansätzen einer Mozartinterpretation im Zeichen historisch informierter Aufführungspraxis nicht nur Zustimmung. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks bekommt mit Sir Colin Davis einen neuen Chefdirigenten, der ab 1985 auch in Würzburg regelmäßig Konzerte leitet. Ab 1989 erstreckt sich das Fest über ca. drei Wochen. 1991 gibt sich das Festival mit einer „Mozart-Klangwolke“ eventorientiert. Im darauffolgenden Jahr übernimmt Jonathan Seers die künstlerische Leitung: Fortan gibt es Schwerpunkte wie „Mozart versus Haydn“, „Mozart und Salieri“ oder „Mozart und die Mannheimer Schule“. Der Würzburger Generalmusikdirektor Daniel Klajner übernimmt 2001 die künstlerische Leitung des Mozartfestes und kürt 2003 mit Martin Haselböck erstmals einen „Artist in Residence“. 2005 unternimmt er mit „Mozart und die Moderne“ erste Schritte in Richtung musikalische Gegenwart. 2006, im Jahr von Mozarts 250. wird Hermann Schneider in seiner Funktion als Intendant des Theaters der Stadt Würzburg die künstlerische Leitung übertragen. Zudem wird 2006 letztmalig der Mozartfest-Wettbewerb ausgetragen. 2009 erfolgt ein weiterer Wechsel: Die Stadt Würzburg überführt das Mozartfest in eine eigenständige bei der Stadt angesiedelte Organisationsstruktur und beruft Kirchenmusikdirektor Christian Kabitz zum künstlerischen Leiter. Unter seiner Leitung öffnet sich das Mozartfest weiter in die Stadt hinein. Mit 61 Veranstaltungen an 23 Spielstätten hat das Mozartfest seinen für die weiteren Jahre gültigen Umfang erreicht. „Mozart trazoM. Musik im Spiegel“ lautet das Festivalthema und ist Symbol für die Neuausrichtung des Mozartfestes unter der Intendanz von Evelyn Meining: Der Dialog mit der Gegenwart wird zum wesentlichen Moment. Künftig wird ein Jahresmotto das Mozartfest auf eine neue Weise inhaltlich bestimmen. Jörg Widmann ist erster Artiste étoile des Mozartfestes und zugleich Komponist im Porträt. Zum ersten Mal wird das MozartLabor eingerichtet. Die Themen seither lauten „Was heißt hier Klassik?“, „Mozarts Europa“, „Mozart 36 – Was ist Reife?“, „Aufklärung. Klärung. Verklärung“, „Mozart, ein Romantiker?“ und „Widerstand. Wachsen. Weitergehen“. Die Covid-Pandemie zwingt im April zur Absage der ursprünglich geplanten Konzerte. Ein binnen weniger Wochen vollkommen neu aufgelegtes Programm präsentiert 43 Veranstaltungen.
Dr. Ingobert Waltenberger

