CD W. A. MOZART: DIE ZAUBERFLÖTE – Martin Wåhlberg dirigiert das Orkester Nord und den Chor Vox Midrosiensis; aparte
Instrumental forsch-knackig zubereitet, mit bisher unveröffentlichten Fragmenten garniert, vokal problematisch
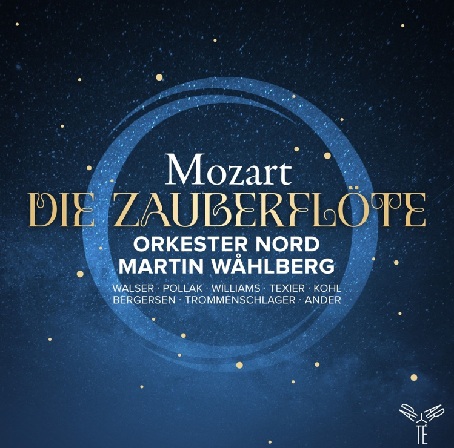
Die gegenständliche Aufnahme von „Die Zauberflöte“, 2023 in der Église Saint Michel in Pontaumur entstanden, mit ungeschnittenen Dialogen, will so etwas wie die Quintessenz davon sein, was bei der Uraufführung im Wien stattfand.
Da die Sängerinnen der Königinnen der Nacht (Pauline Texier) als auch diejenige der drei Damen (Julie Gosset, Natalie Perez, Aliénor Feix) aus dem französischsprachigen Raum kommen, ist ihr Deutsch ziemlich – nun freundlich gesagt – mit einem französischen Akzent charmiert behaftet. Ich wollte mich schon darüber aufregen, aber – wie im Booklet aus einem Text von Catharina von Bülow hervorgeht – wurde offenbar aus der (sprachlichen) Not versucht, eine Tugend zu machen. Da die Personen der Oper aus verschiedenen Sphären kommen, entschied man sich dazu, um die unterschiedlichen Lokalitäten und Gruppen zu unterscheiden, für die dunkle Welt der Königin der Nacht, samt den drei Damen und Monostatos (Olivier Trommenschlager) in den Dialogen die Aussprache und den „natürlichen“ französisch gefärbten Deutsch-Akzent der Protagonisten zuzulassen. Dieses Prinzip gilt auch für die lichte Welt der Sonne mit Sarastro, Papageno und Tamino, deren Interpreten aus deutschsprachigen Ländern / bzw. Schweizer Regionen kommen. Das ist, was etwa die deutschsprachige Seite anlangt, besonders im Falle der Sprechrolle des dritten Sklaven lustig, weil der im wildesten Schwäbisch schludert.
„Die Zauberflöte“ entstammt einer Zusammenarbeit Mozarts mit dem Schauspieler, Sänger, Komponisten und Theaterimpresario Emanuel Schikaneder. Er führte im Freihaustheater auf der Wieden u.a. Werke der französischen opéra comique, z.B. von Nicolas Dalayrac, auf. Auch für das Jahr 1791 bildete eine französisch literarische Vorlage das Gerüst für „Die Zauberflöte“. Der philosophische Märchentext „La Bague de puissance“ aus der Sammlung ‚Dschninnistan‘ von Christoph Martin Wieland, sollte unterhalten, aber ebenso Diskussionsstoff über die menschliche Natur liefern und unter diesen Prämissen die Basis für ein Singspiel bilden, das eines der populärsten Musiktheaterwerke aller Zeiten werden sollte.
Wieland sammelte Übersetzungen aus zeitgenössisch-französischer, fiktionaler Aufklärungsprosa. Die ursprüngliche Geschichte dreht sich um die Entführung eines jungen Mädchens durch einen vermeintlich bösen Zauberer. Ein anderer Zauberer, der zuerst ohne böse Pläne erscheint, schickt einen jungen Mann aus, um sie zu finden. In Wahrheit will er einen Ring und die mit ihm verbundene absolute Macht. Nach den Proben, die der Bursche bestehen muss, wird der schlimme Magier aber entlarvt. Schikaneder hat die Story so abgewandelt, dass er statt des üblen Magiers die Königin der Nacht erfand und statt des Ringes eine Sonnenmeditation vorsah.
Martin Wåhlberg konzipierte „Die Zauberflöte“ als ein Hörspiel mit Vogelgezwitscher, Donnergrollen, Löwenbrüllen und anderen atmosphärisch bildlichen Geräuschen. Außerdem legte er die originalen Wiener Quellen der Orchesterstimmen des 18. Jahrhunderts zugrunde, auf die keine der Urtext-Editionen zurückgriff. In diesen Unterlagen aus den Jahren 1791 und 1792 (?) fand Wåhlberg Informationen über Details zu Pausen, Pizzicato-Spiel und darüber, wie die Instrumente ausbalanciert einzusetzen seien. „Sie zu lesen, ist wie eine Zeitreise, die uns erlaubt, über die Schultern der Musiker zu schauen, die das Werk wiederholt gespielt haben und die wahrscheinlich an Mozarts eigenen Aufführungen teilgenommen haben.“ Wåhlberg
In diesen Orchesterstimmen fand Wåhlberg neue Musik, z.B. Fragmente von Taminos „Flöten-Fantasie“, die hier zum ersten Mal eingespielt wurden. Andere historische Aspekte umfassen die wahrscheinliche Größe und Zusammensetzung des originalen Orchesters, die zwar nicht den Premierenabend widerspiegeln, aber anlässlich ähnlicher Aufführungen einige Jahre später genau dokumentiert worden sind. Da steht einer reduzierten Anzahl an (basslastiger zusammengesetzten) Streichern eine ebenso große Besetzung beim Holz gegenüber. Auch ist der Einsatz eines Hammerklaviers essentiell.
Dazu wurden bei der Aufnahme von ehemaligen Sängern aus dem 18. Jahrhundert hinzugefügte Variationen an Verzierungen sowie ein Rückblick auf die Wahl der Sängerinnen und Sänger der Hauptrollen berücksichtigt. Pamina hat Mozart für die 17-jährige Anna Gottlieb geschrieben. Um dem Alter der Uraufführungs-Sängerin zu entsprechen, hat Wåhlberg nach europaweiten Auditions mit Ruth Williams eine junge Sopranistin gefunden, die nach landläufigem Urteil viel zu leichtgewichtig für die Pamina ist. Sie klingt eher nach einem der drei Knaben als nach der weiblichen Hauptrolle und auch ihr Deutsch ist nicht makellos. Hat man sich aber erst an das androgyne Timbre und die vibratolosen Höhen gewöhnt, so hat dieser so pure Sopran in der dramaturgischen Logik des Stücks etwas stimmcharakterlich Reizvolles. Auch bei den übrigen Protagonisten will man sich an die Proportionen und das entsprechende Alter der Singschauspieler, die Mozart 1792 zur Verfügung hatte, gehalten haben.
Wie dem auch sei. Das Album birgt eine faszinierende musikdramatische Wucht und einen packenden Drive, was man Vertretern des Originalklangbewegung nicht zugetraut hätte. Der frankophile, in Frankreich aufgewachsene Norweger Martin Wåhlberg, der seine musikalische Ausbildung u.a. in Rouen absolvierte, hat mit dem 2018 gegründeten, in Trondheim ansässigen erstklassigen Orkester Nord eine hoch interessante Neuaufnahme von „Die Zauberflöte“ vorgelegt. Vor allem die instrumentale Seite begeistert nicht nur wegen ihres audiophilen Glanzes vorbehaltslos. Dabei bildet die aufgrund der spezifischen Zusammensetzung des Orchesters ein wenig andere klangliche Priorisierung eine hörenswerte Alternative und auch die (flott) gewählten Tempi, die teils harschen Akzente und die verflochtenere Interaktion von Theater und Musik überzeugen.
Problematischer ist die vokale Seite (vor allem die bereits erwähnte Besetzung der Pamina und der mir zu vibratolastige Sarastro) bzw. das gewollte Dulden der Akzente in den sehr langen gesprochenen Texten. Dabei hält die Besetzung auch positive Überraschungen bereit, wie etwa Manuel Walser als akustisch entzückenden Bilderbuch- Papageno, Pauline Texier als kräftig koloraturschleudernde Königin der Nacht oder Olivier Trommenschlager als bissigen Monostatos. Bastian Kohl als Sarastro, Angelo Pollak als Tamino, die drei Damen, Solveig Bergersen als Papagena, Kristoffer Emil Appel als erster und Filip Eshetu Steinland als zweiter Geharnischter, beide ungewöhnlich lyrisch, bieten (gediegene) Hausmannskost. Die drei Knaben sind mit Felix Hofbauer, Ludwig Meier-Meitinger und Benedikt Eberl angemessen besetzt.
Anmerkung: Mit „Die Zauberflöte“ wird die der französischen Opéra-comique gewidmete Aufnahmeserie Martin Wåhlbergs gemeinsam mit den Opern Andre Modeste Gretrys „Raoul Barbe Bleue“ sowie Egidio Romualdo Dunis Oper „Le Peintre amoureux de son modèle“ abgeschlossen.
Dr. Ingobert Waltenberger

