CD JOHN ADAMS „MY FATHER KNEW CHARLES IVES“, „HARMONIELEHRE“; Nashville Symphony, Giancarlo Guerrero; Naxos American Classics
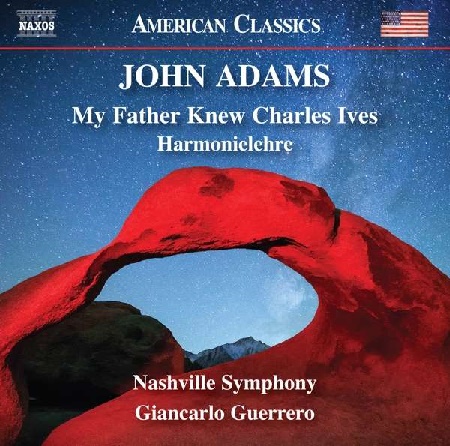
Tatsächlich traf John Adams Vater nie George Ives, den Vater von Charles Ives. Der grandiose amerikanische Symphoniker Adams sah aber Ähnlichkeiten in den Charakterzügen der beiden Männer: Sie waren Künstler, in ihren Berufen wenig erfolgreich und träumerisch veranlagt, vielleicht in eigener Sache auch zu undiszipliniert oder zu wenig motiviert, aber sie hatten ein entscheidendes Plus. Sie vermochten ihre Söhne zu inspirieren und in ihnen Begeisterung zu entfachen. Beide waren zudem Anhänger der individualistischen skeptischen Philosophie von Henry David Thoreau, der zivilen Ungehorsam predigte und lebte (wegen seiner Weigerung, Steuerschulden zu begleichen, musste er sogar ins Gefängnis) sowie sich gegen Sklaverei und soziale Ungerechtigkeit wandte.
Die dreisätzige Komposition „My father knew Charles Ives“ ist nicht mehr oder weniger als eine musikalische Autobiographie. Sie kann wegen der Lebensbezüge auch als eine Hommage und klanglich schillernde Lobeshymne an Charles Ives aufgefasst werden, der John Adams kompositorischen Weg entscheidend prägte.
Es ist immer wieder verblüffend und aufschlussreich, ein wie großer Beitrag zu essentieller Instrumentalmusik des 20. Jahrhunderts aus den USA kam. John Adams einzuordnen, fällt schwer. Auf jeden Fall ist er einer der wichtigsten Komponisten der Gegenwart, der Minimalismus in seiner ganz spezifischen Art unter Einflüssen von Wagner, Mahler, Sibelius, aber auch polyphoner Meister der Renaissance, Rock und Pop zu seinem eigenen unverwechselbaren avantgardistischen hochkomplexen Sound weiter entwickelte. In dem „My Father knew Charles Ives“ vorangegangenen Werk „On the Transmigration of Souls“ , 2002 für die New York Philharmonie im Andenken an die Tragödie von 9/11 geschrieben, wendet er sich gegen die Instrumentalisierung eines traumatischen Ereignisses für propagandistische Zwecke. Ein klingender Raum als Antidot zu Fremdenhass, Verfolgungswahn und falschen Patriotismus.
Im ersten Satz zu „My father knew Charles Ives“, nach der Heimatstadt des Komponisten „Concord“ betitelt, führt uns Adams tief in die Vergangenheit an einen still flirrenden Sommertag. Vögel zwitschern, der junge John übt auf der Klarinette Beethoven. In einer lärmenden Parade lädt er zu atmosphärischen Reminiszenzen an Ives „The Fourth of July 1912“ ein, ohne vordergründig auf melodische Anleihen zurückzugreifen. Der zweite Satz „Lake“ ist ein sommerliches Notturno. Über das Wasser sind Echos einer Tanzband zu hören. Erinnerungen des jungen Adams an den Auftritt verschiedener Bands in Winnipesaukes Gardens, einer von seinem Stiefgroßvater mütterlicherseits betriebenen Dancing Hall, werden wach. Im letzten persönlichsten Satz „The Mountain“ reicht das klingende Familien-Bilderbuch vom Mount Kearsarge in New Hampshire bis zu den Gipfeln in Kalifornien, die er als Bergsteiger selbst erklomm. Gewaltig sind die Steigerungen und Klangmassen, die die gigantischen Granitfelsen mystisch überhöhen.
Die „Harmonielehre“, von der es eine authentische Aufnahme gibt, vom Komponisten selbst mit den Berliner Philharmonikern dirigiert (September 2016, erschienen bei Berliner Philharmoniker Recordings), wurde im März 1925 in San Francisco uraufgeführt. Davor befand sich Adams in einer schwierigen und unproduktiven Schaffensphase. Die ausschließlich repetitiv-rhythmischen Muster des Minimalismus langweilten ihn. Also weitete Adams an dieser Weggabelung seiner Laufbahn den kompositorischen Radius um reichere tonale Ressourcen. Das 40-minütige, in allen Orchesterfarben irisierende Werk zählt zum Schönsten und dichtest Instrumentierten, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde. Der Titel erinnert an das berühmte Lehrbuch von Arnold Schoenberg, das Mahler gewidmet ist. Adams lag jedoch nichts ferner als pädagogisch wirken zu wollen. Vielmehr besteht der semantische Bezug in Adams eigenen, wohl reifen Erkenntnissen in Harmonielehre. Aber vergessen Sie sofort jeden Gedanken an trockene Musik. Die Harmonielehre ist vielmehr ein ekstatischer Klangkosmos, in die Sätze „I.“, „The Anfortas Wound“ und „Meister Eckhardt and Quackie“ unterteilt. Der letzte Satz geht auf einen Traum des Komponisten zurück, in dem er seine Tochter mit dem Spitznamen „Quackie“ auf den Schultern des mittelalterlichen Dominikanermönches Eckhardt durch das Weltall fliegen sieht. Das Ende des Satzes in Es-Dur überwältigt wie eine Mahler‘sche Apotheose über Beethovens „Eroica“ und Wagners in der Götterdämmerung alles überflutenden Rhein. Absolutely fabulous!
Dem Nashville Symphony unter der Stabführung des Musikdirektors des Orchesters Giancarlo Guerrero ist eine exemplarische Einspielung gelungen, alle harmonischen Kühnheiten werden im orchestralem Festkleid serviert. Das Album ist ein Meilenstein und funkelndes Juwel in der John Adams-Diskographie.
Dr. Ingobert Waltenberger

