CD JOHANN CHRISTOPH SCHMÜGEL: Friedens-Cantate 1763, GEORG PHILIPP TELEMANN: Hannover siegt, der Franzmann liegt; cpo
Musik aus dem Siebenjährigen Krieg 1756-1763
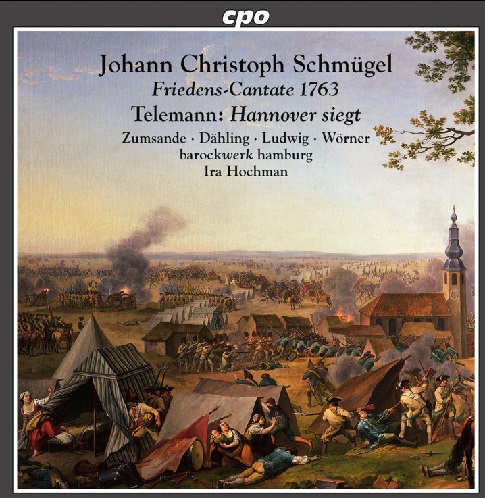
Im Siebenjährigen Krieg stritten sich Preußen und Großbritannien gegen ein Bündnis aus Frankreich, der Habsburgermonarchie, Russland; Schweden, Spanien, Kursachsen und Kurhannover um die Vormachtstellung in Europa, aber auch um Kolonien in Nordamerika, Indien und Afrika, um Seewege und ergo um Handelsvorteile. Vor allem Großbritannien und Frankreich ritterten um den größtmöglichen Einfluss in Nordamerika, auf den Philippinen und dem indischen Subkontinent. Von einem Weltkrieg waren die interessensmultiplen, vielfältigen und vielortigen kriegerischen Auseinandersetzungen nicht weit entfernt. Gekämpft wurde u.a. in Mitteleuropa, Portugal, Nordamerika, Indien, der Karibik sowie auf den Ozeanen. Die Friedensverträge von Paris und von Hubertusburg vom Februar 1763 verschoben die geostrategische Machtbalance zugunsten von Preußen und England.
An Grauslichkeiten für Soldaten und Zivilbevölkerung ließen die Auseinandersetzungen nichts „missen“. Betroffen waren nicht zuletzt die nördlichen Teile des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg (=Kurhannover) als in die Fronten eingequetschte Gebiete. Gekämpft wurde – wie wir das heute kennen – nicht nur mit leichten Waffen und schwerem Kriegsgerät, sondern auch mittels Propaganda, „fake news“, Abwertung des jeweiligen Gegners bzw. patriotischen Überhöhungen. Presse, aber auch die Künste (Poeterei, bildende Künste, Musik) spielten eine nicht unbedeutende Rolle dabei. Auf dem vorliegenden Album ist Musik, entsprungen genau jenem politischen Parteiendenken, zu hören.
Georg Philipp Telemann ist mit der Gottesdankes-koloraturjubelnden Bass–Arie „auf die glücklichen Progressen der alliierten Waffen in Hessen“ und dem Oratorium anlässlich der Sieges in der Schlacht bei Minden am 1. August 1759 „Hannover siegt, der Franzmann liegt“ vertreten. Die Stücke sind nicht bloß textlich kurios, war Telemann nicht nur in musikalischen Belangen ein Freund Frankreichs. Aber geldwerter Auftrag ist geldwerter Auftrag und so entstanden außer den beiden genannten Werken noch eine Reihe von Kantaten (u.a. „Großmächtigster Monarch der Briten“), die den englischen Königen, die auch Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg waren, Georg II. und Georg III. huldigten.
Telemanns schlachtensiegesfreudig chauvinistische Oratorium, mit dem die ewige Güte Gottes für die Wende im Krieg zugunsten der Briten/Preußen über Frankreich gepriesen wird, nimmt im Text („Gassenhauer“) explizit auf Senegal und Kap Breton Bezug. England konnte 1758 die Inseln Gorée (gehört heute zu Senegal) und Kap Breton (heutiges Kanada) von den Franzosen zurückerobern. Musikalisch teilt Telemann in diesem im Sommer 1759 vollendeten Oratorium einem „erfreuten“ (Mirko Ludwig Tenor), einem „triumphierenden“ und einem „zu Gott gewandten Hannoveraner“ (Dominik Wörner Bass) Arien zu. Der Alto (Matthias Dähling) tritt allegorisch als „Die Dankbarkeit“ und „Die hannoversche Friedenssehnsucht“ auf den Plan. Da ist von Rache, entkommener Schmach, aber auch nicht ohne Schadenfreude vom „Franzmann, der gedrückt, gebückt“ zu des (König) George Füßen liegt, die Rede. Die Bitte um Gerechtigkeit und Frieden, die huldreich einkehren sollen, wird vom Countertenor Matthias Dähling sanftstimmig, gespickt mit kessen kleinen Verzierungen vorgetragen. Wie harmlos für heutige Ohren Barockmusik in so einem Kontext klingt!
Im Zentrum des Albums steht die Friedens-Cantate 1763 für Orchester, Sopran, Alt, Tenor und Bass zur Lüneburger Friedensfeier am 6. Jänner 1763 anlässlich der Beendigung des Siebenjährigen Krieges. Der Telemann-Schüler Johann Christoph Schmügel hat das 40-minütige Stück musikalisch wesentlich interessanter, formal abwechslungsreicher, üppiger instrumentiert und schwungvoller im vorsichtiger jubelnd und insgesamt innigerem Zuschnitt als seines Lehrers hier präsentierte Kompositionen konzipiert. Als Sohn eines Organisten, gelang es Johann Christoph trotz erstklassiger, die Kompositionsqualitäten hervorhebenden Referenzschreiben von Telemann erst als 31-Jährigem, einen fixen Organistenposten in Lüneburg zu ergattern.
Der Musikwissenschaftler Jürgen Neubacher stellt im Booklet ausführlich die Forschungsergebnisse zu dieser außergewöhnlichen 82 Seiten starken, kalligrafisch verfassten Partitur vor, der einzigen größeren, die von diesem exzeptionellen Komponisten erhalten ist. Die musikalische Aufführung im Rathaus war Teil eines abendlichen städtischen Friedens- Dankfestes vom 6. Jänner 1763, das in einem 50 „Carossen“ umfassenden Corso, allesamt mit Fackeln illuminiert, kulminierte.
Erstmals nach ihrer Premiere am 6. Januar 1763 jetzt wieder an die Öffentlichkeit gelangt, rahmen solistisch besetzte Chöre zwei Accompagnato Rezitative, zwei Ariosi, ein Duett und weitere Chöre. Besonders festlich angelegt, erfreut der zweigeteilte Eingangschor mit einer Doppelfuge. Das harmonisch schroff auffahrende wie dramatische Bass-Arioso „So stürzt in Ungewittern sich auf betäubte Sterbliche ihr Felsenhaus und wird ihr Grab“ macht einer düsteren Sturm- und Drang Atmosphäre alle Ehre. Es erinnert in seiner musikalischen Kühnheit an inhaltlich verwandte Passagen in Balladen/Liedern von Franz Schubert. Das galante Duett Sopran-Alto „Nun hat der Retter“, in dem sich die Stimmen wie an einem Spalier aneinander hochranken, hätte sicher auch Mozart gefallen.
Anders als bei Telemann, wird hier – dank sei dem 21-jährigen Textdichter und Theologiestudenten Christoph Daniel Ebeling – der Sieg in bescheidenere, nachdenklichere Formeln gegossen. Da wird im Choral „Es hat, es hat vergeben“ nach Bach’scher Art auf „eigene Missetaten“ Bezug genommen und Gott gehuldigt, der lieber begnadigt als nach „unserer Schuld“ straft. In vom fabelhaften lyrischen Tenor Mirko Ludwig und vom Chor demütigt intonierten „Fallet nieder, betet an“ ergeht das Ringen um die gnädige Annahme der Opfer.
Ira Hochmann und das barockwerk hamburg setzen die Musik in allen Instrumentierungsfinessen und Abschattierungen der Emotionen in Szene. Am eindrücklichsten gelingt dies in Schmügels „Friedens-Kantate“. Der Schlusschor, in dem der Text des Tenor-Ariosos wiederaufgegriffen wird, ist ein unglaubliches Juwel an zartem Hoffnungssehnen. Historisch bestand dazu aller Grund: „Zum damaligen Zeitpunkt war dieser zurückgenommene, mehr banges Hoffen als sichere Gewissheit ausstrahlende Schluss tatsächlich angebracht, stand doch die Unterzeichnung der Friedensverträge von Paris und Hubertusburg noch bevor.“ (Jürgen Neubacher)
Was lernen wir daraus? Um wie viel sympathischer und überlegter agiert doch der Mensch, wenn nicht alles in trockenen Tüchern ist…
Empfehlung.
Dr. Ingobert Waltenberger

