CD HECTOR BERLIOZ „ROMEO & JULIETTE“, „CLEOPÂTRE“; Erato
Live-Mitschnitt mit Joyce DiDonato, Cyrille Dubois und Christopher Maltman – John Nelson dirigiert das Orchestre Philharmonique de Strasbourg
‚Als Shakespeare so aus heiterem Himmel auf mich niederkam, schmetterte es mich zu Boden.‘ Berlioz „Memoiren“
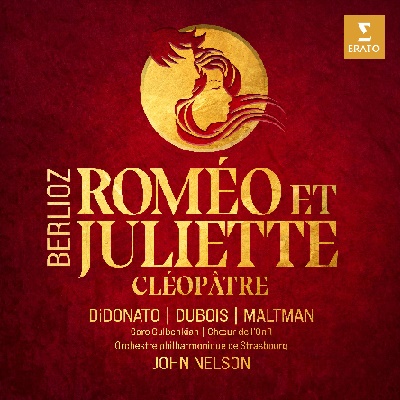
„Eine Sinfonie mit Chören“, so ordnete Berlioz selbst „Romeo et Juliette“ formal ein. Der Gesang sei lediglich dazu da, das Gemüt der Zuhörer auf die dramatischen Szenen vorzubereiten, deren Gefühle und Leidenschaften durch das Orchester ausgedrückt werden sollen. Berlioz hat im Prolog und den anschließenden drei Nummern der ‚Introduction‘ Soli für Mezzosopran und Tenor geschrieben, begleitet von einem kleinen Chor (14 Stimmen), der meist a cappella singt und „nach dem Vorbild Shakespeares die Handlung vorstellt“. Sonst sind an vokalen Einschüben lediglich der die Liebesszene flankierende Chor der Capulets abseits der Bühne, und in der Beerdigungsszene die Capulets im gemischten Chorsatz vorgesehen. Erst im Finale mit der Versöhnung der beiden Familien erleben wir die großen Chöre der Capulets und der Montagues in voller Pracht, dazu gesellen sich Bruder Lorenzos große Arie und die Predigt ‚Jurez donc par l’auguste symbole.‘
Hector Berlioz, dessen Geburtstag sich im Dezember 2023 zum 220. Mal jährt, hat in seinen unbedingt lesenswerten „Memoiren“, ergänzt um Briefe und Reiseberichte nach Deutschland, Österreich, Russland und England, aus seinem Herzen wahrlich keine Mördergrube gemacht. Als Prototyp des romantisch modernen Künstlers, der sein Selbst, sein künstlerisches Ich exzentrisch in sehnsuchtsvolle Klänge wandelte, war als unbedingter Shakespeare-Enthusiast der Romeo-Figur sehr nahe. Sein emotional so intensives Erleben entfachte sich nie rauschhafter als während eines Hamlet-Besuchs in Paris an der Schauspielerin der Ophelia – keiner geringeren als Harriet Smithson, die er 1833 heiraten sollte.
Als Berlioz an „Romeo et Juliette“ arbeitete, gestand er: „Welch ein leidenschaftliches Leben führte ich in dieser ganzen Zeit. Mit welcher Kraft schwamm ich in diesem weiten Meer der Poesie, umschmeichelt von der übermütigen Brise der Fantasie, unter den heißen Strahlen der Liebessonne Shakespeares und im Vertrauen auf meine Kraft, die wunderbare Insel zu erreichen, auf der sich der Tempel der reinen Kunst erhob.“
So schwärmerisch-pathetisch wie Berlioz Privates in musikalische Schöpfung goss, darf seine Musik als Inbegriff von Bekenntniskunst gelten. Kein Wunder, dass selbst der 26-jährige Richard Wagner von der 1839 uraufgeführten Symphonie „Romeo et Juliette“ so begeistert war, dass er Berlioz gar als den „wahren Erlöser unserer Musikwelt“ bezeichnete. Sicherlich verband die beiden Tonsetzer, dass sie eigenes Liebes-Erleben und -Sehnen in kunstvolle und originelle Partituren zu sublimieren verstanden.
John Nelson, das Orchestre philharmonique de Strasbourg und Hector Berlioz, bilden mittlerweile eine bestens aufeinander eingespielte Trias in etwa so, wie einst Colin Davis mit dem London Symphony Orchestra dem Schaffen des französischen Komponisten auf Tonträgern enzyklopädisch Schritt für Schritt nahte. Mittlerweile sind bei Erato die ungekürzte Originalfassung von „Les Troyens“, „La Damnation de Faust“, „Harold en Italie“ und „Les Nuits d’été“ erschienen. Für die amerikanische Mezzosopranistin Joyce DiDonato bildet „Romeo et Juliette“ bereits die dritte Berlioz-Kooperation mit dem Dirigenten Nelson.
John Nelson vermag mit dem vom jungen aserbaidschanischen Dirigenten Aziz Shokhakimov seit 2021 musikalisch und künstlerisch geleiteten erstklassigen Straßburger Orchester genau den Klang zu generieren, der Berlioz als denjenigen ausweist, der er ist: Ein mit Orchesterfarben wie keiner vor ihm jonglierender, die Strukturen der Symphonie neu deutender Visionär, der erstmals das gesamte Spektrum der (Blas)Instrumente für das Orchester erschloss und die Zuhörer zudem mit der räumlichen Wirkung eines riesigen Orchesterapparats überwältigte. In „Romeo et Juliette“ sah Berlioz neben den obligaten Streichern Piccoloflöte, zwei Flöten, zwei Oboen (eine als Englischhorn), zwei Klarinetten, vier Fagotte, vier Hörner, zwei Kornetts, zwei Trompeten, drei Posaunen, eine Basstuba, zwei Paar Pauken, zwei Tamburine, zwei Triangeln, eine große Trommel, Becken, Zimbeln und zwei Harfen vor.
Zur Stimulierung all der heterogenen Stimmungen und aufgepeitschten Leidenschaften der dramatischen Symphonie sind als Solisten die in der Tiefe und Mittellage immer dunkler und üppiger auftrumpfende Joyce DiDonato, der ungemein schön timbrierte lyrische Tenor Cyrille Dubois und der im Legato leider mit übermäßigen Vibrato singende Christopher Maltman als Père Laurence zu nennen.
Der Coro Gulbenkian lässt in kleiner Besetzung mit homogenen Stimmgruppen und kultiviertem Chorklang aufhorchen. In den dramatischen Tutti in großer Formation (‚Rixe des Capulets et de Montagues“) mangelt es in den hohen Lagen an ruhiger Stimmführung und in den quicken Passagen an Textverständlichkeit.
„Romeo et Juliette“ ist im Doppel-Album mit der lyrischen Szene „Cleopâtre“ gepaart. „La Mort de Cléopatre“ sollte dem 26-jährigen Hector Berlioz eigentlich ein Stipendium in Italien sichern. Das radikale Stück fällt 1829 aber durch. DiDonato identifiziert sich in hochdramatischer Attacke und glühender Intensität mit der Rolle der ägyptischen Königin kurz vor ihrem Tod und reiht sich damit (mit kleinen Abstrichen in den Akuti) in die Reihe der großen Berlioz-Primadonnen Regine Crespin; Janet Baker oder Jessye Norman ein. Den faszinierenden Monolog aus unendlichem Leid, bitterer Schmach, Selbstanklage und Erlösung gestaltet DiDonato als Psychogramm einer zum Selbstmord bereiten Frau. Besonders überwältigt die Meditation „Grands Pharaons, nobles Lagides“, die zum schönsten und wuchtigsten gehört, was Berlioz überhaupt komponiert hat. In verstörend realistischer Lautmalerei und opernhafter Eindringlichkeit endet die Szene mit dem Biss einer giftigen Schlange in die Brust und der Agonie der legendären Königin.
Empfehlung!
Dr. Ingobert Waltenberger

