CD CARL MARIA von WEBER „DER FREISCHÜTZ“ – RENÉ JACOBS, das FREIBURGER BAROCKORCHESTER und die ZÜRCHER SING-AKADEMIE in einer Hörspielfassung mit restituiertem Prolog; harmonia mundi
Neueinspielung zum 200. Jubiläum der Freischütz-Uraufführung
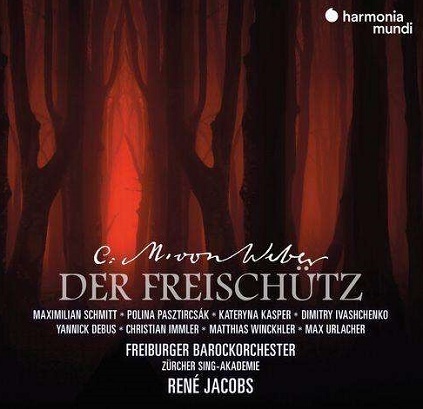
Es wäre nicht René Jacobs, wenn er nicht auch zum „Freischütz“ quellengeschichtlich Ursprüngliches und Spannendes für seine Geburtstags-Tonträgerversion bereithielte. Webers nach einer aus Apels Gespensterbuch entnommenen Sage komponierte Oper mit dem ursprünglichen Titel „Jägersbraut“ gilt als Inbegriff der deutschen Romantik. Ab 1817 widmet sich Weber in enger Kooperation mit dem Librettisten Friedrich Kind diesem schauermärchenhaften Drama. Uraufgeführt am 18. Juni 1821 in Berlin, wurde Webers romantische Oper in drei Akten „Der Freischütz“ bald zur deutschen Nationaloper hochstilisiert. Vielleicht sollte da auch des Musikwissenschaftlers Alfred Einsteins etwas ironische Richtigstellung im Zusammenhang mit der Toleranz des deutschen Theaterpublikums für entliehene Formen, nämlich dass die „berühmte Wolfschluchtszene ein französisches Melodram, die Romanze Ännchens eine französische Romanze und die große Szene der Agathe einen italienische Szena“ wäre, mitgelesen werden.
René Jacobs hat sich näher mit dem Libretto und der Oper zur Zeit der Entstehung auseinandergesetzt. Er kommt zu dem Schluss, dass Webers Frau, die Sängerin Caroline Brandt, Weber davon überzeugte, den Eremitenauftritt zu Beginn der Oper wegzulassen. Was wiederum den Librettisten Kind ärgerte, der in den Druckfassungen des Librettos den „Prolog“ aufnahm und monierte, dass „ohne ihn die Oper eine Statue wäre, welcher der Kopf fehlt.“
Dieser Prolog geht so: Der Eremit, den Agathe mit Lebensmitteln versorgt, leidet unter Albträumen (Arie „Allerbarmen, der Herr dort oben“). Als Agathe kommt (Dialog: „Hier, nimm den Korb Agathe“), gibt ihr der Klausner Agathe einen Strauß weißer, geweihter Rosen mit wunderbringenden Kräften (Duett: „Nimm hin des Freundes Gabe“). Da genau diese Rosen Agathe am Schluss der Oper das Leben retten, meint René Jacobs, dass der Schluss der Oper ohne den „Prolog“ kaum zu verstehen sei.
Jacobs ist von der Schlüssigkeit des Inhalts und der Dramaturgie der Oper sicherlich beizupflichten, allerdings ist Carl Maria von Webers Einstieg in die Oper mit der großartigen Ouvertüre und als Knalleffekt einem Gewehrschuss wohl publikumswirksamer.
Immer wieder gab es jedoch schon im 19. Jahrhundert Stimmen, die für die „amputierte Exposition“ des Dramas eine Nachkomposition vorschlugen. So folgte etwa Oskar Möricke dieser Aufforderung Friedrich de la Motte Fouqués und unternahm den Versuch, die Musik unter Rückgriff auf Motive aus dem „Freischütz“ zu vertonen. Genau das tat nun René Jacobs. Für die feierliche Eremitenarie bereitete Jacobs den Adagio-Teil der Ouvertüre und das Hauptthema seines Auftritts im Finale der Oper auf. Das sanfte Duett ging aus dem Mittelteil von „Oh, lass Hoffnung dich beleben“ (Max, Kuno, Chor) hervor. Für Kunos Romanze zum Brauch des Probeschusses „Herr Ottokar jagte durch Heid und durch Wald“ hören wir Musik von Franz Schubert, und zwar das Trinklied aus dem Singspiel „Des Teufels Lustschloss“ in der zweiten Fassung aus dem Jahr 1814.
Weiters ließ René Jacobs die Dialoge auf Basis von Kinds Urlibretto 1817 und dessen Ausgabe von 1843 zu einem Hörspiel-Szenario umarbeiten, in dem auch allerlei Geräusche und Klangeffekte wie Kirchenglocken, Wolfsheulen etc. nicht fehlen. Zudem wurde die Vorlage der Volkssage „Der Freischütz“ von Johann August Apels Gespensterbuch für die Neufassung herangezogen.
Was aber tun mit der stummen Rolle des Dämons Samiel, Abgesandter der Hölle und schwarzer Magier? Während der Samiel Darsteller in szenischen Aufführungen jedes Mal, wenn Kaspar mit ihm zu reden scheint („Samuel hilf“), schweigt, lässt ihn Jacobs in der Hörspielfassung der Oper sprechend als Kaspars „Böses Ich“ samt von zwei Schlagzeugern improvisierten spukhaften Geräuschen auftreten. Jacobs: „Er (Anm.: in der Aufnahme Max Urlacher) kommentiert wie ein infernalischer Zeremonienmeister Kaspars Vorbereitungen für das Höllenritual oder entwirft vor dem lieto fine seine grausame Vision eines tragico fine mit herzlos kalten Worten, die aus Apels Volkssage stammen.“
Musikalisch bewegt sich die Studio-Neuaufnahme, was das Freiburger Barockorchester und den fantastischen Kammerchor der Zürcher Singakademie anlangt, auf hohem bis allerhöchstem Niveau. Was René Jacobs aus dem historisch informierten Orchester aus der Partitur herausholt, ist einzigartig. Voll knisternder Spannung realisiert der aus der Alten Musik kommenden Schule alle Finessen der Partitur. Insbesondere die kunstreiche und effektvolle Instrumentierung kommt zu ihrem Recht wie kaum sonst auf einer anderen Einspielung, die berühmteste unter Carlos Kleiber inbegriffen. Was die Hörner und Celli an romantisch gespenstischem Waldesrauschen und gleichzeitig Luxusklang verströmen, ist lautmalerisch gruselig und erhaben großartig zugleich. Schon in der Ouvertüre schafft Jacobs den atmosphärisch dichten märchenhaften Raum. In der Wolfschlucht schält er zähnefletschende Monster, unheimlich schreiende Eulen, schaurige Höllengeister, wilde Heere und tobende Orkane aus der teuflischen Mitternacht.
Die Besetzung der Gesangsrollen ist unausgewogen. Von Anfang an begeistert Christian Immler als Eremit. Der sonore Qualitätsbass strahlt eine würdige Ruhe und in der Schönheit und im Ebenmaß des Stimmflusses die spirituelle Grandezza des christlichen Mahners aus. Mit Maximilian Schmitt ist Max nicht mit einer heldischen Stimme, wie sie einst Kollo oder Atlantov hatten, besetzt, sondern mit einem lyrischen Tenor an der Grenze zum Charakterfach. In den dramatischen Passagen kommt sein klanglich über wenig Schmelz verfügender Tenor an natürliche Grenzen, was sich in einem harten Vibrato manifestiert. Rein technisch kann er die Rolle, aber eine gewisse Monotonie in der Farbgebung verweigert der Figur die ambivalente Kontur eines angstbesessenen und dennoch überangepassten Einzelgängers. Auch die Agathe ist mit Polina Paszircsák eher lyrisch denn jugendlich dramatisch besetzt. Mit ihrem vom Timbre her ausgesprochen wohltuenden Sopran gestaltet sie ihre berühmte große Arie mit weit gespannten Kantilenen und einem makellosen Legato. In den Duetten und Ensembles mit dem bodenständigen und stimmkräftigen Ännchen der an die junge Varady erinnernden Kateryna Kasper zeigt sich aber, dass da fachlich was nicht recht zusammengeht. Matthias Winkhler vermittelt als der fürstliche Erbförster Kuno glaubwürdig die alten Traditionen bewahrende Respektperson. Leider ist Dimitry Ivashenko als Kaspar eine herbe Enttäuschung. Von Dämonie kann bei seinem in der Tiefe gut ansprechenden, aber wenig kernigen Bass keine Rede sein. Der deutsche Bariton Yannick Debus lässt als reicher Bauer Kilian und Ottokar jugendliche Stimmkraft blühen und gibt noch dazu jede Menge an Versprechungen für die Zukunft ab.
Der Schauspieler Max Urlacher – er spielt normalerweise diverse TV-Rollen in allen möglichen Sokos und Krimis, aber auch mal in einer Rosamunde Pilcher Verfilmung – ist als schwarzer Jäger Samiel eine Wucht und eine Klasse für sich. Mit scheinheilig säuselndem Flüstern, ränkevollem Scharren und dem irrlichternden Singsang des Bösen verleiht er der hörspielmäßig aufgewerteten Figur des teuflischen Verführers Samiel jene Eindringlichkeit, die aus dem Freischütz erst jene volkstümliche Oper aus mystischen Welten, Überirdischem und Höllischem, Aberglauben und Pappmaché-Hokuspokus macht, als die sie heute noch das Publikum zu faszinieren vermag.
Tipp: Nachdem die Jubiläums-Aufführungen des „Freischütz“ in der Konzertsaison 2020/21 ausfallen mussten, werden sie nun nachgeholt. Und zwar nach dem Release der CDs am 28. April im Konzerthaus Freiburg, am 30. April im Hessischen Staatstheater Wiesbaden, am 2. Mai in der Kölner Philharmonie und am 4. Mai in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Konzerte sind, von der Plattenbesetzung ein wenig abweichen, folgendermaßen besetzt:
Yannick Debus Ottokar/Kilian
Polina Pastircsak Agathe
Magnus Staveland Max
Mari Eriksmoen Ännchen
Dimitry Ivashchenko Kaspar
Max Urlacher Samiel
Matthias Winckhler Kuno
Torben Jürgens Ein Eremit
Zürcher Sing-Akademie
Freiburger Barockorchester
René Jacobs Dirigent
Dr. Ingobert Waltenberger

