CD CARL HEINRICH GRAUN: POLYDORUS – barockwerk hamburg, IRA HOCHMANN; cpo
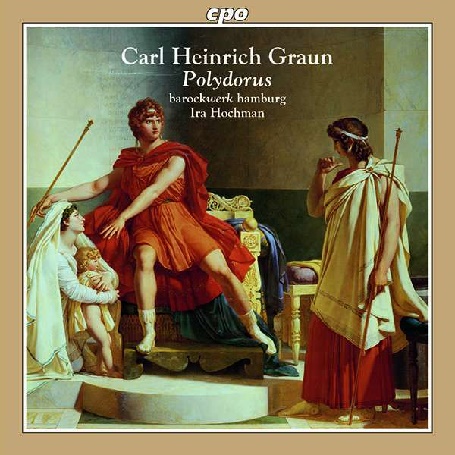
„Polydorus“, von Georg Thouret im Buch „Friedrich der Große als Musikfreund und Musiker“ 1898 allzu früh totgesagt, ist eine der insgesamt fünf deutschsprachigen Opern des später am Hofe Friedrichs so erfolgreichen Komponisten Graun. Als Kapellmeister der Königlichen Oper komponierte er zudem 28 Open in italienischer Sprache, die seinen Ruhm begründeten. Polydorus wurde zumindest musikalisch in Konzerten im Lichthof der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg am 14. und 15. März 2018 nach 300 Archiv-Jahren erfolgreich reanimiert, dann ging man damit in Raven ins Studio. Es ist eine typische Opera seria mit langen, kunstvoll ornamentierten da capo Arien und in der Aufnahme auf ein erträgliches Maß gestutzten Rezitativen.
Graun war – wie in Barockzeiten nicht unüblich – ein Multitalent. Als früherer Sängerknabe an der Kreuzschule in Dresden konnte er als Tenor mit einer eisernen Höhe eine beachtliche Opernkarriere hinlegen. Zusätzlich war Carl Heinrich ein bestens ausgebildeter Organist, Cembalist, Cellist, Lautenist und natürlich Wissender in Sachen Komposition. Offenbar schrieb er auch einige Rollen/Nummern in seinen zahlreichen Kantaten und Opern für sich selbst, darunter die von der Tessitura her stratosphärisch hohe Partie des Deiphilus in „Polydorus“.
„Polydorus“ auf ein Libretto von Johann Samuel Müller entstand zur Sommermesse 1726 in Braunschweig, wo der junge Sänger an der Hagenmarkt Oper engagiert war. Zuvor hatte das Sujet schon den Venezianer Antonio Lotti zu einer fünfaktigen Oper inspiriert.
Der Inhalt der Oper dreht sich um eine typisch antike Familientragödie: Priamus ist im trojanischen Krieg beschäftigt. Seinen jüngsten mit Hekuba gezeugten Sprössling Polydorus liefert er bei dessen Schwester Ilione, Gattin des thrakischen Königs Polymnestor, ab. Dem Ehegespons vertraut Ilione offenbar überhaupt nicht, weil sie fürchtet, Polymnestor könnte nach der Rückkehr aus der Schlacht ihren liebreizenden Bruder Polydorus abmurksen, um an dessen väterliches Erbe zu gelangen. Also tauscht sie die Identitäten ihre Sohnes Deiphilus mit derjenigen von Polydorus. Nur der Hofmeister Dares ist in diese Verstrickung eingeweiht.
Es kommt, wie es kommen muss: Troja geht unter, die Griechen verlangen mittels des Abgesandten Pyrrhus vom thrakischen König die Auslieferung des trojanischen Thronfolgers Polydorus. Und weil dieser Pyrrhus in die an den Hof geflüchtete Trojanerin Andromache verliebt ist, will er gleich auch sie haben. Polymnestor zögert nicht, diesen machtpolitischen Willen zu erfüllen, nichtsahnend, dass er damit in Wirklichkeit das Schicksal seines eigenen Sohnes Deiphilus besiegelt. Pyrrhus ersticht – sicher ist sicher – gleich nach der Übergabe den vermeintlichen Polydorus, in Wahrheit hat er damit den Königssohn Deiphilus getötet. Aus Rache und weil der noch einmal erscheinende Geist des toten Deiphilus dies fordert, lässt Ilione Polymnestor von ihrem Bruder Polydorus ermorden. Polydorus wird dabei von Andromache unterstützt, die an seiner Seite ganz einfach an die Macht will. Uns so dreht sich das Rad im Spiel der Mächtigen, es dreht sich und dreht sich und dreht sich.
In Barockzeiten erscheinen jedoch selbst die wüstesten Tragödien in höfische Koloratur und halsbrecherisch artistische Verzierungen gekleidet. Das Böse wirkt so bekömmlich, na ja auf jeden Fall harmlos wie Sachertorte mit Schlagobers. Das 2007 gegründete Orchester „barockwerk hamburg“, noch immer unter der musikalischen Leitung der israelischen Harfenistin Ira Hochmann, agiert schlank, scharf rhythmisch und artikulationsreich mit elf Streichern, sieben Bläsern, Laute, Orgel/Cembalo und Harfe. Einen eigenen Chor gibt es nicht, die Schlussnummer im fünften Akt wird von vier Solisten, und zwar Hanna Zumsande, Alon Harari, Mirko Ludwig und Ralf Grobe übernommen.
Vom Gesangsensemble sticht der Hamburger Mirko Ludwig in der Tenorrolle des Deiphilus hervor. Sensationell, wie er in seinen drei großen Arien die schönsten „Mozart“–Legati mit gestochen klaren Verzierungen und dramatischen Höhen zu einer einzigartigen Gesangsleistung verknüpft. Hervorzuheben sind auch die Leistungen der beiden weiblichen Hauptrollen, Hanna Zumsande als Ilione und Santa Karnite als Andromache. Beide verfügen über leuchtende, frische lyrische Soprane , die mit instrumentaler Stimmführung den technisch vertracktesten Anforderungen gerecht werden. Der Altus Alon Hatari und der Bass Fabian Kuhnen als Polymnestor bringen gediegene Gesangsleistungen zuwege, textverständlich sind sie überhaupt nicht. Die Bässe Ralf Grabe (Pyrrhus) und Andreas Heinemeyer (Dares) ergänzen das stimmige – von Mirko Ludwig einmal abgesehen – wenig expressive Ensemble.
Anmerkung: Um die Diskographie von Graun ist es gar nicht so übel bestellt. Neben hochkarätigen Aufnahmen von Oratorien, Passionen und Kantaten gibt es einen kuriosen Filmmitschnitt der Oper „Montezuma“ aus der Deutschen Oper Berlin 1982. Schon 1967 hatte Richard Bonynge einen Querschnitt dieser Oper mit Dame Joan Sutherland für das Label Decca eingespielt. Bei Capriccio ist die erste Gesamtaufnahme von“ Montezuma“ mit der Deutsche Kammerakademie Neuss unter Johannes Goritzki veröffentlicht worden. Rene Jacobs hat eine sehr empfehlenswerte (aktuell vergriffene) Einspielung der Oper „Cleopatra & Cesare“ bei hmc vorgelegt. Auch die ausschließlich Arien von Graun gewidmete CD von Julia Lezhneva mit dem Concerto Köln (Decca) ist ein Höhepunkt der Graun-Diskographie, die über die Vokalwerke hinaus auch mit zahlreichen Einspielungen von Kammermusik glänzt. Vereinzelte Gesangsnummern wurden u.a. von Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky und Regula Mühlemann für diversen Arien-Alben eingespielt.
Dr. Ingobert Waltenberger

