CD-Box “Böhmen liegt in uns – Warum der Klang der Bamberger Symphoniker die Menschen ergreift”; Accentus
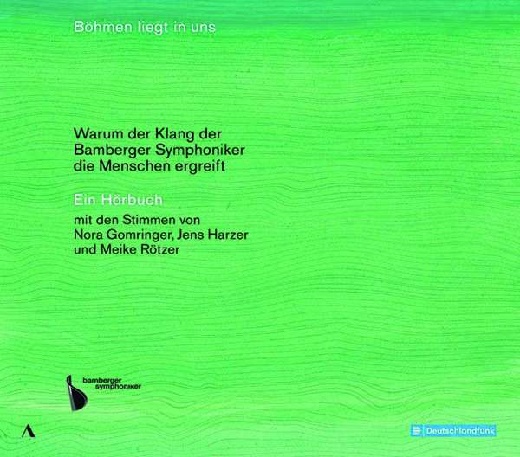
Zum 75. Geburtstag der Bamberger Symphoniker: Ein Hörbuch von Eva Gesine Baur mit den Stimmen von Nora Gomringer, Jens Harzer und Meike Rötzer sowie Aufnahmen von 1943 bis heute
“Grenzt hier ein Wort an mich, so lass ich’s grenzen. Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land.” Ingeborg Bachmann
Die Geschichte der Bamberger Symphoniker ist ein einzigartiges Zeugnis der neuen europäischen Nachkriegsordnung in der Musik mit allen existenziellen Fragen zu einem ruckeligen Start nach heftigen Geburtswehen. Aber das alsbald stolze fränkische Kind mit Prager Wurzeln konnte sich sehen lassen und entwickelte sich zu einem feschen mitteleuropäischen Musikantenensemble. War es ein Flüchtlingsorchester in der Nachfolge der Prager Deutschen Philharmonie oder ist unmittelbar nach Ende des Krieges an der von Bomben unversehrten Stadt an der Regnitz doch etwas ganz Neues und von der Identität her Unbeschriebenes entstanden? Gesichert ist, dass in den späten Vierzigerjahren Dreiviertel der Orchestermusiker aus Prag stammten. Wenn man berücksichtigt, wie viele Musiker in der Folge der Eroberung Prags durch die Sowjets und der Verfolgung der deutschsprachigen Bevölkerung ums Leben kamen, könne sogar gesagt werden, es sei das gesamte überlebende Orchester gewesen, dass sich 1946 neu zu den “Bamberger Tonkünstlern” und dann zu den Bamberger Symphonikern ordnete. Gerade deswegen geht das Hörbuch der Frage des Klangs, aber auch möglicher Lebenslügen nach. Ein Schauspieler löckt den Stachel in den Zuhörern gegen alle Gewissheiten, hakt ein, bohrt nach und sinniert. Franz Kafka begleitet in Zitaten als moralische Instanz und Wahrheitsheld durch die gesamten 200 Jahre aufgearbeitetes Zeitgeschehen. “Keiner war mehr Prag als Kafka.”
Eva Gesine Bauer greift in ihrem bewegenden und erschütternden Hörbuch weit zurück in die Geschichte, um über einen böhmischen Klang zu sinnieren, der Heimweh macht. Ist es urwüchsiges Musikantentum oder der Dirigent, der diesen Klang erzeugt? Das Hörspiel wartet mit unendlichen Details auf, lädt aber durch die reflektierenden Betrachtungen des Schauspielers zum Nachdenken ein, etwa über das Schicksal von Künstlern in Zeiten von Nationalismus, von Krieg und Verfolgung. Der Atem stockt einem des öfteren beim Zuhören. Die Betrachtungen über den böhmischen Klang weiten sich im Laufe der Stunden zu einem einzigartigen Zeit-Panorama, mit unheiligen Verquickungen und Lügen, Eitelkeiten und Opportunismus, aber wir vernehmen auch Wundersames zu höchsten Ansprüche an künstlerische Integrität, Solidarität und Mut.
Der Handlungsfaden beginnt am 50. Geburtstag des Orchesters 1996 und greift dann ins 18. Jahrhundert zurück. Wir werden vom Orchestergeist an der Hand genommen und wohnen der Uraufführung des “Don Giovanni” im Prager Ständetheater am 29.10.1787 bei. Ein Theater größer als das Wiener Burgtheater, aber ohne lästige Hofzensur. Mozart fühlte sich in Prag künstlerisch verstanden, nachdem Salieri und Paisiello ihn in Wien weit abgehängt hatten. Die blasenden Instrumente, da waren die böhmischen Musiker Meister. Das Publikum in Prag verstand, weil die Musiker Mozart verstanden. “Wenn die Musiker und Dirigent eine Gemeinschaft des Fühlens sind, dann ist Empathie ein wesensbegründendes Element des Klanges”, merkt dazu der Schauspieler an.
Wir folgen Weber und Wagner auf ihren Wegen in Prag und Dresden. Wie hat Carl Maria von Weber, Dirigent und Komponist, den deutsch-böhmischen Klang mit dem so herrlich sinnlichen Horn-, Bratschen- und Klarinettenton von Prag nach Dresden transportieren können, damit Wagner ihn dort auspacken konnte? Bei Wagners “Tannhäuser“ und “Lohengrin” war es ebenfalls der Klang, oder das, was die “Prager” daraus machten, das Mysterium, das das Publikum auf unbekanntes Terrain entführte. Wagner wurde so das Idol der tschechischen Vorkämpfer Dvorak und Smetana. Was war da deutsch und was war böhmisch?
Die Gründung des Prager Nationaltheaters brachte das Ständetheater in finanzielle Schwierigkeiten. Intendant Angelo Neumann engagierte daraufhin 1885 den Perfektionisten Gustav Mahler als Dirigenten, der in kurzer Zeit alle da Ponte Opern Mozarts einstudierte. Für den “Brückenbauer zur Musik der Zukunft” war auch das 1888 mit den Meistersingern von Nürnberg eröffnete “Neue Deutsche Theater” (heute Prager Staatsoper) ein künstlerisch wichtiger Ort. Dann kam der gestrenge Leo Blech, der über Patzer der einzelnen Orchestermusiker Buch führte. Seine Fähigkeiten als Dirigent allerdings begeisterten nicht nur Mahler. Otto Klemperer wiederum beglückte sein Publikum durch die Fähigkeit, die Partitur wie ein Röntgenbild zu durchleuchten.
1908 streikte das Orchester des Neuen Deutschen Theaters, die Musiker verdienten damals weniger als Handwerker. Die tschechischen Musikern wurden, weil staatlich unterstützt, besser bezahlt. Das Neue Deutsche Theater machte aber nicht dicht. Klemperer spielte am Klavier, es sang der Opernchor. Erich Kleiber war damals Volontär. Mahlers Siebente Symphonie kam am 19.9.1908 in Prag heraus. Die Liebe zu Mahler war eine vorübergehende starke Brücke über die nationalen Gräben in Prag hinweg, weil zur Aufführung dieser Symphonie Musiker aus beiden Orchestern mitwirkten. Vielleicht auch deshalb, weil diese in extremen Gegensätzen wühlende Symphonie ein Klangporträt der Stadt und seiner Menschen darstellte.
Alexander von Zemlinsky war von 1911 bis 1927 Musikdirektor am Neuen Deutschen Theater in Prag. Als er 1914 während seiner Tätigkeit als Kapellmeister Richard Wagners “Parsifal” dirigierte, übertrumpften sich die Zeitungskritiken in ihrer Begeisterung für den ‚Pultvirtuosen‘. Zemlinskys Schüler und Schwager Arnold Schönberg setzte nach: „Für mich bist Du unbedingt der erste lebende Dirigent.“ Der erste Weltkrieg brachte es mit sich, dass jede Woche andere Musiker zum Kriegsdienst eingezogen wurden. Alles Französische und Russische, später alles Italienische wurde von der Zensur aus dem Repertoire gestrichen. Zemlinsky konnte aber noch mit einem Kammerorchester Wunder bewirken. “Sagenswert ist nur das noch nie Gesagte”, gab Anton von Webern zu Protokoll, als Zemlinsky als Pionier Schönbergs Verklärte Nacht mit großem Orchester aufführte.
1918 schrieb Zemlinsky an seinen Schwager, “dass das Deutschtum hier zusammenbrechen werde.” Tomáš Garrigue Masaryk, der erste Staatspräsident der Tschechoslowakei, garantierte im Dezember aber die Zukunft des Deutsche Theaters. Aus wirtschaftlichen Gründen setzte Operndirektor Leopold Kramer auf Operetten und Revuen. Zemlinsky fürchtete um den Klang des Orchesters. 1926 mussten die Antipoden Kramer und Zemlinsky nach einem Intermezzo mit dem amerikanischen Dirigenten George Szell schließlich zurücktreten. Die Politik begann sich in den Vordergrund zu drängen. “Die Töne der Macht, waren sie nicht immer stärker als die Macht der Töne?”
Die Kluft zwischen Deutschen und Tschechen wurde breiter. Das Dunkle, das Schwere und das Bedrohliche waren ebenfalls Prag. Gehörte dies auch zum besonderen Klang? Hemmungslos das Beste für etwas Düsteres? 1929 kehrte der als “Chemiker” benannte, alle Klänge zerlegende Szell nach Prag als Generalmusikdirektor zurück, bereits 1919 hatte er die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft angenommen. 1937 setzte sich Szell vor der politischen Verfolgung nach Schottland ab.
Ab März 1939 verdunkelten sechs Jahre Reichsprotektorat Böhmen und Mähren die Prager Welt. Mozartliebe und Massenmord. Der antijüdische Terrorapparat schlug ungnädig zu, u.a. bei Viktor Ullmann und Hans Krasa, die in Konzentrationslagern sofort umgebracht wurden.
Die deutsche Kulturpolitik suchte nach neuen Köpfen: Ein angemessen großer Chef für die Deutsche Philharmonie musste her. So kam der Smetana-Bewunderer Joseph Keilberth auf Empfehlung von Furtwängler im Sommer 1940 nach Prag. Der Klarinette und Horn spielende Keilberth passte zum Orchester und seinem Klang. Politisch ging alles drunter und drüber. Tschechische Sabotageakte nahmen sprunghaft zu, die “Germanisierung“ wurde verweigert. Keilbert nannte seinen 1941 in Prag geborenen einzigen Sohn Thomas ,nach Thomas Mann, dem Dichter, der aus dem Exil gegen die Nazis anschrieb. Trotzdem mitspielen, den Mund halten und wegducken musste er sich auch.
Am 14.2.1945 fielen die ersten Bomben auf Prag, nach Hitlers Suizid am 1. Mai erhob sich ein unerbittlicher Aufstand gegen die Besatzer. “Tod den Deutschen”, lautete die Parole. Es war auch das Ende des Deutschen Orchesters. Am 9.5.1945 marschierte die Rote Armee ein. Keilberth und seine Familie wurden durch die Stadt gepeitscht, der Konzertmeister des Orchesters auf der Straße erschossen. Manch Musiker wurde mit dem Kopf nach unten auf einem Laternenpfahl aufgehängt, mit Benzin übergossen und angezündet. Keilberth wurde an die Wand gestellt, Scheinhinrichtung durch Genickschuss. Später im Jahr, 37 Jahre alt, konnte er Prag in Richtung Dresden verlassen. Musik war für Keilberth damals inneres Überlebensmittel, jedenfalls sicher vor Diebstahl.
Die erste Stadt ohne Kriegszerstörung von Prag in den Westen war Bamberg. Und wer von den Musiker der Deutschen Philharmonie dort landete, blieb. Am 20.3.1946 fand das erste Konzert des Tonkünstlerorchesters statt. Die Bamberger Symphoniker hatten als Flüchtlingsorchester materielle Vorteile, aber die gemeinsame Geschichte brachte auch Identität und Zusammengehörigkeit durch schöne wie schreckliche Erlebnisse. Was Not tat, war das Klanggedächtnis und der Dirigent, der den Klang kannte und weckte: Keilberth, der aber im Nachkriegsdeutschland nicht zu finden war. Hans Knappertsbusch sprang ein und fand, dass das Orchester zu den besten Europas gehöre. 1949 dirigierte Keilberth zum ersten Mal nach dem Krieg in Bamberg. Beethovens “Eroica“ stand ebenso auf dem Programm wie beim letzten Konzert 1945 in Prag. Der Klang sollte nicht zudecken, sondern transparent sein, das war Keilberths Ziel in jeder Hinsicht.
Die Bamberger Symphoniker waren das erste Deutsche Orchester, das nach dem Krieg in Frankreich auftrat.1950 unterschrieb Keilberth den Vertrag in Bamberg. 1954, nachdem Furtwängler starb, waren Karajan, Celibidache und Keilberth die Anwärter auf den Chefposten der Berliner Philharmoniker. Wie das Match ausging, ist bekannt. Keilberth duldete nur Direktmitschnitte der Konzerte, aber er hatte keine Nähe zu den Plattenfirmen wie Karajan.
1958 wurde Keilberth GMD an der Bayerischen Staatsoper. 1968 traten die Bamberger Symphoniker zu einem Gastspiel nach Japan auf. Die Tournee geriet zu einer Sensation. Vor den Berliner Philharmonikern eroberten die Bamberger Japan für die deutsche Orchesterkultur. Eugen Jochum war nach Keilberths Tod bis 1973 der Nachfolger in Bamberg. Istvan Kertesz sollte der nächste Chefdirigent in Bamberg werden, wäre er nicht im April 1973 im Toten Meer ertrunken. Es brauchte fünf Jahre, bis die Bamberger einen “Neuen“ präsentierten: James Loughran, der von 1979 bis 1983 wirkte. Horst Stein folgte, 1993 wurde die neue Konzert- und Festhalle mit der “Achten” Mahler eröffnet. Jonathan Nott, der anfangs vom Orchester Unbeliebte, wollte dem Orchester das Atmen wieder beibringen, den Klang ausrichten auf Innigkeit, Wehmut und Pathos. Zeitgenössisches kam wieder auf die Spielpläne. 2003 wurden die Bamberger Symphoniker zur Staatsphilharmonie ernannt. 2007 wurde Herbert Blomstedt zum Ehrendirigenten ernannt. Christoph Eschenbach, ein Globalisierungsgegner in Bezug auf den Klang, wandelte einen berühmten Satz Kafkas ab: “Musik solle die Axt sein, die das innere Eis bricht.”
Nach Jonathan Nott kam der Prager Jakob Hrůša nach Bamberg, der bis heute dem Orchester vorsteht.
Musikbeispiele mit Ausschnitten aus Werken von Smetana (Ma Vlast), Mozart (Ouvertüre zu ‚Don Giovanni‘), Serenade Nr. 13 G-Dur, Wagner (Ouvertüre zu Tannhäuser), Mahler (Symphonien Nr. 7, 1), Schönberg (Verklärte Nacht) , Krenek (Adagio und Fuge für Streichorchester). Es dirigieren Jakub Hrůša, Jonathan Nott, Lothar Zagrosek, Ernst Krenek und Joseph Keilberth.
Dr. Ingobert Waltenberger

