CD ANTON BRUCKNER: SYMPHONIEN Nr. 2 & 8; GEWANDHAUSORCHESTER, ANDRIS NELSONS; Deutsche Grammophon
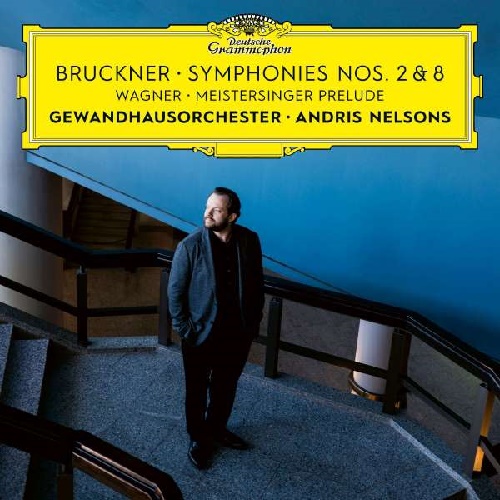
Die wohl bekömmliche Melange Bruckner-Wagner setzt das klanglich dafür prädestinierte Gewandhausorchester Leipzig mit Live-Aufnahmen aus dem Jahr 2019 (September und Dezember) fort. Diesmal stehen das Vorspiel zum ersten Aufzug von Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“, die Symphonie Nr. 2 in c-Moll (Version 1877, Edition William Carragan 2007) und die Symphonie Nr. 8 in c-Moll, (Version 1890, Edition Leopold Nowak) von Anton Bruckner auf dem Programm.
Ich oute mich jetzt als Bewunderer dieses Leipziger Edel-Klangkörpers. Er verdankt seinen ungewöhnlichen Namen der Gewerbehalle der Tuchmacher samt ungenutzten Dachboden, der alsbald in einen Konzertsaal umfunktioniert wurde. In den 20-er und zu Beginn der 30-er Jahre waren Wilhelm Furtwängler und Bruno Walter die prägenden Kapellmeister. Seit 1970 bestimmten und bestimmen Kurt Masur, Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly und Andris Nelsons die künstlerischen Geschicke des Orchesters.
Der besonders in den Bläsern spezifisch platin-silbrige Klang des Gewandhausorchesters, die selbst bei Fortissimos stets gewahrte Durchhörbarkeit und präzise Gewichtung der Instrumentengruppen zueinander eignet sich gerade in der hoch präzisen Lesart von Andris Nelsons idealerweise für die mystisch-verzückten Instrumentalgalaxien eines Wagner oder Bruckner. Das Brucknerische Hitzeflirren der Streicher, die in die Gesamtdramaturgie gebetteten, stolz und dennoch niemals grell geschmetterten Posaunen- und Trompetenfanfaren, das in orgelähnlichen Clustern formulierte markerschütternde Gebet, die wie eine Stahlfeder gespannte, mit Generalpausen genährte Gottesanbetung werden dringlich und glaubhaft formuliert.
Andris Nelsons hat für die „besonders zugängliche“ Zweite (die eigentlich schon die Dritte ist) ein gutes Händchen. Bruckner vollendete die Symphonie im September 1872 während seines Sommeraufenthalts in St. Florian. Wir hören eine Art Letztfassung, die William Carragan 2007 publizierte. Er orientierte sich nicht an den Versionen der beiden von Bruckner geleiteten Aufführungen von 1873 und 1876, sondern fabrizierte zuerst eine imaginäre „Urfassung“ 1872 (publiziert 2005), bei der die Sätze in der Reihenfolge erscheinen, in der sie komponiert, aber niemals aufgeführt wurden. Seine im Vergleich zur Version 1872 wesentlich kürzere Fassung 1877 greift in vielen Einzelheiten auf Angaben des Erstdrucks von 1892 zurück, nennt jedoch das Jahr 1877, das schon Haas und Nowak in ihren Fassungen anwandten. Nelsons sieht die „Zweite“ als idealen Einstieg in den Kosmos von Bruckner und rätselt, warum das Werk so selten gespielt wird.
Und tatsächlich, der Interpretation Nelsons fehlt jede Erdenschwere und Behäbigkeit. Die ausgeklügelt differenziert modellierten Binnenphrasen, das trotz zahlreicher Generalpausen flüssig spannungsreiche Vorwärts, das Überwiegen des diesseitig Himmelnahen (Zitate aus der f-Moll Messe) vor den letzten Dingen, all das läuft auf eine Art heiterer Gottesschau zu.
Die „Meistersinger Ouvertüre“ passt insofern zum Programm der zweiten Symphonie – sie wurde von den Wiener Philharmonikern und ihrem Dirigenten Otto Dessoff im Herbst 1872 nach einer Probe als unspielbar und Unsinn abgetan -, als es auch in Wagners Oper um den unverstandenen Künstler geht. Das Vorspiel schieb Wagner in der Karwoche 1862. Am 1. November desselben Jahres dirigierte es Wagner höchstpersönlich in Leipzig zum ersten Mal öffentlich mit dem Gewandhausorchester. Diese historische Authentizität ins Hier und Heute zu holen, ist Andris Nelsons Anliegen. Neben der Brillanz des Orchesters hätte ein klein wenig mehr an Leichtigkeit und Spielwitz die Wiedergabe noch attraktiver gemacht.
Was Bruckners endzeitliche „Achte Sinfonie“ in c-Moll anlangt, in ihrer ersten Fassung am 3. Juli 1887 abgeschlossen, hat sich Nelsons für die Edition Leopold Nowak, Version 1890 (also die Zweitfassung) entschieden. Christian Thielemann hat sich für seine mit den Wiener Philharmonikern eingespielte „Achte-Bruckner“ für die Edition Haas entschieden. Die Spieldauer der wie die „Zweite“ in der Schicksalstonart c-Moll gehaltenen Symphonie beträgt bei Nelsons 82 Minuten.
Ob die Todesverkündigung am Ende des ersten Satzes, das rustikale Scherzo („Deutscher Michel“), das weit gespannte, ungemein abgeklärte Adagio in Des-Dur – eines der himmlisch tröstlichsten der gesamten Musikgeschichte – oder das durch die „Drei-Kaiser-Zusammenkunft“ inspirierte, alle Bausteine bündelnde Finale, Nelsons versteht es mit seiner sensiblen, nicht nur äußerste Grenzen abschreitenden Wiedergabe (in der Kultivierung von Piani und der Kunst, Bögen zu formen und sich dabei Zeit zu lassen, Thielemann nicht unähnlich) der gigantischen Bruckner-Diskographie einen markanten Meilenstein hinzuzufügen. Nelsons Verständnis ist folgendes: „Bruckner drang hier, vor allem im langsamen Satz, in Regionen vor, die anderen Komponisten unerreichbar blieben. Auch die Geschlossenheit des riesigen Werkes gleicht einem Wunder. Hierzu trägt vor allem der grandiose Finalsatz bei – der letzte, den Bruckner vollenden konnte.“ Das beschreibt im Innersten die Gründe für das exzellente Ergebnis des neuen Albums: die existenzielle Grenzerfahrung und Transzendenz der Musik begegnen einer gotisch-kühn und luftig gebauten Architektur, die in einem alle Bausätze krönenden Finale kulminiert.
Fazit: Interpretatorisch technisch und von der spirituellen Botschaft her packende Wiedergaben wie aus einem Guss. Die Faszination ersteht aus einem Gewirk an schmerzlicher Lebenserfahrungen und christlicher Sehnsuchtsbotschaft, anschaulich nach geheimnisumrankten und dennoch konturiert sich konkretisierenden Reliefs musiziert. Nelsons oder Thielemann? Beide auf jeden Fall hochkarätig, am Ende bilden den Ausschlag individuelle Geschmacks- und Erwartungsnoten.
Dr. Ingobert Waltenberger

